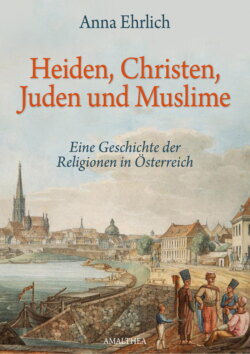Читать книгу Heiden, Christen, Juden und Muslime - Anna Ehrlich - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUR REFORMATION 1. DAS HEIDENTUM Die alten Götter
ОглавлениеVom Glauben der Ur-Österreicher wissen wir wenig. Funde wie Grabbeigaben und Idole lassen darauf schließen, dass man bereits seit der Altsteinzeit an ein Leben im Jenseits glaubte und dass Muttergottheiten besonders verehrt wurden. Ob es sich um eine matriarchalische Gesellschaftsform handelte, kann nur vermutet, nicht bewiesen werden. Um 1800 v. Chr. begann man Kupfer abzubauen und Bronze zu erzeugen, die ersten größeren Siedlungen entstanden. Als um 800 v. Chr. neue Völker (Zugehörigkeit nicht restlos geklärt, Illyrer? oder frühe Kelten?) aus dem Norden in unseren Raum eindrangen, vermischten sie sich mit den Ureinwohnern zu einer neuen Kultur, der »Hallstatt-Kultur«, von der wir uns ein recht gutes Bild machen können.
Als aus dem Osten um 400 v. Chr. verschiedene Stämme der norischen Kelten eindrangen, nahmen sie die religiösen Bräuche der Urbevölkerung und deren Glauben an die Große Mutter an, verhalfen daneben aber auch ihren männlichen Stammesgöttern zu Ansehen. Stand bei ihnen der Stammvater oder doch noch die weibliche Schöpfungskraft im Vordergrund, oder ist das nur das Wunschdenken einiger Autoren?
Der im Jahre 1851 gefundene Kultwagen aus Strettweg/Judenburg stammt aus der Zeit von 600 v. Chr. und gehört der Hallstatt-Kultur an. Der Figurenschmuck stellt vermutlich eine Opferprozession dar. Der Wagen ist im Joanneum in Graz ausgestellt
Drei keltische Göttinnen namens Wilbeth, Ambeth und Worbeth (die drei Bethen oder Matronen) entsprachen den drei Aspekten der Großen Mutter: jungfräuliches, weißes Licht und Leben, rote Fruchtbarkeit, schwarze Ruhe und Heil. Diese weibliche Trinität lässt sich in den »Heiligen Drei Madln« Katharina, Margaretha und Barbara wieder erkennen, die im Volksglauben des Ostalpenraums bis heute eine Rolle spielen und deren Symbole Rad, Lindwurm und Turm recht gut zu den drei Bethen passen. Beim Entstehen und Vergehen des Menschen im Kreislauf der Natur spielte das männliche Element keine Rolle: Nach dem Tod des Körpers zieht sich die Seele zur Erholung in die Anderswelt in einen markanten Berg wie den Untersberg, Kahlenberg oder Ulrichsberg zurück, bis es Zeit für ihre irdische Wiedergeburt wird. Dann lässt sie sich mit Quellwasser, dem Element des Lebens und Milch der Urmutter, an die Erdoberfläche spülen. Trinkt nun eine gebärfähige Frau das Wasser, so nistet sich die Seele in ihr ein und wird bald als neuer Mensch geboren. Es dürfte also bei den Norikern ursprünglich keinen allmächtigen Göttervater gegeben haben, die zahlreichen männlichen Gottheiten stammen von der Großen Mutter ab und haben ihre Macht von und mit ihr.
Männliche Priester, die Druiden, und die zahlreichen Menschenopfer lassen allerdings vermuten, dass das Patriarchat bei unseren keltischen Vorfahren zumindest auf dem Vormarsch war. Sie verehrten besonders den Kriegsgott Belenus, den glänzenden Gott des Lichts, den sie für ihren Stammvater hielten. In Aquileia erinnert noch heute der Stadtteil Beligna an seinen Namen. Sowohl in Salzburg (St. Peter) als auch in Grado (Barbana) gab es offenbar große Kultstätten zu seinen Ehren. Im Jahre 582 wurden – so will es die Überlieferung – dann zeitgleich an beiden Orten christliche Klöster gegründet. Der Wilde Mann oder Schimmelreiter, der in unseren Sagen die Wilde Jagd anführt, ist wohl Cerunnos, der Gehörnte. Dessen Sommergestalt Esus – Sohn der großen Mutter – bereitete durch die Namensähnlichkeit die Aufnahme von Jesus bei den Kelten vor. Cerunnos wird zu seinem Gegenspieler, dem Teufel. Gut dazu passen Sagen, die von Frau Holle oder Perchta (Berta) berichten, die vermutlich die große Muttergöttin der Steinzeit war und als Noreia, Tana, Frigg und Maria weiterlebte. Wenn in den Raunächten (um die Jahreswende) ihr wildes Gefolge beim Perchtenlauf neu erweckt wird, so schließt man damit an alte Volksbräuche an, deren vorkeltische, keltische, slawische und germanische Wurzeln nicht mehr zu unterscheiden sind.
Die Religion der Noriker ist trotz der Bemühungen der Keltologen aber nicht wirklich greifbar und bleibt weitgehend Vermutung. Was wir darüber wissen, verdanken wir neben der Archäologie und unseren Sagen den griechischen und römischen Autoren, die nur leider keine Namen der einheimischen Götter überliefern. Nur Lucan nennt in seiner »Pharsalia« die drei keltischen Götter Teutates, Esus und Taranis. Die Römer setzten die einheimischen Götter mit ihren eigenen gleich, was zwar naheliegend, aber falsch war. Diese »Interpretatio Romana« macht sich auch in der bildlichen Darstellung einheimischer Götter bemerkbar. So erhielt Jupiter optimus maximus in Ansfelden einen Altar, das darauf dargestellte Rad zeigt aber, dass es sich um den keltischen Donnergott Taranis handelt.
Vor der Wallfahrtskirche in Maria Taferl hat sich ein heidnischer Opferstein erhalten