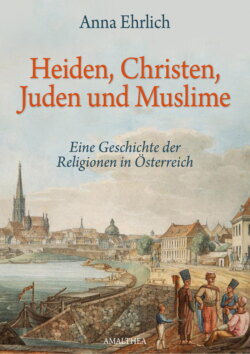Читать книгу Heiden, Christen, Juden und Muslime - Anna Ehrlich - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EINFÜHRUNG
Оглавление»Wie sich doch die Zeit geändert hat!
Die Apostel machten Krumme g’rad,
doch Pius kehrt die Ordnung um
und macht Gerade krumm.«
So spotteten die Wiener anno 1782, als im allgemeinen Getümmel beim Ostersegen von Papst Pius VI. (Giovanni Angelo Graf Braschi, 1717–1799) einer alten Frau beide Beine gebrochen worden waren. Die Gläubigen hatten sich in Massen in die Nähe des Heiligen Vaters gedrängt, und sehr rücksichtsvoll gingen sie dabei nicht miteinander um. Hochgestellte Herrschaften hatten es besser, denn sie wurden zum Fußkuss zugelassen. Es meldeten sich allerdings so viele dazu an, dass man sie nicht alle berücksichtigen konnte. So ersuchte man den Papst zu erlauben, wenigstens seinen Pantoffel verehren zu dürfen. Der Heilige Vater lachte zwar über diese Albernheit der Frommen, gewährte ihnen jedoch die Bitte. So soll dann ein Pantoffel in seinem Vorzimmer zum Küssen bereitgestanden haben und ein zweiter in verschiedene Häuser getragen worden sein: »Ach, wie der Pantoffel auf goldenen Tassen, unter Vortretung aller Hauslivreyen, mit Fakeln, begleitet, von Zimmer zu Zimmer herumtransportiret, bekueßt, beleckt, – und Gott weiß was alles ward!«, berichtet ein Zeitgenosse.
Das Gepränge, das der gut aussehende Besucher rund um das Osterfest entfaltete, war zwar für das Wiener Christenvolk schön und sehr erhebend, den Zweck seiner Reise erreichte er aber nicht. Kaiser Joseph II. ließ sich nicht von seiner durchgreifenden Kirchenreform abhalten. Er war dem hohen Gast bis in die Gegend von Neunkirchen entgegengereist. »Um jede feierliche Begrüßung zu vermeiden, bin ich auf dem großen Wege, nur in Gegenwart der Postillione, mit ihm zusammengetroffen. Ich habe ihn sofort aussteigen lassen, in meinen Wagen gesetzt und ihn geradewegs nach Wien in die Burg geführt«, schrieb er an seinen Bruder Leopold. Er hatte auf diese Art das übliche höfische Zeremoniell einfach umgangen. Zwar brachte er den Heiligen Vater voller Hochachtung in Maria Theresias früherem Schlafzimmer in der Hofburg unter, das eigens mit einem Altar versehen worden war, von den öffentlichen Auftritten seines Gastes in Wien, ja sogar vom Pontifikalamt am Ostersonntag, hielt er sich aber fern und schützte Krankheit vor (siehe S. 196).
Josephs Kirchenreformen waren schmerzhafte Eingriffe in die althergebrachten Rechte der katholischen Kirche, denn sie beschränkten deren Macht, enteigneten einen Teil deren Besitzes und stellten diese unter die Kontrolle des Staates. Was war die Ursache für sein Vorgehen? Waren die Vorrechte der Kirche untragbar geworden? Oder war ganz einfach eine neue Zeit mit neuen Ideen angebrochen?
Um diese Fragen beantworten zu können, ist es nötig, sich ein wenig mit der Religionsgeschichte dieses Landes zu beschäftigen, die aber in ihrem europäischen Zusammenhang gesehen werden muss. Sie erzählt, wie die katholische Kirche nach weltlicher Macht strebte, welche religiösen Strömungen es neben ihr gab, wie diese grausam unterdrückt wurden, und wie sie sich zur Herrschaft über den Staat aufschwingen konnte, bis Kaiser Joseph II. ihr die Flügel beschnitt.
Seit Josephs Toleranzgesetzgebung wird – mit Ausnahme der nationalsozialistischen Ära – in unserem Land niemand mehr vom Staat wegen seiner Religion verfolgt oder zu einem bestimmten Glauben gezwungen, wenn es auch immer wieder zu Benachteiligungen einzelner Gruppen aus religiösen Gründen kam. Heute ist das Menschenrecht auf freie Religionsausübung verfassungsmäßig jedem Bewohner dieses Landes garantiert und notfalls mit Hilfe des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg durchsetzbar.