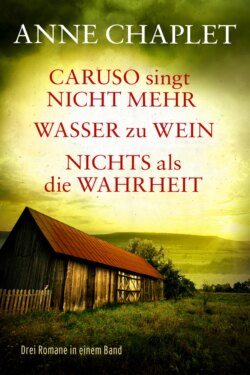Читать книгу Caruso singt nicht mehr / Wasser zu Wein / Nichts als die Wahrheit - Drei Romane in einem Band - Anne Chaplet - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеDas Klingeln des Telefons schreckte Anne Burau um acht Uhr aus dem Schlaf. Unten heulte Dagobert, und Sammy kratzte an ihrer Schlafzimmertür. Benommen griff sie zum Hörer.
»Frau Burau?« Es rauschte in der Leitung. Wie bei einer Funkverbindung. Aber es war unüberhörbar Krysztof.
»Was ist?« fragte Anne knapp und mit heiserer Stimme.
»Kannst du kommen?«
»Was zum Teufel ...? Es ist erst ...« Anne guckte auf die Uhr und korrigierte sich. Es war schon acht. Normalerweise war sie längst auf den Beinen.
»Kuh ist weg«, sagte Krysztof kryptisch.
»Was?« Anne verbesserte sich: »Wo?«
Sie hörte durchs Telefon, wie schwer Krysztof atmete. So aufgeregt hatte sie den ruhigen, geduldigen und immer fleißigen Mann noch nie erlebt. »Ebersgrund, vor Postamt.«
»Um Himmels willen! Ich bin gleich da.« Anne wollte dynamisch aus dem Bett springen, aber ihre Beine waren wie Blei und ließen sich nur mit äußerster Mühe über die Bettkante heben. Es dauerte eine Weile, bis sie wieder klar hatte, was gestern nacht passiert war. Anne stöhnte auf. »Rena!« flüsterte sie.
Im Nachthemd schleppte sie sich über den Flur, wehrte den begeisterten Sammy ab und klopfte an Renas Tür. »Rena!« rief sie heiser und rüttelte an der Türklinke. Die Tür war verschlossen. »Rena, mach auf!« Anne merkte, wie die Angst in ihr hochstieg. Sie hämmerte an die Tür. Nichts.
Anne trat einen Schritt zurück und wollte ein weiteres Mal nach ihrer Tochter rufen. Die Tür zu Renas Zimmer, sah sie plötzlich, war gar nicht von innen verschlossen. Der Schlüssel steckte außen. Hatte man Rena ebenfalls eingesperrt?
Es gelang Anne erst nicht, die Tür zu öffnen, weil sie in ihrer Erregung schon die Klinke herunter- und die Tür aufdrücken wollte, während sie doch erst noch den Schlüssel ganz herumdrehen mußte. Sammy winselte neben ihr, als ob er ihre hilflose Verzweiflung spürte. Schließlich hatte sie es geschafft. Die Tür flog gegen die Wand.
»Rena?« rief Anne. Das Zimmer war leer. Das Fenster über dem Bett stand offen.
»Dem Herrn sei Dank«, flüsterte Anne und ließ sich auf das Bett sinken. »Dem Kind ist nichts passiert.« Aber woher wollte sie das eigentlich wissen? Wo war Rena? Mein Gott, sie ist achtzehn, versuchte Anne sich zu beruhigen. Sie wird weggefahren sein. Sie ist ausgeritten. Sie ist – das war die rettende Idee! – bei Krysztof. Aber warum hatte sie ihr Zimmer abgeschlossen? Zufall, redete Annes innere Stimme ihr gut zu. Es wird schon nichts passiert sein.
Der Gedanke beflügelte sie, daß sie ihre Tochter in Ebersgrund bei Krysztof und der entlaufenen Kuh antreffen könnte. Sie lief, noch etwas steif, die Treppe hinunter und stieg in die Arbeitsklamotten, die in der Kammer neben der Eingangstür hingen. Sammy versuchte an ihr hochzuspringen, aber sie schob das Tier ungeduldig weg. Draußen heulte Dagobert – der arme Kerl war noch immer eingesperrt. Beide Hunde hätten schon längst gefüttert werden müssen. Anne öffnete in Rekordtempo eine Hundefutterdose, füllte die Freßnäpfe und ließ einen überströmend dankbaren Dagobert frei. Dann griff sie sich den Autoschlüssel vom Schlüsselbrett und lief zum Parkplatz.
Ihr alter Mercedes-Kombi war ein zuverlässiges Auto. Er hatte nie eine Panne, er sprang immer an. Nur heute nicht. Anne gab nach sieben Versuchen auf, fluchte laut und lange, ließ den Schlüssel stecken und warf die Autotür mit Wucht hinter sich zu. Sie lief den Feldweg und die Straße hinunter nach Ebersgrund, Dagobert hinter ihr her.
In der frischen Luft klarte es langsam auf in ihrem Kopf. Krysztof hatte heute morgen die kleine, trächtige Kuh von einer Koppel holen sollen, die am weitesten vom Weiherhof entfernt lag – Richtung Dorf, Richtung Ebersgrund. Dabei mußte sie ihm entlaufen sein. Komischerweise freute sich Anne darüber. Das zeigte doch, wie gesund und gewitzt ihre Tiere waren. Und voller Energie: Es waren immerhin anderthalb Kilometer bis zum Dorf. Warum Krysztof die Kuh noch immer nicht eingefangen hatte?
Als Anne in Ebersgrund angelangt war, wunderte sie sich darüber nicht mehr. Das Rindvieh stand mit gesenkten Hörnern mitten im Dorf, umgeben von einer Meute Neugieriger, drei Streifenwagen, einem Polizisten mit Motorrad und Krysztof, dem man die Ratlosigkeit und Verlegenheit ansah. Der Fahrer des Streifenwagens links hatte das Fenster heruntergekurbelt und redete in sein Funkgerät – »Rinderwahnsinn«, hörte Anne, und: »Verstärkung«.
Als er sie sah, beendete er das Gespräch. »Frau Burau?« Sie nickte.
»Haben Sie an dem Tier irgend etwas Außergewöhnliches bemerkt?«
»Nicht daß ich wüßte«, antwortete Anne. »Was ist hier überhaupt los?« Sie blickte fragend in die Runde und registrierte mit einem kleinen, scharfen Schmerz, daß Rena nicht zu sehen war.
Die Hölle war los, wenn man dem Motorradpolizisten Glauben schenken durfte. Ihn hatte das Tier mitsamt der schweren Maschine einfach umgestoßen, nachdem er es nach einer Verfolgungsjagd mit drei Streifenwagen umzingelt hatte. Seine Kollegen hatten vorsichtshalber ihre Vehikel gar nicht erst verlassen, denn das weiße Untier hatte nach ihnen ausgeschlagen und sichtbare Dellen im Autoblech hinterlassen.
Anne konnte sich einen Lacher nicht verkneifen. Die netten Jungs mußten sich ziemlich dämlich angestellt haben.
»Gibt es bei Ihnen«, fragte sie der junge Polizist mit dem vor Verlegenheit leicht geröteten Gesicht, »vielleicht Fälle von Rinderwahnsinn?«
Es kostete sie Mühe, ernst zu bleiben. So wie sie die Dinge sah, handelte es sich hier lediglich um einen Fall von tierischem Selbstbehauptungswillen. Freiheitsdurst war nicht wahnsinnig, sondern, glaubte Anne fest, ein tiefverwurzelter Trieb aller Kreaturen. Achselzuckend nahm sie Krysztof das Halfter aus der Hand, ging langsam auf das schweißüberströmte Tier zu und streifte es ihm einfach über den Kopf. Sie drückte dem polnischen Feldarbeiter den Strick in die Hand.
»Schaff sie fort«, sagte sie. Dagobert schnappte nach dem rechten Hinterlauf des Tieres, als ob er ihm Beine machen wollte.
Während die Streifenfahrzeuge abdrehten und die Neugierigen sich um sie sammelten, diktierte Anne dem Jungpolizisten ihre Personalien. Sie grüßte diejenigen der Gaffer, die sie kannte, kommentierte freche Bemerkungen mit einem Achselzucken und machte sich auf den Heimweg. Der Alltag hatte sie wieder. Die gestrigen Ereignisse erschienen ihr unwirklich.
Die Luft war frisch und feucht, der Himmel über ihr bot ein Spektakel aus fliehenden Wolken vor eisblauem Hintergrund. Die Sonne hatte ihren Höchststand noch nicht erreicht, aber viel höher würde sie um diese Jahreszeit auch nicht mehr steigen. Anne stapfte mechanisch vorwärts, dem vorauslaufenden Dagobert hinterher. Als sie der erste Tropfen traf, blickte sie überrascht nach oben. Wo eben noch Bewegung war, hatte sich jetzt ein einförmiges, mit Gelb vermischtes Grau ausgebreitet. Sie hatte noch einen Kilometer zu gehen und eine Jacke ohne Kapuze an. Anne stemmte sich in den plötzlich böigen Wind.
Zuerst fand sie den kühlen Regen angenehm, der von ihrer Haut abperlte. Dann regnete es stärker, die Tropfen wurden zu scharfen kleinen Nadelspitzen. Ihre Brille hatte sie längst in die Tasche ihrer Jacke gesteckt, deren Imprägnierungsschutz seine besten Zeiten hinter sich hatte. Unermüdlich drang das Wasser auf sie ein, durchnäßte ihre Jeans auf der Vorderseite ihrer Oberschenkel, schlüpfte unter die Ärmel ihrer Jacke, durchweichte ihre Schuhe. Anne kniff die Augen zu, in die der Regen hineinzuschlagen versuchte. Es war, als ob die entgrenzten Elemente angetreten wären, ihr die Erinnerung an die letzte Nacht und an die paar Quadratmeter gekachelte Panik auszutreiben.
Anne atmete tief ein. Sie verstand noch immer nicht, was eigentlich passiert war. Wer sie eingesperrt hatte und warum. Aber das war jetzt egal: Sie mußte endlich wissen, wo Rena war. Als sie auf den Feldweg zum Weiherhof einbog, war ihr heiß vor Sorge. Sie begann zu laufen, durch den langsam abebbenden Regen, durch den Schlamm, über den Schotter, durch Regenpfützen. Im Haus machte sie sich gar nicht erst die Mühe, ihre nassen Klamotten auszuziehen. »Rena!« rief sie laut schon im Flur, lief in die Küche, in den großen Kaminraum, ins Gästezimmer und dann die Treppe hoch. Fast vermißte sie die hart hämmernde Musik, die ihr sonst immer überdeutlich mitgeteilt hatte, daß ihre Tochter zu Hause war. Vor Renas Tür hielt sie inne und versuchte Atem zu schöpfen. Sich zu fassen, sich zu beruhigen. Dann öffnete sie die Tür. »Was ist denn?« klang ihr eine schlaftrunkene Stimme entgegen. Rena hatte die Vorhänge zugezogen und lag im Bett.
Dem Himmel sei Dank. Anne machte die Tür leise hinter sich zu und lehnte sich atemlos an die Wand. Sie hatte sich vergeblich gesorgt. Rena war nichts passiert. Ihre Erleichterung übertönte fast die zaghafte kleine Stimme, die wissen wollte, warum Rena denn dann um acht Uhr früh noch nicht im Bett gelegen hatte? Und warum ihr Zimmer von außen abgeschlossen gewesen war? Anne schob den Gedanken weg. Ihre Tochter war achtzehn. Und durfte machen, was sie wollte. Vielleicht war sie mit Alexander zusammengewesen? Das schien ihr die einfachste, die natürlichste Lösung des Rätsels zu sein. Aber aus irgendwelchen Gründen war ihr der Gedanke unbehaglich. Der Junge ist nicht echt, dachte sie und erinnerte sich an die Szene auf der Koppel gestern nachmittag. Mit dem stimmt was nicht. Mütterliche Eifersucht? Sie schüttelte den Gedanken ab. Das war es nicht, da war sie sich sicher. Er liebt sie nicht, schoß es ihr durch den Kopf. Er liebt sie nicht.
Unter der heißen Dusche beruhigte sie sich wieder. Sie mußte dringend überprüfen, ob auf dem Hof und in den Ställen alles in Ordnung war. Ob etwas fehlte. Mit Krysztof reden. Und, notierte sie im Kopf, ihn bitten, den Feldweg mit Schotter aufzuschütten und zu begradigen.
Es gab soviel zu tun. Soviel zu tun.
Als Anne sich warme, trockene Sachen angezogen hatte und aus der Haustür kam, bot sich ihr ein so grotesker Anblick, daß sie laut lachen mußte. Kommissar Kosinski stand weit zurückgelehnt am Zaun zur Löschteichwiese, hielt eine Zigarette in der Hand und starrte sichtlich beunruhigt auf Dagobert, der vor ihm saß, die Ohren aufgestellt, die Rute gerade nach hinten gestreckt, und ihn nicht aus den Augen ließ. Das Tier knurrte schon, wenn der Mann auch nur die Zigarette an den Mund führte.
»Hat er wenigstens schon gefrühstückt?« rief der Kommissar mit gequälter Stimme zu ihr herüber.
Anne pfiff nach dem Hund. »Tut mir leid. Er tut nur seine Pflicht.« Sie konnte ein leises Vergnügen an der unbehaglichen Lage nicht leugnen, in der Kosinski womöglich schon einige Zeit hatte ausharren müssen. Warum sollten nicht auch andere mal in Angst und Schrecken leben?
Sie packte den Hund fest am Ohr und ging mit ihm auf Kosinski zu: »Das ist Kommissar Kosinski., sagte sie. »Das ist ein Freund.« Dagobert knurrte. »Hörst du?« fragte Anne mit leiser Autorität, schüttelte den unwilligen Hundekopf an den Lauschern hin und her und blickte dem Tier in die Augen. Zeremoniell legte sie die freie Hand auf Kosinskis Rechte. Der Hund knurrte. »Freund«, wiederholte Anne und hielt dem Tier, das sie noch immer am Ohr gepackt hielt, des Polizisten Hand hin, die der ihr sichtlich widerstrebend überließ. Dagobert zeigte die Zähne, nahm aber Witterung auf. »Freund!« sagte Anne noch einmal, ließ Kosinskis Hand los und hob den Zeigefinger. »Hörst du?«
Was immer sich in dem Hundehirn abspielen mochte, das Knurren verebbte, Dagobert begann Kosinskis Hosenbeine zu beschnüffeln, und als der Ermittler ihm mutig die vorsichtshalber zur Faust geballte Hand ein weiteres Mal vor die Nase hielt, beroch das Tier sie mit wachsam nach oben gerichteten Augen erst verhalten, dann mit wachsendem Interesse. Schließlich hob Dagobert die Rute einige Zentimeter an und wischte dem Kommissar mit nasser Zunge einmal über die Knöchel. So begannen Freundschaften fürs Leben. Jedenfalls fürs Hundeleben.
»Freund?« fragte Kosinski und sah dem Tier in die gelben Augen. Anne, die die Szene amüsiert beobachtet hatte, mußte lachen, als Dagobert sich desinteressiert abwandte und zum Wohnhaus trottete.
»Na ja, gute Bekanntschaft ist ja auch schon was«, murmelte Kosinski und betrachtete seine Hosenbeine, die Dagobert mit einem einzigen kräftigen Schütteln seines noch immer regennassen Fells schnell noch gründlich naß gemacht hatte.
Dann blickte er Anne an. »Warum haben Sie mich nicht angerufen?« fragte er streng.
Anne zuckte mit den Schultern. »Gestern war ich zu müde. Heute hatte ich zu tun.« Und was ging ihn das überhaupt an? »Warum sollte ich?« fügte sie trotzig hinzu.
Kosinski sah sie ungeduldig an. Sie sah müde aus, fiel ihm auf. Sie hatte Ringe unter den Augen. Ihr Haar war verstrubbelt. Und ihre Hände gruben nervös in ihren Jackentaschen herum.
»Liebe Frau Burau«, sagte er mit gespielter Geduld, in einer Stimmlage, die Anne rebellisch machte. Sie drehte sich unwirsch zur Seite. Sie war zu müde für Widerworte.
»Ihr Mann ist einem Mordanschlag zum Opfer gefallen«, sagte Kosinski förmlich. »Ihr Pferdestall ist angezündet worden. Eines der Tiere ist umgebracht worden. Und Sie hat man gestern in eine Ihrer Kühlkammern gesperrt, wie ich heute morgen hörte.« Rudolf und Werner mußten bei der Polizei angerufen haben. Irgend etwas ärgerte sie an dieser Fürsorge.
»Und Sie wollen mir weismachen, das alles sei ganz normal?«
»Oder ein schlechter Scherz«, antwortete Anne, die sich über sich selbst wunderte. Warum nahm sie die Ereignisse der letzten Nacht nicht ernster?
Kosinski seufzte. »Hören Sie, Frau Burau ...« Jetzt klang er plötzlich anders. Anne guckte überrascht zu ihm hinüber. Er sah besorgt aus. Er sah, dachte Anne, beinahe hilflos aus.
»Mir ist die ganze Angelegenheit ein Buch mit sieben Siegeln. Ich komme mit dem Fall nicht weiter. Überhaupt nicht.« Der Kommissar seufzte wieder. Warum war die Burau bloß so entsetzlich dickköpfig und widerspenstig? »Ich brauche Ihre Hilfe.«
Anne sagte nichts. War das ein ermittlungstechnischer Trick? Oder war sie plötzlich wirklich nicht mehr die Tatverdächtige Nummer eins? Aus irgendeinem Grund glaubte sie plötzlich, ihm vertrauen zu können. »Gehen wir«, sagte sie kurz und ging voraus. Kosinski folgte ihr zum Wohnhaus und in den großen Raum im Erdgeschoß.
Ihm gefiel, was er sah. Die Bücherwände reichten bis zur Decke, ein gemauerter Kamin dominierte den Raum, und auf einem der beiden einladend großen Sofas räkelte sich der dicke graue Kater. Vor dem Fenster stand ein Schreibtisch, rechts davon führte eine Balkontür auf eine Terrasse, auf der ein Lorbeerbaum neben einem Zitronenbäumchen stand, Gartenmöbel, ein Sonnenschirm. Den würde man in diesem Jahr wohl nicht mehr brauchen.
Anne schilderte in knappen Worten die Ereignisse der Nacht, ein bißchen verlegen, so, als nähme sie sich nicht weiter wichtig. Kosinski rauchte. Die Aussagen der beiden Jagdpächter erlaubten keinen Zweifel an der Version der Burau: Sie mußte tatsächlich stundenlang eingesperrt gewesen sein. In der Kühlkammer, in der man auch die Leiche ihres Mannes gefunden hatte.
Kosinski drückte seine dritte Ernte 23 in dem extra geräumigen Aschenbecher aus, den Anne ihm demonstrativ hingestellt hatte, und sah sie prüfend an. Sie hat jede Menge Selbstbeherrschung, dachte er flüchtig. Vielleicht manchmal ein bißchen zuviel davon.
»Keine Vorstellung, wer es war?«
»Vorstellungen jede Menge!. Anne brauste auf. »Der Mörder, der Brandstifter, der Pferdeschlitzer!«
»Ich meine: Denken Sie an eine ganz bestimmte Person dabei?«
Anne schüttelte den Kopf, jetzt wieder ganz kleinlaut.
Kosinski guckte geistesabwesend aus dem Fenster und kraulte dem dicken Kater den Bauch, der sich neben ihn auf den Rücken geworfen hatte, alle vier Pfoten in die Luft gestreckt.
»Wenn es der Mörder Ihres Mannes war, der Sie heute nacht eingesperrt hat«, sagte er schließlich, »lautet die Preisfrage: Warum leben Sie dann noch?«
»Frage ich mich auch.« Plötzlich merkte Anne, wie ihr die Ungeheuerlichkeit der letzten Nacht bewußt wurde. Nein, normal war das wirklich nicht, was hier passierte. Ein Fluch lag auf dem Hof, hatte sie Paul erzählt. Anne hielt die Luft an. Ihr war, als hätte ein eisiger Hauch aus der Vergangenheit sie gestreift.
»Warum hat jemand Ihren Mann umbringen wollen?« fragte Kosinski, jetzt ganz ernst.
»Na, Sie wissen doch«, wollte Anne kokett antworten, »die frustrierte Gattin ...« Aber sein Blick verbot ihr jegliche Frivolität. Er wollte ihre Hilfe. Er wollte wirklich ihre Hilfe.
»Gibt es vielleicht«, hakte Kosinski geduldig nach, »irgend etwas aus der Vergangenheit, das uns einen Hinweis auf ein Tatmotiv geben könnte?« Anne sah ihm in die Augen und gab sich einen Ruck.
»Sie wissen«, fragte sie leise, »was mich und meinen Mann – entfremdet hat?« Was für ein banales Wort, dachte sie sarkastisch, für die Beschreibung eines jahrelangen brutalen Verrats.
Kosinski fingerte schon wieder eine Zigarette aus der Schachtel. »Im wesentlichen ja. In den Details nein.«
Anne sah ihn stumm an, stand auf und ging zum Bücherregal. Mit zwei Aktenordnern und einer Mappe kam sie zurück.
»Hier«, sagte sie und legte die Akten auf den Tisch. »Das ist zwar nur ein kleiner Ausschnitt. Bei der Gauck-Behörde stehen an die zwei Meter. Aber mir reicht es völlig. Man nennt so etwas heutzutage eine Opferakte.«
Kosinski nickte. Er glaubte, ihre Bitterkeit verstehen zu können.
»Damals war es der operative Vorgang ›Blondie‹. Viel Vergnügen.«
Es war ein deprimierender Wintertag gewesen. Berlin kam ihr hektisch und fremd vor. Und die Taxifahrt durch die Stadt, vorbei an der Wüstenei des Potsdamer Platzes, am Brandenburger Tor, am Alexander-Platz schien sich endlos hinzuziehen. Nur die Karl-Marx-Allee, die bei Anne noch immer Stalinallee hieß, übte auf sie einen gewissen Reiz aus. Die Stalinallee war einst das Geschenk des »sowjetischen Volkes« an das »Volk der DDR« gewesen: ein langgestrecktes, geschlossenes, durchaus eindrucksvolles Gebäudeensemble. Ausgerechnet dem Stalinismus war es gelungen, so etwas wie eine eigenständige Architektur zu hinterlassen, mit eigenem Stil, mit einer Stein gewordenen Botschaft. Das Taxi passierte die Torhäuser am Strausberger Platz. An den langgeschwungenen Wohnblocks waren die Fassadenverkleidungen großflächig abgefallen. Immer noch wirkten diese Gebäude großzügiger als die kleinkarierten Plattenbauten, mit denen realsozialistische Bürokraten die arbeitende Klasse beglückt hatten. Ob es die westdeutschen Bauplaner besser machen würden?
Wahrscheinlich, dachte Anne. Aber nur, weil das wirklich kein Kunststück war.
Der Tag lag verfroren und verschlafen unter einer tiefen, schmutzigen Wolkendecke. Anne war auf dem Weg nach Berlin-Lichtenberg – in die Normannenstraße, zum einstigen Stasi-Hauptquartier. Hier hatte das Ministerium für Staatssicherheit alles aufbewahrt, was es über seine Bürger in Erfahrung bringen ließ. Akten, Fotos, Filme, Tonbänder und sogar, als besondere Perversion, Geruchsproben von Leuten, die man für Staatsfeinde hielt. Heute verwaltete die Bundesrepublik die Ergebnisse dieses bürokratischen Kontrollwahns. Sie waren für jedermann einsehbar. Wer wollte, konnte hier erfahren, wer ihn ausgespitzelt, verraten, denunziert hat. Und, was vielleicht viel wichtiger war, wer das nicht getan hatte.
Anne hatte bis zu diesem Tag, zwei Jahre nach der Wende, die Möglichkeit verdrängt, daß sie hier einmal auf die Suche nach ihrer Vergangenheit gehen würde. Andere, glaubte sie, hatten es nötiger.
»Willst du nicht auch einen Antrag auf Akteneinsicht stellen?« hatte sie Leo gefragt, im Frühjahr 1991, als es aussah, als ob sie ihre Ehe noch einmal gerettet hätten. Er mußte als Mitglied der Friedensbewegung aktenkundig geworden sein.
»Mit dieser verdammten Stasi-Hysterie habe ich nichts am Hut«, knurrte er schlecht gelaunt.
»Aber sie haben dich doch unter Garantie erfaßt – dich und Wolfgang und Monika und Frank!.
Frank hatte seinen Antrag längst gestellt. Noch hatte er nur die Antwort erhalten, daß er vom Staatssicherheitsdienst mit seinen Personalien erfaßt worden war. Das ließ darauf schließen, daß es auch Unterlagen gab. Die aber waren noch nicht gefunden worden. »Ich zittere ein bißchen vor dem ganzen Theater«, hatte er Anne bei ihrem letzten Telefongespräch gestanden. »Aber ich will es endlich wissen.« »Alles?« hatte sie ihn gefragt. Nach einer kurzen Pause sagte er: »Alles.«
Leo wollte gar nichts wissen. »Was soll mir das nützen? Daß die uns belauscht und bespitzelt haben, weiß ich auch ohne Akten.«
»Ihr müßt in der Gruppe einen Maulwurf gehabt haben, es ist viel zuviel aufgeflogen damals. Willst du nicht wissen, wer von euch IM war?«
Leo hatte abwehrend mit den Schultern gezuckt und etwas von »Hexenjagd« gemurmelt. Das Thema war kein Thema mehr. Auch Anne hatte schließlich zu glauben begonnen, das Problem gehe viele an, viele Opfer der Stasi, die ihr Mitgefühl verdienten. Nicht aber sie selbst. Oder ihren Mann.
Der Brief hatte diesen Glauben erschüttert. Man habe, hieß es in vorsichtigem Behördendeutsch im Schreiben des »Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik« – im Volksmund nach seinem Leiter die »Gauck-Behörde« genannt –, man habe Material gefunden, aus dem hervorgehe, daß sie beim Ministerium für Staatssicherheit der DDR als »operativer Vorgang« geführt worden sei. Man lade sie nach Berlin zur Akteneinsicht ein.
»Mach, was du willst«, war Leos mürrischer Kommentar.
»Mach’s«, riet Wolfgang ihr zu. »Du wirst sonst nie erfahren, wem du noch heute bedingungslos vertrauen kannst. Und das wäre vor allem für deine Freunde schrecklich.«
Das Wachpersonal am Eingang zum Haus 7 erinnerte Anne an DDR-Grenzer seligen Gedenkens. Man verlangte ihren Ausweis, schaute ihr routinemäßig aufs Ohr, füllte penibel einen Laufzettel aus und verordnete in bestem Behördendeutsch, sie habe ihren Hausausweis »deutlich sichtbar bei sich zu führen« – man werde ihren Personalausweis »einbehalten«, bis sie das Haus wieder verlassen wolle. Anne merkte, wie sich ihr Widerspruchsgeist meldete. Dabei war dieses Theater bestimmt nicht böse gemeint, dachte sie. Nur alte Gewohnheit.
Fünf Minuten später stand Frau Fisch vor ihr, eine etwa vierzigjährige, sportlich wirkende Aschblonde in Jeans, der die Verlegenheit ins Gesicht geschrieben stand. »Eine patente Mutti«, dachte Anne und hätte fast gegrinst. Sie hatte nie verstanden, warum diese Bezeichnung für DDR-Frauen geradezu ein Kosename gewesen war.
»Coole Karrieretype«, registrierte Ilona Fisch, als sie Anne etwas verloren beim Empfang stehen sah. »Sehr schlank. Sehr blond. Sehr gepflegt. Gut geschnittenes Kostüm. Interessante Brille.« Das minderte ihr Mitleid mit der Frau keineswegs. Die traf es meistens am härtesten, die glaubten, alles im Griff zu haben. Und die all die Jahre eine Kleinigkeit übersehen hatten.
»Wollen Sie gleich in die Akte schauen, oder soll ich Ihnen erst zeigen, wo wir die Unterlagen gefunden haben?« Die beiden Frauen lächelten sich an. Anne merkte, daß ihr jeder Aufschub recht war. Man bot ihr, als Politikerin, offensichtlich eine Sonderbehandlung an. Sie hatte heute gar nichts einzuwenden gegen ein paar Privilegien.
Mit einem Paternoster fuhren sie in den dritten Stock. Auf jeder Ebene das gleiche Bild: Stühle und Tische, wie aus dem Frühstücksraum des FDGB-Ferienheims »Wilhelm Pieck«, an den Wänden farbig lackierte Metallspinde, an den Tischen Paare, die ernst aufeinander einredeten, vor sich mehr oder weniger dicke Aktenmappen. Auf der ersten Etage saßen zwei, auf der zweiten ebenfalls zwei und auf der dritten Etage vier Paare. Anne wurde mulmig bei diesem Anblick. Fanden sie hier statt, die Enthüllungen, mitten in aller Öffentlichkeit? Wurden hier die Menschen mit einer Wahrheit konfrontiert, für die wahrscheinlich niemand dankbar war? Oder waren das etwa die »Täter-Opfer-Gespräche«, von denen sie gehört hatte, die Begegnung der Spitzel mit den Ausgespitzelten? Anne schwor sich, daß sie sich auf diesen Beichten-und-verzeihen-Schmus nie einlassen würde. Sie hatte sich mit einem Spitzel nichts zu sagen.
Im dritten Stock verließen sie den Paternoster. Frau Fisch sprang mit Eleganz, Anne nicht ganz so geübt aus dem Holzkasten. Auch zwei Jahre nach der Wende roch es noch nach Lysol im ehemaligen Hauptquartier der Stasi. Im dritten Stock befand sich der Übergang in ein anderes Gebäude, ins Haus 8, ins eigentliche Archivgebäude. Frau Fisch ging voraus durch einen langen Gang, dann mußten sie wieder hinunter, durch ein Treppenhaus, in den Keller.
»Das MfS hat erst Mitte der achtziger Jahre mit dem Bau dieses Komplexes begonnen«, erläuterte Frau Fisch. »Alles sollte auf die Bedürfnisse von ›Horch und Guck‹ zugeschnitten sein.«
»Sieht nicht so aus, als ob sie fertig geworden wären«, kommentierte Anne den provisorischen Zustand des Treppenhauses.
»Nein.« Frau Fisch sperrte die Tür zum Keller auf. »Hier, im sogenannten ›Kupferkessel‹, sollte die gesamte Elektronik abhör- und anpeilsicher untergebracht werden – deshalb ist alles nahtlos mit Kupferblech ausgeschlagen.« Auch daraus war nichts mehr geworden. Statt dessen war das riesige Kellergewölbe zur Gruft der Stasi geworden – zur Lagerstätte für das papiergewordene Schicksal von Menschen. Anne fand den Anblick der Unmengen von mehlsackgroßen Papierbeuteln, die hier gestapelt waren, beklemmend.
»Ursprünglich waren es 17 200 Säcke, jetzt sind es noch etwa 5 800«, kommentierte ihre Begleiterin lakonisch. »MfS-Mitarbeiter haben nach der Wende alle Vorgänge hier heruntergeschafft, die man vernichten wollte. Als die Bürgerkomitees die Normannenstraße im Januar 1990 besetzten, fanden sie mehr als hundert durchgebrannte Reißwölfe, die diesem Ansturm nicht standgehalten haben. Viele Akten sind von MfS-Offizieren mit der Hand zerrissen worden.«
»Kann man denn daraus noch irgend etwas rekonstruieren?« fragte Anne ungläubig.
»Es sind schon viele Schicksale aus den Säcken wieder emporgestiegen«, sagte Frau Fisch mit Genugtuung und ging voran ins Nebengelaß.
Annes Akte hatte sich hier, im sogenannten »Arbeitsmagazin«, gefunden. Hier wurden Unterlagen aufbewahrt, die zwar unzerstört, aber nicht geordnet waren. Anne starrte sprachlos auf die langen Regalreihen, in denen sich Papierstapel häuften, zerknittert und vergilbt, dazwischen Aktentaschen, Kleidungsstücke, Buchstützen.
»Die Mitglieder der Bürgerkomitees haben zunächst die Büros leer geräumt, alles, was sich dort fand, in Bündel zusammengefaßt und mit Hinweisen auf Inhalt und Fundort versehen.« Ihre Begleiterin, dachte Anne, hatte das sicher schon Hunderte von Malen erzählt. Wißbegierigen Besuchern ebenso wie prominenten Opfern des Spionagegroßbetriebs der DDR. Anne fühlte die unbändige Lust in sich aufsteigen, diesen unwirklichen Ort mit seinem Geruch nach Staub, zersetztem Papier, Reinigungsmittel und Angst fluchtartig zu verlassen.
»Deshalb liegt hier alles mögliche: wirklich wichtige Unterlagen über aktuelle Vorgänge ebenso wie Propagandaschriften oder Westzeitschriften. Die Klassiker des Marxismus-Leninismus, Parteiauszeichnungen, Speisekarten. Orden. Fotos von Erich Mielke. Wir haben erst einen Bruchteil dieses Materials gesichtet. Sie hatten Glück.«
Annes »Vorgang« war schon früh in die Hände eines Archivars gelangt. Und der hatte sofort begriffen, was er da vor sich hatte.
»War das wirklich Glück?« fragte Anne mit schmalen Lippen.
Frau Fisch seufzte. »Wie man’s nimmt«, sagte sie. »Ich weiß.«
Erst in der »Traditionskammer der Abteilung XX« fand Anne ihren Humor wieder. Es war alles so verdammt spießig: die Banner und Parolen der »Tschekisten«; die Blechteller, mit denen sich die Spitzel im Namen ihres Schutzheiligen Feliks Dzierzynski – nach der Oktoberrevolution Gründer der Tscheka, der sowjetischen Staatssicherheitsorganisation – zu heldenhaftem Tun beglückwünschten; die Erfolgsmeldungen über den jeweiligen aktuellen Stand der Unterdrückung der Freiheit des eigenen Volkes; die ganzen traurigen Abzeichen eines kleinbürgerlichen Bürokratenstaates.
Das mußte, dachte Anne, das Allerschlimmste sein für ehemalige DDR-Bürger: die Erkenntnis, daß man nicht von einer unüberwindlichen, herrischen Macht unterdrückt worden war, sondern von einer Zusammenrottung vergreister Knaben, die mit ihren Untertanen Räuber & Gendarm spielten.
»Ist das nicht alles furchtbar lächerlich?« fragte sie ihre Begleiterin.
»Ja«, nickte Frau Fisch. »Furchtbar ist das alles.«
Der Karteiraum im dritten Stock von Haus 8 war die letzte Station der Führung, mit der Frau Fisch offenbar das Unvermeidliche hinauszögern wollte. Anne spürte, wie unruhig sie mittlerweile war. Mit Erstaunen bemerkte sie am Schwarzen Brett einen Aushang, der ihren Besuch ankündigte. Trotzdem wurde sie von keiner der vielen älteren Frauen beachtet, die an kleinen Tischen saßen oder an den Karteischränken standen.
»Das Ordnungssystem der Stasi war verblüffend einfach und verblüffend wirkungsvoll«, erklärte die Fisch. »Die zentrale Kartei ›F 16‹ enthält sechs Millionen Namen – Klarnamen, von Bespitzelten und Verfolgten ebenso wie von Spitzeln und Verfolgern. Ohne die Registriernummer, die oben rechts auf jeder Karte steht, ist mit dieser Kartei nichts anzufangen. Erst auf der Karte, die unter dieser Registriernummer in wieder einer anderen Kartei abgelegt ist, in der Kartei ›F 22‹, sind Informationen darüber enthalten, ob die betreffende Person Opfer oder Täter war, wer sie ›bearbeitet‹ oder ›geführt‹ hat, ob der Vorgang bereits abgeschlossen oder noch aktuell war.«
Gut ausgedacht: So schützte die Stasi ihre eigenen Mitarbeiter vor allzuviel Wissen: Wer den »Klarnamen« kannte, wußte damit nicht, ob Freund oder Feind dahinterstand. Und wer nur die Registriernummer erhalten hatte, konnte daraus den »Klarnamen« nicht rekonstruieren.
Anne stand ungläubig vor den Reihen von Karteikästen, diesen fortschrittlich-sozialistischen Verkörperungen bürokratischer Sammel- und Ordnungswut. »Aber ich liebe euch doch alle!« hatte Erich Mielke gesagt, der ehemalige Minister für Staatssicherheit der DDR, der Chef dieser ganzen Abstrusität. Das, dachte Anne bitter, mußte wohl das Problem gewesen sein.
»Ich bin jetzt soweit«, sagte sie zu Frau Fisch.
»Muß ich mir«, fragte Anne, als beide den langen Verbindungsgang zwischen Haus 8 und Haus 7 durchschritten hatten und wieder in den Paternoster stiegen, »den ganzen Krempel vor den Augen sämtlicher Paternosterfahrer angucken, die heute Lust aufs Paternosterfahren haben?« Im Flurraum auf der dritten Etage saßen jetzt nur noch zwei Paare über ihre Papiere gebeugt.
»Keine Sorge. Sie können nachher allein und ungestört im Lesesaal Platz nehmen«, antwortete die Fisch leise, »hier findet nur das Vorgespräch statt.« In der zweiten Etage stiegen sie aus.
Anne glaubte, so etwas wie Mitleid im Gesicht ihrer Begleiterin erkannt zu haben. Verdammt, fuhr es ihr durch den Kopf, ist es so schlimm?
Sie setzte sich an einen der freien Tische. Frau Fisch kam bald zurück. Sie balancierte vier blaue Aktenmappen. Anne hob fragend die Augenbrauen. Die Sachbearbeiterin legte den Stapel behutsam auf den Tisch.
»Das ist meine Akte?« Daß es soviel Material über sie gab, hätte sie nicht geglaubt.
»Um Himmels willen! Das ist nur ein kleiner Bruchteil davon!« sagte Frau Fisch.
»Und auch davon dürfen Sie nicht alles lesen. Es mag Ihnen ja absurd erscheinen«, versuchte sie den umständlichen Vorgang zu erklären, »aber aus datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir dafür sorgen, daß die Anonymität anderer in den Akten auftauchender Personen gewahrt bleibt.« Deshalb waren einige Stellen eingeschwärzt oder ganze Blätter mit einem gelben Papierbogen abgedeckt, der mit drei großen Büroklammern befestigt war. »Schauen Sie bitte nicht darunter«, sagte die Fisch und breitete um Verständnis bittend die Hände aus. »Das sind nun mal die Vorschriften.«
In Hinblick auf datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit hatte die Sachbearbeiterin jedes Blatt, jeden Satz von Annes Akte gelesen und überprüft. Sie wird mich nicht mehr angucken vor Scham, dachte Ilona Fisch flüchtig, wenn sie weiß, was ich weiß.
»Sie brauchen keine Namen«, flüsterte Frau Fisch ihr zu, »um zu erkennen, wer Sie verraten hat.« Sie stand abrupt auf. Und legte ihre Hand auf Annes Arm. »Nehmen Sie’s nicht so schwer.«
Als Anne mit ihrem Papierstapel den eigentlichen Leseraum betrat, saß ihr das beunruhigende Gefühl in der Magengrube, daß es einen verdammt guten Grund geben mußte, warum eine wildfremde Frau Mitleid mit ihr hatte.
Im Lesesaal saßen schon andere, das gesenkte Haupt über Papierstöße gebeugt, über deren datenschutzmäßige Unversehrtheit eine etwas erhaben sitzende Lesesaalaufsichtsdame wachte. Anne fühlte sich klein und hilflos.
Nach einer Viertelstunde wußte sie, warum Frau Fisch sie mitleidig angesehen hatte. Nach einer weiteren Viertelstunde kämpfte Anne mit Atemnot. Und nach wieder einer halben Stunde wurde ihr vor Scham so heiß, daß sie den plötzlich ganz milde guckenden Zerberus von der Lesesaalaufsicht bitten mußte, ein Fenster zu öffnen. Die Frau hatte wahrscheinlich schon viel gesehen, dachte Anne, als sie sich wieder etwas beruhigt hatte. Haareraufende, ungläubig »Das glaub ich nicht!« ausstoßende, verzweifelte, hysterische, weinende ehemalige Objekte der Observation – Opfer ihrer Freunde, Kollegen und Verwandten. Eine um Luft ringende westdeutsche Politikerin, die aus den Akten entnehmen mußte, was ihr ja vielleicht hätte auffallen dürfen, nämlich, daß ihr Mann sie jahrelang bespitzelt hatte – das, sagte sich Anne bitter, war wahrscheinlich noch nicht einmal etwas Besonderes.
Sie guckte sich um. Vorn am Fenster saß ein grauhaariger Mann, zusammengesunken, die Hände vors Gesicht geschlagen. War’s die Ehefrau? Der Bruder? Rechts von ihr blickte ein jüngerer Mann ins Leere, er mußte so alt sein wie sie. Anne senkte die Augen, als sie sein versteinertes Gesicht sah. Niemand, dachte sie, sollte uns so sehen dürfen. So hilflos, so hintergangen, so betrogen.
So dumm, fügte sie wütend hinzu.
Leo hatte sie auf Weisung geliebt. »Es ist daran gedacht, eine echte Liebesbeziehung zu der B. herzustellen«, hieß es im entsprechenden Bericht mit entwaffnender Logik. Anne hätte beinahe laut aufgelacht. Und daß er sich später zum »Wechsel des Operationsgebietes ins nichtsozialistische Ausland« bereit erklärte, hatte ihm eine Geldprämie und einen Orden eingetragen. Bravo, Leo, dachte Anne sarkastisch. Mutig von dir.
Es waren die Details, die wirklich weh taten. Die kleinen bürokratischen Nadelstiche. Die Quittungen, die Leo eingereicht hatte – wg. Kostenerstattung. Für Blumen (die er ihr geschenkt hatte). Für das Essen und die Flasche Wein, zu denen er sie ins »Jade« im Ostberliner Palasthotel eingeladen hatte. Sie hatte sich damals gewundert, daß er so schnell einen Tisch bekommen hatte. Der normale Ostbürger mußte darauf drei Wochen warten. Nur für Westdeutsche – und die Stasi – gab es ein festes Kontingent.
Und schließlich der Beleg für den Anzug, den er kaufte, als er bereits im Westen war. Den er auf dem Standesamt trug. Als sie heirateten. »Ich bekräftige hiermit, daß die angeführten Kosten im Rahmen einer notwendigen dienstlichen Maßnahme eingetreten sind.« Gezeichnet: Caruso.
»Den Decknamen ›Caruso‹ hat er sich selbst gegeben. Sehr passend, nicht? Der sang bekanntlich«, sagte Anne voll bitterem Sarkasmus, als Kosinski den zweiten Aktendeckel zugeklappt hatte. Ihm reichte, was er beim Durchblättern gelesen hatte.
»Die Liebesaffäre mit Leo war eine regelrechte Staatsaktion. Von Anfang an. Bis zur Wende. Leo war auf mich ›angesetzt‹, ich sollte systematisch ›abgeschöpft‹ werden. Und ich müßte mich heute wohl geschmeichelt fühlen, für wie wichtig die mich hielten.« Das Projekt »Blondie« war überaus langfristig angelegt gewesen. Man hatte in Ostberlin darauf gesetzt, daß ihre politische Karriere sie in späteren Jahren zu einer unschätzbaren Quelle machen würde. Wer hatte schon mit der Wende gerechnet?
Anne war aufgestanden und lief unruhig durch den Raum. »Er hat alles erfaßt und weitergegeben. Und kommentiert: Meine beruflichen Kontakte. Meine Zukunftsvorstellungen. Meine Ansichten. Meine Freunde. Meine Lebensgewohnheiten.«
»Zusammenfassend muß eingeschätzt werden«, hatte der IM Caruso zu Anfang ihrer »echten Liebesbeziehung« notiert, »daß es sich bei der B. um ein charakterlich und politisch schwaches Element handelt, das negativ und feindlich eingestellt ist. Ihr Lebensstil grenzt an Asozialität. Sie hat ein uneheliches Kind, unterhält mit mehreren männlichen Personen intime Beziehungen und neigt auch stark dem Alkohol zu.« Das ist doch alles gar nicht wahr! hatte es in ihr bei der Lektüre aufgeschrien. An dieser – und an anderen Stellen. Heute wußte sie: Wer sich gegen die Perfidie auch noch verteidigen wollte, saß schon in der Falle.
»Auch den Namen für den ›operativen Vorgang‹ hat Leo erfunden – ›Blondie‹. Eine besonders hübsche Beleidigung.«
Sie setzte sich wieder aufs große Sofa dem Kommissar gegenüber. Als ob er gespürt hätte, daß sie Trost brauchte, sprang der dicke Kater Boris mit weichen Pfoten neben sie und schmiegte sich an ihr Knie. Kosinski sah sie aus seinen großen grauen Augen freundlich an. Nein, jetzt bloß kein Mitleid, dachte sie und schob den Kater ungeduldig weg.
Kosinski spürte ihre Abwehr. »Warum haben Sie Kiel verlassen, statt Ihren kleinen Spitzel einfach rauszuschmeißen?« fragte er sachlich.
Anne zuckte müde die Achseln. »Es wäre irgendwann aufgeflogen.«
»Aussitzen! Das hat sich als Methode doch bewährt!«
Anne wußte, an wen er dachte. Sie hatte tatsächlich eine Zeitlang geglaubt, die Sache erhobenen Hauptes durchstehen zu können. Sie war heute froh, daß sie es gar nicht erst versucht hatte. Täter können so etwas aussitzen. Aber nicht ihre Opfer.
Sie schüttelte den Kopf. »Opfer halten wir hierzulande für schwach. Sie haben sich täuschen lassen, sie haben sich ›hergegeben‹, sie waren dumm genug, sich hintergehen zu lassen. Was würde man wohl von einer Politikerin halten, die von ihrem eigenen Ehemann nach Strich und Faden belogen und betrogen worden ist?«
»Wenn sie das schon nicht mitgekriegt hat ...«
»Genau. Die Täter haben sich ihrer Aufgabe gewachsen gezeigt. Die Opfer waren dämlich.« Anne spürte wieder den galligen Geschmack im Mund, den sie wohl immer mit dem Tag verbinden würde, an dem sie im ehemaligen Stasi-Haupt quartier Zwangsabschied von einer Lebenslüge genommen hatte.
»Tut’s weh?« fragte Kosinski leise. Die Verzweiflung in Anne Buraus Gesicht bewegte sogar ihn. Trauer sah er ihr an, Scham. Und Schuldgefühle. Wieso fühlte sie sich schuldig?
»Wenn es ja nur um mich gegangen wäre«, sagte Anne und schluckte mit trockener Kehle. »Mir hat er ja nicht geschadet.«
Meinte sie das ernst? Kosinski zweifelte an ihrem Verstand.
»Aber all den anderen: Einige sind in den Knast gewandert. Andere sind ausgewiesen worden. Und unzählig viele haben sie schikaniert, terrorisiert, eingeschüchtert. Aufgrund von Informationen des IM Caruso.«
Für einen Fall von besonders eklatantem Verrat hatte Leo sogar eine Extraprämie gekriegt. »Blutgeld«, dachte Anne voller Ekel.
»Eine Freundin von ihm hat sich in Bautzen erhängt. Im ›Gelben Elend‹, in einem der übelsten Knäste der DDR.« Anne erinnerte sich gut an Ellen Leinemann, die schöne schwarzhaarige Frau mit dem schnellen Witz, die auf keiner Szeneparty in Ostberlin fehlte. Sie war zu fünf Jahren verurteilt worden – wegen versuchter Republikflucht. »Verpfiffen hat sie Leo Matern. Ihr Vertrauter, wie sie glaubte. Ihr Exliebhaber. Ihr guter Freund.«
Anne sah den Kommissar gequält an. »Warum habe ich davon nichts gemerkt? Es hätte mir doch auffallen müssen!«
Kosinski spielte mit der leeren Zigarettenschachtel und seufzte. »Und was hätte das geändert?«
Anne sah ihn an. »Nichts«, sagte sie tonlos.
Alles.
Draußen regnete es nicht mehr. Dafür jagte ein böiger Wind über den Hof. Mit einem Krachen schlug die Haustür zu, flog die Tür zur Bibliothek auf. Der jähe Luftzug drohte die Papiere zwischen den Aktendeckeln vom Tisch zu wehen. Geistesgegenwärtig stellte Kosinski den schweren Aschenbecher auf den Stapel. Kater Boris sprang vom Sofa und machte mit gesträubtem Fell einen Buckel.
»Komm, schnell!« rief Krysztof mit hektischen roten Flekken im Gesicht.
»Was ist los, Krysztof., fragte Anne, voller Vorahnungen. Der Kommissar war schon aufgesprungen.
»Komm«, sagte der polnische Landarbeiter, fast flehend. Auf dem Weg hinaus schlüpfte Anne in die Gummistiefel neben der Haustür und griff sich die Jacke vom Haken. Krysztof lief zum großen Pferdestall, wo die Pferde standen, wenn sie nicht auf der Koppel waren: die Tiere, die Anne zur Miete bei sich untergestellt hatte. Und ihre eigenen. Killroy, der Palomino. Bucephalus. Ihm war nichts passiert, stellte Anne mit Erleichterung fest, als sie im Mittelgang des großen Stalls angekommen waren. Aus der dritten Box links blickte sein schöner großer Kopf neugierig in ihre Richtung, er hatte die Ohren aufgestellt und grummelte leise. Vor Bucephalus machte Krysztof halt.
Hinter dem Pferd, in der rechten äußersten Ecke der Box, saß Rena. Auf ihrem Schoß hielt sie den Kopf von Alexander. Der Junge lag ausgestreckt im Stroh, in einer vertraulichen, ja intimen Pose, und ließ sich von Rena über die Haare streichen. Anne war sprachlos. Und fühlte fast so etwas wie Ärger in sich hochsteigen. Vorhin noch wäre sie erleichtert gewesen, wenn sie gewußt hätte, daß Rena mit Alexander die Nacht verbracht hatte. Jetzt fand sie die romantische Pose der beiden – »im Stall, um Himmels willen« – etwas, na ja, deplaziert. Als sie die Augen von dem jungen Mann hob und in Renas Gesicht sah, verflog ihr Ärger. Das Mädchen starrte apathisch und mit verweinten Augen vor sich hin.
Kosinski schien sofort zu wissen, was los war, ging am hilflosen Krysztof vorbei zum Stall, schob sanft, aber bestimmt den neugierigen Bucephalus zur Seite und kniete sich neben Alexander aufs Stroh. Er fühlte dem Jungen den Puls, erst am Handgelenk, dann am Hals, hob ein Lid der geöffneten Augen an und griff nach Renas Hand, die sie ihm lethargisch überließ. Jetzt sah auch Anne die leblosen Augen und das Blut, das eine schmale Spur neben dem linken Mundwinkel Alexanders hinterlassen hatte. Der Junge war tot.
»Wann?« fragte Kosinski. Rena schüttelte benommen den Kopf und leckte sich über die trockenen Lippen, deren zarte Haut aufgeplatzt war. »Weiß nicht«, flüsterte sie.
»Wann hast du ihn gefunden?«
Rena schluckte. »Um elf. Gestern abend.«
Anne wurde es heiß vor Mitgefühl. Das Kind mußte die ganze Nacht hier verbracht haben, mit einem Toten auf dem Schoß.
»Warst du die ganze Zeit bei ihm?« fragte der Kommissar, ohne ihre Hand loszulassen. Anne sah, daß er seinen Daumen auf ihr Handgelenk gelegt hatte und auf seine Armbanduhr schaute.
Rena schüttelte den Kopf. »Ich habe Angst gekriegt«, flüsterte sie, »heute morgen. Und bin nach Hause gegangen.« Aber dann war sie wieder zu dem Toten zurückgekehrt. »Ich konnte ihn doch nicht allein hier liegen lassen«, sagte sie mit halberstickter Stimme.
Kosinski legte eine Hand unter Alexanders Hinterkopf, hob ihn ein wenig an und drehte den Kopf vorsichtig auf die Seite.
»Nein«, protestierte Rena heiser. Sie mußte die ganze Nacht über geweint haben.
Anne hielt sich nur mit Mühe zurück. Sie wollte zu ihrem Kind. Was Kosinski sah, sah auch sie: Das Haar des Jungen war blutverschmiert, der Schädel oberhalb des linken Ohrs deformiert, eingedrückt.
Kosinski blickte zu ihr hoch. »Einwirkung durch einen stumpfen Gegenstand«, sagte er. »Das könnte auch ein Pferdehuf gewesen sein.«
Anne fühlte, wie ihr das Blut aus dem Kopf wich. War das sonst so umgängliche Pferd durchgedreht?
»Bucephalus? Muß er jetzt erschossen werden?« fragte Rena mit ganz kleiner, verzagter Stimme.
»Nein!. Diesmal protestierte Anne. Andererseits: Wenn es so war ... Sie blickte hilfesuchend auf Kosinski, der aufstand und sich das Stroh von der Hose klopfte.
»Wir sollten keine vorschnellen Schlüsse ziehen«, sagte er und tätschelte den Hals des Pferdes, bevor er die Hand nach Rena ausstreckte. »Wir sollten alles weitere der Spurensicherung und dem Gerichtsmediziner überlassen.«
»Komm, Rena«, sagte Anne leise und ging auf sie zu. »Du kannst ihm nicht mehr helfen.« Das Mädchen legte Alexanders Kopf aufs Stroh und strich ihm noch einmal über die Stirn. Mit einem Schluchzen zog sie sich am Balken hoch. Sie konnte kaum stehen, die Beine waren ihr eingeschlafen. Anne und Kosinski nahmen sie in die Mitte auf dem Weg zum Haus. Anne brachte ihre erschöpfte Tochter ins Bett und blieb neben ihr sitzen, bis der Arzt kam. Ich weiß, wie well das tut, dachte sie. Aber sie wußte, daß ihre Tochter ihr das niemals glauben würde. Anne hatte ihrer Mutter schließlich auch nicht geglaubt.
Krysztof war im Stall geblieben. Er führte den Hengst aus der Box, in der Alexander lag, in eine andere, wo er ihm die Raufe füllte. Der Pole kratzte sich den Schädel und betrachtete kopfschüttelnd das große Tier, das seelenruhig sein Futter malmte. »Killer?« fragte er leise. Butz schnaubte, schüttelte den Kopf und fraß weiter.
Man hatte den Leichnam mitgenommen. Rena schlief. Auch Kosinski hatte sich verabschiedet. »Morgen«, sagte er beim Abschied, »müssen wir noch einmal reden.« Anne hatte genickt. Merkwürdigerweise traute sie ihm. Warum auch nicht? sagte sie sich bitter. Irgendeinem Mann mußt du ja mal trauen. »Und mit Staatsangestellten«, fügte eine kleine Stimme höhnisch hinzu, »kennst du dich ja aus.«
Die Stille im Haus legte sich über sie wie betäubender, erstickender Dunst. Sie fühlte sich plötzlich unendlich allein. »Und wenn du es einfach noch einmal versuchst?« forderte sie sich auf und ging zum Telefon. »Vielleicht kann man ja auch anderen Männern trauen.« Zweimal ließ sie das Telefon endlos lange klingeln bei ihm, stellte sich vor, wie er vom Garten her ins Haus lief und sich noch schnell die Hände wusch, bevor er den Hörer aufnahm. Oder wie er gerade von einer Radtour zurückkam, völlig verschwitzt, sein Rad an den Gartenzaun lehnte, den Haustürschlüssel hervorkramte, aufschloß, zum Telefon rannte.
Paul Bremer antwortete nicht. Anne legte sanft den Hörer auf und zuckte mit den Schultern. Zu spät, dachte sie. Und: Schade.