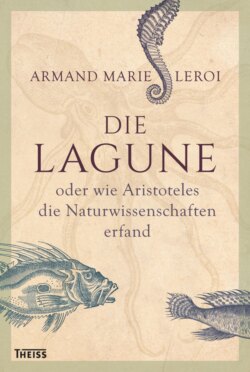Читать книгу Die Lagune - Armand Marie Leroi - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеDas Gelände, das als Lyzeum bekannt war, lag direkt hinter Athens Steinmauern. Das Heiligtum, Apollon Lykeios gewidmet, dem Apollo der Wölfe, umfasste unter anderem ein militärisches Trainingsgelände, eine Rennbahn, mehrere Schreine und einen Park. Die Topografie ist nicht eindeutig. Strabo bleibt vage, Pausanias ist noch schlimmer und außerdem schrieb der eine darüber zwanzig Jahre, der andere zwei Jahrhunderte, nachdem der römische General Sulla den Ort dem Erdboden gleichgemacht hatte. Sulla hatte auch die alten Platanen abgehackt, die seine mäandernden Wege säumten, und Belagerungsgeräte aus ihrem Holz gezimmert. Als Cicero 97 v. Chr. den Ort besuchte, fand er nur ein Ödland vor. Sein Besuch war eine Hommage an Aristoteles, der hier über 200 Jahre zuvor einige Gebäude gemietet und seine Schule eröffnet hatte. Es hieß, dass Aristoteles gern auf den schattigen Wegen des Lyzeums wandelte und dabei redete.
Er redete über die geeignete Grundordnung der Stadt: über die Gefahren der Tyrannei – und auch über die der Demokratie. Und darüber, wie die Tragödie durch Mitgefühl und Furcht eine reinigende Wirkung ausübt. Er analysierte die Bedeutung des Guten, to agathon, und sprach davon, wie der Mensch sein Leben verbringen sollte. Er gab seinen Schülern logische Rätsel zu lösen und verlangte dann, dass sie das Wesen der fundamentalen Realität neu überdenken sollten. Er redete in knappen Syllogismen und illustrierte ihre Bedeutung mit endlosen Listen von Dingen. Er begann seine Lektionen mit den abstraktesten Prinzipien und ging stundenlang ihren Konsequenzen nach, bis wieder ein Teil der Welt seziert und erklärt vor ihnen lag. Er erörterte die Gedanken seiner Vorgänger – die Namen Empedokles, Demokrit. Sokrates und Plato trug er ständig auf den Lippen – manchmal mit widerwilliger Anerkennung, häufig mit Verachtung. Er reduzierte die chaotische Welt auf eine Ordnung, denn wenn Aristoteles eins war, dann ein Systematiker.
Seine Schüler sahen voller Ehrfurcht zu ihm auf und vielleicht auch mit etwas echter Furcht. Einige seiner Aussprüche legen eine spitze Zunge nahe: »Die Wurzeln der Erziehung sind bitter, aber die Frucht ist süß.« – »Gebildete Menschen sind den ungebildeten genauso überlegen wie die Lebenden den Toten.« Über einen konkurrierenden Philosophen sagte er: »Es wäre eine Schande für mich, still zu sein, solange Xenokrates noch spricht.« Es gibt auch eine Beschreibung von ihm, und keine besonders sympathische. Er sei ein Dandy gewesen, der eine Menge Ringe trug, sich etwas zu sorgfältig kleidete und viel Aufhebens um seine Frisur machte. Auf die Frage, warum die Menschen Schönheit in anderen suchen, antwortete er: »Das ist eine Frage, die nur ein Blinder stellen würde.« Es heißt, er hätte dünne Beine und kleine Augen gehabt.
Vielleicht ist das alles nur Klatsch – die Athener Schulen befehdeten sich unaufhörlich und die Biografen sind unzuverlässig. Aber wir wissen, worüber Aristoteles sprach, denn wir haben seine Vorlesungsskripte. Darunter befinden sich auch die Arbeiten, die wie ein Gebirge über der Geschichte der westlichen Gedankenschule aufragen: Kategorien, De interpretatione, Analytica priora, Analytica posteriora, Topik, Sophistische Widerlegungen, Metaphysik, Eudemische und Nikomachische Ethik, Poetik, Politik. Diese Bücher, manchmal klar und didaktisch. oft undurchsichtig und rätselhaft, von Lücken durchsetzt und voller Redundanzen, haben Aristoteles’ Namen unsterblich gemacht. Dass wir sie haben, verdanken wir Sulla, der die Bibliothek eines Bibliophilen in Piräus plünderte und nach Rom brachte. Aber diese philosophischen Texte sind nur ein Teil – und nicht einmal der wichtigste Teil – von Aristoteles’ Werk. Unter den Büchern, die Sulla stahl, befanden sich mindestens neun, in denen es nur um Tiere ging.
Aristoteles war ein intellektueller Allesfresser, ein Nimmersatt, wenn es um Informationen und Konzepte ging. Aber das Thema, das ihm am meisten am Herzen lag, war die Biologie. In seinen Arbeiten wird das »Studium der Natur« lebendig, wenn er die Pflanzen und Tiere beschreibt, die in all ihrer Vielfalt unsere Welt bevölkern.[∗] Sicher, es hatten sich schon manche Philosophen und Ärzte vor ihm in der Biologie versucht. Aber Aristoteles widmete ihr einen großen Teil seines Lebens. Er war der Erste, der das tat. Er kartierte das Gelände. Er erfand diese Wissenschaft. Man könnte sogar behaupten, er erfand die Wissenschaft an sich.
Im Lyzeum gab er einen umfassenden Kurs zur Naturwissenschaft. In der Einleitung zu einem seiner Bücher wird das Curriculum skizziert: zuerst eine abstrakte Darstellung der Natur, dann die Bewegung der Sterne, dann in rascher Folge Chemie, Meteorologie und Geologie und dann der größte Teil, eine Darstellung des Lebendigen – der Lebewesen, die er kannte, darunter wir. Seine zoologischen Arbeiten sind die Notizen für diesen Teil des Kurses. In einem Buch beschäftigte er sich mit dem, was wir vergleichende Zoologie nennen, in einem anderen mit funktioneller Anatomie, in zweien ging es darum, wie sich Tiere bewegen, in einem, wie sie atmen, zwei beschäftigten sich damit, warum sie sterben, und eins mit den Systemen, die sie am Leben halten. Eine Reihe von Vorlesungen drehte sich darum, wie Lebewesen sich im Mutterleib entwickeln und heranwachsen, sich fortpflanzen und den Vorgang erneut in Gang setzen – denn auch darüber schrieb er ein Buch. Es gab auch einige Bücher zu Pflanzen, aber wir kennen ihren Inhalt nicht. Sie gingen zusammen mit rund zwei Dritteln seiner Arbeiten verloren.
Die Bücher, die wir haben, sind für Naturforscher ein reines Vergnügen. Viele der Lebewesen, über die er schreibt, leben im oder am Meer. Er beschreibt die Anatomie von Seeigeln, Seescheiden und Schnecken. Er betrachtet Sumpfvögel und beschreibt ihre Schnäbel, Beine und Füße. Delfine faszinieren ihn, weil sie Luft atmen und ihre Jungen säugen, aber dennoch aussehen wie Fische. Er erwähnt mehr als hundert verschiedene Fischarten und zählt auf, wie sie aussehen, was sie fressen, wie sie sich fortpflanzen, welche Geräusche sie von sich geben und welche Wege sie auf ihren Wanderungen zurücklegen. Sein Lieblingstier war ein merkwürdig intelligenter Wirbelloser: der Tintenfisch. Der Dandy muss also Fischmärkte geplündert und an Anlegeplätzen mit Fischern geplaudert haben.
Doch der größte Teil von Aristoteles’ Wissenschaft ist ganz und gar nicht beschreibend, sondern besteht aus Antworten auf Hunderte von Fragen. Warum haben Fische Kiemen und keine Lungen? Flossen, aber keine Beine? Warum haben Tauben einen Kropf und Elefanten einen Rüssel? Warum legen Adler so wenige Eier, Fische so viele, warum sind Sperlinge so lüstern? Wie ist das überhaupt mit den Bienen? Und dem Kamel? Warum geht nur der Mensch aufrecht? Wie sehen, riechen, hören, fühlen wir? Wie beeinflusst die Umgebung das Wachstum? Warum sehen Kinder manchmal aus wie ihre Eltern und manchmal nicht? Was ist der Zweck von Hoden, Menstruation, Scheidenflüssigkeit, Orgasmen? Was verursacht Missgeburten? Was ist der wahre Unterschied zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen? Wie bleiben Lebewesen am Leben? Warum vermehren sie sich? Warum sterben sie? Das ist kein zaghafter Streifzug in ein neues Gebiet, es ist eine vollständige Wissenschaft.
Vielleicht zu vollständig, denn manchmal scheint es, als hätte Aristoteles für alles eine Erklärung. Diogenes Laertios, der tratschende Biograf, der Aristoteles’ Aussehen beschrieb (fünf Jahrhunderte nach seinem Tod), schrieb: »Im Bereich der Naturwissenschaften übertraf er alle anderen Philosophen in der Untersuchung von Ursachen, selbst die unwichtigsten Phänomene wurden von ihm erklärt.« Seine Erklärungen durchdringen seine Philosophie. In gewisser Hinsicht ist seine Philosophie Biologie – wenn er nämlich seine Ontologie und Erkenntnistheorie nur entwickelt, um zu erklären, wie Tiere funktionieren. Man frage Aristoteles: Was existiert im Grunde genommen? Er würde nicht sagen, wie ein moderner Biologen es vielleicht tun würde: »Frag einen Physiker«, sondern er würde auf einen Tintenfisch zeigen und sagen: Das.
Die Wissenschaft, die Aristoteles begann, ist groß geworden, aber seine Nachkommen haben ihn so gut wie vergessen. In einigen Bezirken von London, Paris, New York und San Francisco kann man keinen Stein werfen, ohne einen Molekularbiologen zu treffen. Aber fragt man ihn dann, nachdem man ihn niedergestreckt hat, was Aristoteles getan hat, erntet man bestenfalls ein verwirrtes Stirnrunzeln. Doch Gesner, Aldrovandi, Vesalius, Fabricius, Redi, Leeuwenhoek, Harvey, Ray, Linné, Geoffroy Saint-Hilaire père et fils und Cuvier – um nur einige von vielen zu nennen – haben ihn gelesen. Sie nahmen die Struktur seiner Gedanken in sich auf. Und so wurden seine Gedanken zu unseren Gedanken, selbst wenn wir nichts davon wissen. Seine Konzepte fließen wie ein unterirdischer Fluss durch die Geschichte unserer Wissenschaft und treten hier und da als Quelle zutage als scheinbar neue Ideen, die jedoch tatsächlich schon sehr alt sind.[∗]
Dieses Buch ist eine Erforschung der Quelle: die großartigen wissenschaftlichen Arbeiten, die Aristoteles schrieb und am Lyzeum lehrte. Großartig, aber auch rätselhaft, weil die Bedingungen seiner Gedankenwelt selbst so weit von uns entfernt sind, dass sie schwer zu verstehen sind. Er muss übersetzt werden – nicht nur ins Deutsche, sondern in die Sprache der modernen Wissenschaft. Das ist natürlich ein gefährliches Unterfangen: Stets lauert die Gefahr, ihn falsch zu übersetzen, ihm Ideen zuzuschreiben, die er gar nicht gehabt haben kann.
Die Gefahr ist groß, wenn der Übersetzer ein Wissenschaftler ist. Wir geben im Allgemeinen schlechte Historiker ab. Uns fehlt die historische Veranlagung, die Vergangenheit in ihrer Eigenständigkeit zu begreifen. Weil wir so beschäftigt mit unseren eigenen Theorien sind, tendieren wir dazu, sie in allem wiederzuerkennen, was wir lesen. Der französische Wissenschaftshistoriker Georges Canguilhem formulierte es so: »Die Vereinbarung, Vorgänger zu suchen, zu finden und zu feiern, ist das deutlichste Symptom für einen Mangel an Begabung für die erkenntnistheoretische Kritik.« Der ad-hominem-Tonfall des Epigramms mag uns dazu verleiten, seine Wahrhaftigkeit zu bezweifeln. Es missachtet auch den Umstand, der jedem Wissenschaftler, wenn auch vielleicht nicht allen Historikern, geläufig ist, dass nämlich Wissenschaft tatsächlich kumulativ ist, dass wir wirklich Vorgänger haben und dass wir auch wissen sollten, wer sie waren und was sie wussten. Dennoch steckt ein Unbehagen verursachender Splitter Wahrheit darin.
All dies sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man dieses Buch liest. Doch ich will auch eine Verteidigung wagen, eine apologia des Wissenschaftlers, wenn man so will. Aristoteles’ großes Thema war die lebendige Welt in all ihrer Schönheit. Es scheint daher möglich, einen Gewinn daraus zu ziehen, wenn man ihn wie einen Biologen liest. Schließlich sind unsere Theorien nicht nur durch die Abstammung miteinander verknüpft, sondern auch durch die Tatsache, dass sie dieselben Phänomene zu erklären versuchen. Es könnte also tatsächlich sein, dass sie sich von unseren gar nicht so sehr unterscheiden.
Im 20. Jahrhundert begann eine Generation großer Gelehrter, Aristoteles’ biologische Arbeiten nicht als Naturgeschichte, sondern als Naturphilosophie zu untersuchen. David Balme (London), Allan Gotthelf (New Jersey), Wolfgang Kullmann (Freiburg), James Lennox (Pittsburgh), Geoffrey Lloyd (Cambridge) und Pierre Pellegrin (Paris) schenkten uns einen neuen, aufregenden Aristoteles. Ihre Entdeckungen tauchen auf jeder Seite dieses Buches auf (auch wenn jeder von ihnen mit einem Großteil des Buches nicht einverstanden sein wird oder gewesen wäre, nicht zuletzt, weil sie untereinander so häufig verschiedener Meinung waren). Daher beanspruche ich hier auch keine besondere Originalität. Ich stelle mir jedoch gern vor, dass ein Wissenschaftler, und sei es nur gelegentlich, in Aristoteles’ Schriften etwas sehen kann, das die Philologen und Philosophen übersehen haben.
Denn manchmal gehen seine Worte jedem Biologen direkt zu Herzen, wenn er uns zum Beispiel sagt, warum wir Lebewesen studieren sollten. Wir müssen ihn uns in den marmornen Säulengängen des Lyzeums vorstellen, wie er zu einer Gruppe aufsässiger Schüler spricht. Er deutet auf einen Haufen tintenfleckiger Tintenfische hin, die in der attischen Sonne verwesen. Sucht euch einen aus, sagt er, schneidet ihn auf, öffnet ihn, seht hin.
»…?«
Verzweifelt versucht er, es ihnen zu erklären:
Wir sollten nicht wie Kinder mit Abscheu auf die Untersuchung von weniger hohen Tieren reagieren. Es steckt etwas Ehrfurchtgebietendes in allen natürlichen Dingen. Man erzählt sich, dass Fremde einmal Heraklit sehen wollten. Sie kamen näher, sahen aber, dass er sich am Ofen wärmte. »Sorgt euch nicht!«, sprach er. »Kommt herein! Hier drinnen gibt es auch Götter.«Ähnlich sollte man sich der Forschung an Tieren jeder Art ohne Zögern nähern. Denn jedem wohnt etwas Natürliches und Schönes inne. Nichts ist zufällig in der Natur: Schlichtweg alles dient etwas anderem zu einem bestimmten Zweck. Der Zweck, aus dem jedes Ding entstanden ist oder entstehen wird, verdient seinen Platz unter dem, was schön ist.
Gelehrte nennen es »Die Einladung zur Biologie«.
sēpia – Gewöhnlicher Tintenfisch – Sepia officinalis
∗ Der traditionelle lateinische Titel. Auf Griechisch: Historiai peri ton zoon, auf Deutsch: Aristoteles Thierkunde (1868) bzw. Tierkunde (1957).
∗ Aristoteles’ Formulierung lautet historia tēs physeōs, wozu auch die Biologie zählt.
∗ »Man braucht die Lehren und Schriften der großen Meister des Altertums, eines Platon und Aristoteles, nicht zu kennen, man braucht ihre Namen nie gehört zu haben, und man steht darum doch nicht weniger im Bann ihrer Autorität.« – Theodor Gomperz (1911), Griechische Denker, Band 1, S. 422.