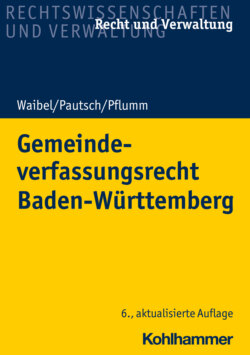Читать книгу Gemeindeverfassungsrecht Baden-Württemberg - Arne Pautsch - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.Reformen unter dem Liberalismus
Оглавление7Im 18. Jahrhundert entstanden dann erstmals Landes-, Polizei- und Commune-Ordnungen (z. B. die Württembergische Communeordnung von 1758 oder das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794). Diese Ordnungen schufen im Regelfall keine neuen Bestimmungen, sondern fassten das zurzeit geltende Recht zusammen. Sie enthielten überwiegend generelle Regelungen und Weisungen für das Verwaltungshandeln und gliederten zugleich die Städte und Landgemeinden in ein einheitliches staatliches Rechtssystem ein. Allerdings räumte die Württembergische Communeordnung den Gemeinden bereits das Recht ein, ihre Organe und Funktionsträger selbst zu wählen.
8Die Dorfgemeinden hatten als Ortsvorsteher einen selbst gewählten Schultheiß, die Amtsstädte einen staatlich bestellten Oberamtmann. Die Verwaltungsentscheidungen und die Rechtsprechung wurden von den im „Gericht“ zusammengefassten Ratsmitgliedern getroffen. Für die Vermögensverwaltung war der Bürgermeister zuständig. Die Amtsstädte wurden mit den Unterämtern (Gerichtsbezirken) und den Dorfgemeinden zu Kommunalverbänden mit der Bezeichnung „Stadt und Amt“ zusammengefasst, den Vorläufern der Oberämter und der späteren Landkreise.
9Die Französische Revolution und die Niederlage deutscher Fürsten gegen Napoleon ebneten dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts dem Liberalismus den Boden. Im Zusammenhang mit dem sich jetzt entwickelnden modernen Verfassungsrecht erhielt auch das Kommunalverfassungsrecht eine neue Ausprägung.
10Reichsfreiherr vom Stein brachte 1808 mit der „Preußischen Städteordnung“ den Städten die „bürgerliche Selbstregierung“. Die preußischen Städte hatten jetzt eine Doppelfunktion zu erfüllen: sie wurden Selbstverwaltungskörperschaften und dienten zugleich dem Staat als untere Verwaltungsbehörde.
11Einer Ausdehnung der Selbstverwaltung auf die Landgemeinden leisteten im norddeutschen Raum die Gutsherren erbitterten Widerstand. Am längsten dauerte dies in Preußen: hier wurde der Durchbruch erst im Jahr 1891 mit der Preußischen Landgemeindeordnung erzielt.
12Die süddeutsche Entwicklung war stark auf verwaltungstechnische Überlegungen ausgerichtet. Die Gemeinden wurden aber sowohl in der bayerischen als auch in der württembergischen Verfassung bereits 1818 bzw. 1819 als „Grundlage des Staatsvereins“ bezeichnet.
13Das württembergische „Verwaltungsedikt für die Gemeinden, Oberämter und Stiftungen“ von 1822 führte allgemein für alle württembergischen Gemeinden die Selbstverwaltung ein. Ähnliche Regelungen brachte das badische Gemeindegesetz von 1832 für die badischen Gemeinden. Die Gemeinden hatten das Recht, „alle auf den Gemeindeverband sich beziehenden Angelegenheiten zu besorgen, ihr Gemeindevermögen selbstständig zu verwalten und die Ortspolizei zu handhaben“. Dieser Katalog umfasste nicht nur die heute üblichen Aufgaben einer Gemeinde; es gehörten auch das Polizeiwesen und die Ordnungsverwaltung, die Armenfürsorge und das Gesundheitswesen, das Gewerberecht und die freiwillige Gerichtsbarkeit dazu. Die Rechtsprechung wurde jetzt allerdings staatlichen Behörden übertragen.
14Die Bürger wählten einen Gemeinderat als Beschlussorgan auf Lebenszeit und einen Bürgerausschuss zu dessen Überwachung. Vorsitzender des Gemeinderats und Vollzugsorgan war in allen Gemeinden und Städten ein auf Vorschlag der Bürgerschaft von der Regierung ernannter Ortsvorsteher (Schultheiß). Bestimmte Aufgabenbereiche der Gemeindeverwaltung waren dem Ratschreiber sowie dem Gemeindepfleger übertragen. Das Bürgerrecht war weder an Gewerbebetrieb noch an Grundbesitz gebunden, sondern an ein „selbstständig auf eigene Rechnung leben“. Damit wurde ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur „Einwohnergemeinde“ zurückgelegt.
Die Gemeinden besaßen das Recht, ihr Haushaltsdefizit (den sog. Communschaden) durch eine Umlage bei den Bürgern nach dem „Ortssteuerfuß“ auszugleichen.
15Der Bürgerausschuss wurde im Laufe der Zeit immer stärker und direkter an Verwaltungsentscheidungen und -aufgaben beteiligt. Dieses relativ schwerfällige Zweikammersystem wurde erst im Jahr 1919 mit der Einführung der Gemeinderatsverfassung (und damit dem Einkammersystem) geändert.
Die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts brachte den Städten wichtige neue Aufgaben auf dem Gebiet der Verwaltung und Versorgung und veränderte damit zwangsläufig die Struktur der Kommunalverfassungen.