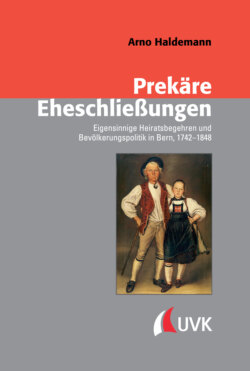Читать книгу Prekäre Eheschließungen - Arno Haldemann - Страница 14
Disziplinarische Konsequenzen des reformatorischen Eheverständnisses
ОглавлениеIn der Konsequenz avancierte die Ehe durch die Reformation zum exklusiven Ort sexueller Reinheit. Sie war von Zwingli und seinen Epigonen in der Eidgenossenschaft als göttliche Arznei gegen menschliche Sündhaftigkeit postuliert worden. Nur sie konnte die Menschen von der Sünde heilen.1 Fortan stellte sie also nicht mehr die inferiore Alternative zum Zölibat dar, sondern war in den reformierten Territorien zum allgemeingültigen Lebensmodell auserkoren worden. Durch das veränderte reformatorische Menschenbild konnten Zölibat und Enthaltsamkeit die Reinheit der sozialen Ordnung keinesfalls mehr garantieren. Das demonstrierten für die Reformatoren die Zustände im katholischen Klerus. Gesellschaftliche und sexuelle Reinheit und damit Ordnung konnten in reformierter Auffassung ausschließlich über die christliche Ehe hergestellt und garantiert werden.2
Mit dieser hybriden reformatorischen Ehekonzeption erfuhr das heterosexuelle eheliche Zusammenleben eine systematische Aufwertung und in der Folge intensive Aufmerksamkeit durch die protestantischen Obrigkeiten. Das Eheleben ihrer Untertanen wurde zum zentralen Ansatzpunkt ihrer Ordnungsanstrengungen. Die gottgefällige Eheführung mutierte unter den reformierten Ehetheologien zur grundlegenden Voraussetzung gesellschaftlicher Ordnung überhaupt.3 Nun oblag den reformierten Herrschaften im Hinblick auf die Ehe die Bewahrung der Reinheit des Gesellschaftskörpers als göttlicher Auftrag. Die Erfüllung ihres christlichen Herrschaftsauftrags erforderte folglich Mittel zur Herstellung und Überwachung sexueller und gesellschaftlicher Ordnung. Die erste Ordnung Gottes musste durchgesetzt und mit Argusaugen überwacht werden. Die Eheschließung und die Bewahrung ihrer Reinheit avancierten zum zentralen Maßstab für die Güte und Gottgefälligkeit christlicher Herrschaft4 und „obrigkeitlicher Moralpolitik“5. Darin war sogar die Kirche fortan der weltlichen Macht subordiniert, respektive Teil des obrigkeitlichen Verwaltungsapparats.6 Wiederholt ist von Historiker*innen ein Reglementierungsschub beobachtet worden, der von der Reformation ausging und neue Normen bezüglich der Trauungsinstitutionen evozierte. Die Gültigkeit der Ehe wurde im Nachgang der Reformation in gesteigertem Maß von obrigkeitlich vorgeschriebenen Formalitäten abhängig. Bedeutung und Verbindlichkeiten von lokalen Bräuchen und Gepflogenheiten traten diesen gegenüber zurück, so die These.7 Es ist von einer Zunahme der Formalisierung und Kodifizierung der Eheordnung die Rede. Die gesteigerte Festschreibung habe in Bezug auf die Kontrolle über die Eheschließung in reformierten Gebieten tendenziell zu einer Machtverschiebung hin zu den Eltern, beziehungsweise vor allem zum Vater, und zu kirchlichen sowie staatlichen Autoritäten geführt. Dagegen habe die Selbstbestimmung der Brautleute wie auch die Macht der erweiterten Verwandtschaft, ständisch-korporativer Verbände und der peer groups der Brautleute abgenommen. Kinder, die ohne elterlichen Konsens heirateten, konnten jetzt leicht enterbt werden, voreheliche Sexualität wurde kriminalisiert und bestraft.8 Für die vorreformatorische Hochzeitsgemeinschaft war nicht die vom Pfarrer gespendete Kasualhandlung ehekonstitutives Moment gewesen. Mit Blick auf populäre Sichtweisen und lokale Traditionen war es oftmals nicht eindeutig, wann eine Eheschließung rechtsgültig vollzogen war, da sie durch eine ganze Reihe verschiedener mehr oder weniger öffentlicher eheeinleitender und -formierender Rituale und Konventionen zwischen Kirche und Straße zustande kam.9 Dieser Umstand hatte immer wieder zu konfliktreichen Verhandlungen über die Gültigkeit von Ehen zwischen den verschiedenen involvierten Interessengruppen und Personen geführt.
Die reformierten Gesetzgeber waren bestrebt, diesem Umstand Abhilfe zu schaffen.10 Mit der dreimaligen Verkündigung der bevorstehenden Heirat am Wohn- und Heimatort von Braut und Bräutigam durch die Pfarrer der entsprechenden Gemeinden von der Kanzel und dem öffentlichen Kirchgang zur Eheeinsegnung wurde seitens der Regierung ein sozialdisziplinierendes Moment verbunden. Die Praxis wurde gleichzeitig formalisiert und reglementiert. Damit strebten die Obrigkeiten eine Uniformierung und Kanalisierung populärer Hochzeitsrituale an. Die Unterstellung einer sexuellen Beziehung und der Ausgangspunkt einer rechtlich anerkannten Ehe wurden dadurch – anders als in der populären Wahrnehmung – eindeutig geschieden.11 Entjungferungen und Brautschwangerschaften konnten fortan zumindest nicht mehr einfach per gesetzlicher Definition als ehekonstituierende Verlobungen interpretiert und ohne Weiteres zu einer vor Gott geschlossenen Ehe erklärt werden. Heimlich geschlossenen Verbindungen, sogenannten ‚klandestinen Winkelehen‘, wurde durch die ehekonstituierende Öffentlichkeit und die damit implizierte Kontrolle der Dorfgemeinschaft so besser vorgebeugt. Verborgen geschlossene Ehebündnisse zwischen zwei Individuen waren rechtlich erheblich leichter aufzulösen oder wurden erst gar nicht mehr anerkannt, da sie formellen Kriterien der Eheschließung nicht genügten. Das Eheversprechen genoss auf reformiertem Terrain keinen sakramentalen Charakter mehr. In vorreformatorischem Verständnis war allein der freiwillige Konsens zwischen zukünftiger Braut und zukünftigem Bräutigam als von Gott gestiftet und daher als unauflösliches Sakrament erachtet worden.12 Seit der Einführung des ersten Ehemandats genügte den Berner Magistraten das im gegenseitigen Einvernehmen gemachte mündliche Eheversprechen zwischen zwei Brautleuten allerdings nicht mehr zur Anerkennung einer gültigen Ehe.13 Als Ereignis war die spezifische Ehe von der weltlichen Herrschaft respektive deren geistlichen quasi-Beamten zu stiften, kontrollieren und sanktionieren. Die Ehe war im spezifischen Einzelfall nicht mehr durch Gott eingesetzt, sondern eine Entsprechung göttlicher Ordnung. Die durch die kirchliche Institution kontrollierte und exekutierte öffentliche Einsegnung der Ehe erhielt dadurch im Verhältnis zur intimeren, informelleren Verlobung eine starke Bedeutungssteigerung.14 Das konsensuale Eheversprechen initiierte die Ehe nach wie vor, doch vollzog es sie nicht abschließend. Gewisse materielle und güterrechtliche Forderungen konnten auch in der reformatorischen Ehekonstitution bereits nach der Verlobung geltend gemacht werden, falls eine Partei beschlossene Abmachungen bezüglich der Eheschließung nicht einhalten sollte. Dazu musste sich die Verlobung aber an öffentlich überprüfbare Kriterien der Gültigkeit halten, die jetzt weltlicher und nicht mehr sakramentaler Natur waren, um den Ausgangspunkt für eine anerkannte Ehe darstellen zu können: Sie musste nun durch Zeugen beglaubigt, schriftlichen Vertrag verbrieft oder Ehepfänder bewiesen sein. Das Ehemündigkeitsalter musste eingehalten werden, der Konsens des gesetzlichen Vormunds musste bei Minderjährigkeit bestehen. Gleichzeitig durfte de jure niemand in eine eheliche Verbindung mit einem unliebsamen Partner gezwungen werden. Weiter durften keine ehemindernden Verwandtschaftsgrade zwischen den Brautleuten vorliegen, wobei dieser Umstand, wenn auch in z. T. abweichenden Verwandtschaftsgraden, auch in der katholischen Ehetheologie vorlag.15 Ehen mussten vor ihrer Einsegnung dreimal von der Kanzel im Wohnort der Braut und des Bräutigams sowie in den jeweiligen Heimatgemeinden verkündet werden. Menschen aus dem sozialen Nahraum konnten auf gesetzlicher Grundlage dagegen opponieren und Ehehindernisse geltend machen.
Mit der Einführung des elterlichen Konsenses wurde die Kontrolle der Eltern über die Eheverbindungen ihrer Kinder institutionalisiert und massiv intensiviert. Die Gültigkeit eines Eheverlöbnisses war rein normativ durch die reformatorischen Entwicklungen zu einer mehr oder weniger öffentlichen gesellschaftlichen Frage der religiösen Legitimität und der Legalität erklärt worden, auch wenn die Obrigkeit in ihrem Anspruch an den Praktiken der Untertanen weiterhin oft scheiterte.16 Die patriarchale Kontrolle über die Eheschließung nahm dadurch nicht dagewesene Ausmaße an.17 Das Bestreben der reformierten Obrigkeit, die, wie gesagt, ausschließlich aus verheirateten, regimentsfähigen Hausvätern bestand, war klar: Definitionsmacht, Kontrolle und Alleinherrschaft über das zu erlangen, was analytisch gesehen die Schnittmenge aus Gewohnheitsrechten, Familienstrategien und individuellen Interessen darstellte.18 Das reformierte Ehegesetz integrierte dabei zwar populäre Vorstellungen und Praktiken der öffentlichen Eheschließung.19 Dahinter steckten aber die patriarchalen Interessen reformierter Obrigkeiten, die sich teilweise mit gemeinschaftlichen Interessen überschnitten; nämlich die Eheschließung aus der schlecht überprüfbaren Intimität und Privatheit des ‚Winkels‘ und damit der Geheimhaltung in den öffentlichen und sozial überwachten Raum der Kirche „unter Anwesenden“ zu ziehen und den wachsamen Augen und kollektiven Interessen der Gemeinschaft auszusetzen.20 Aufgrund der rudimentär ausgebildeten Verwaltungsstruktur war die Berner Obrigkeit in diesem Bereich geradezu auf Denunziationen und Anzeigen sittlichen Fehlverhaltens aus den Reihen der Bevölkerung vor den lokalen Chorgerichten angewiesen. Erst dörfliche Gerüchte und kooperierende Gemeindemitglieder brachten Regelverstöße vor die örtlichen Sittengerichte.21 Je nach Schwere des Delikts sollten diese dann Anzeige beim Oberchorgericht in Bern erstatten.22 Die Anzeigen kamen folglich „aus der Gesellschaft selber“.23 Diese Begebenheit konnte in den Gemeinden durchaus zu einem „System gegenseitiger Aufpasserei, Verdächtigung und Angeberei“ führen, das nicht nur in ehelichen, sondern auch in anderen sittlichen Angelegenheiten „auf den Gemütern lastete, die Gewissen beschwerte und die persönliche Freiheit knechtete und knebelte“.24