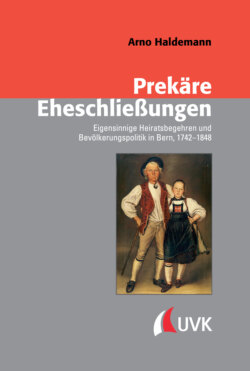Читать книгу Prekäre Eheschließungen - Arno Haldemann - Страница 18
1.1 Die revidierte Ehegerichtssatzung von 1743: ‚Heyl und Wolfahrt‘ unter ‚abgeänderte[r] lebens-manier der menschen‘
ОглавлениеDer Anfang des Untersuchungszeitraums dieser Studie fällt, wie erwähnt, mit dem Erlass der revidierten Chorgerichtssatzung 1743 zusammen. Mit der Erneuerung der Satzung beanspruchten Schultheiß, Kleiner und Großer Rat dem Verfall der sittlichen Ordnung entgegenzuwirken und die Gesetze der „abgeänderte[n] lebens-manier der menschen“ anzupassen.1 Die obrigkeitliche Anstrengung der Gesetzesrevision diente offensichtlich dazu, den Bürgern, Untertanen und anderen im Herrschaftsgebiet wohnhaften Menschen gesetzliche Bestimmungen in Erinnerung zu rufen, damit diese nicht in „Vergess gestellt“ wurden.2 Vor allem aber wurden sie erinnert und modifiziert, um kontinuierliche Herrschaft unter veränderten Vorzeichen zu reproduzieren, sodass „Heyl und Wolfahrt“, also Sitte und Ökonomie, im Sinne der herrschenden Staatsräson reproduziert werden konnten.3 Dieser Vorgang kann als „Prozesscharakter der Konstruktion“ analysiert werden:4 Den Potentaten ging es darum, bestehende Machtunterschiede unter transformierten gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen aufrechtzuerhalten. Schließlich sollte die Adjustierung der Gesetze dazu führen, „Zucht und Ehrbarkeit“ unter veränderten soziokulturellen Bedingungen in ihrer Wirkung fortbestehen zu lassen. Berns Machthaber erkannten zweifelsohne die „ohnumgängliche Nothdurfft“ der fortlaufenden Anpassung der Ordnung an die Zeitumstände, wenn sie ihre Herrschaft aufrechterhalten wollten.5
Dass die Ehe- und Sexualpraktiken der AkteurInnen die Gesetze im „Justiz-Alltag ‚abschliffen‘“ und durch die Aneignung veränderten, ist folglich nicht nur aus historischer Distanz zu ersehen.6 Auch Burgern und Räten, in deren Namen die Ordnung erlassen wurde, war offensichtlich wohlbekannt, dass die Wirkung von Gesetzen nachlassen konnte.7 Was Burghartz für die Ordnung der Geschlechter konzeptionell gefasst hat, schien den Berner Machthabern bei der Revision ihrer Ehegesetzordnung als Funktionsmechanismus gegenwärtig gewesen zu sein. Moderate gesetzliche Anpassungen schienen notwendig, um den strukturellen Fortbestand der Machtbeziehungen unter sich wandelnden gesellschaftlichen Umständen aufrechterhalten zu können.8 Um die Herrschaftsverhältnisse erfolgreich tradieren oder gar ausbauen zu können, bedurfte es feingliedriger Anpassungen an die zeitgenössischen Gewohnheiten und das Verhalten der Landesbewohner. Dass dieser Umstand der Herrschaftsschicht bewusst war, dokumentiert wiederum die revidierte Chorgerichtssatzung von 1743. Dort ließ die bernische Obrigkeit verlauten, dass sie
„nicht nur gutfunden, diss-örthige ehemalige Satzungen für die Hand zu nemmen und mit Fleiß zu durchgehen, sondern in eint- und anderem, gestalten Dingen nach, auf gegenwärtige Zeiten und Läuff selbe einzurichten, zu verbessern und in fernerem hiemit anzuordnen […].”9
In der Folge ist es interessant zu untersuchen, mit welcher bevölkerungspolitischen Intention die Berner Regenten die Chorgerichtssatzung von 1743 revidierten, um die abgenutzte Ordnung in ihrer ehemaligen Wirkung wiederherzustellen. Während die Berner Magistrate mit den christlichen Mandaten von 1628 im 17. Jahrhundert und in der Folge kontinuierlich mit weiteren Verordnungen und Gesetzen mittels Normierung der Eheschließung auf Armutsphänomene zu reagieren begannen, erreichten die Gemeinden mit der „lands-vätterliche[n]“10 Ehegesetzordnung von 1743, dass sie unabhängig vom Alter alle Almosenbezüger-Innen und Menschen mit körperlichen Gebrechen mittels Zugrecht von der Ehe und damit von der ‚reinen‘ Sexualität ausschließen konnten. Das Zugrecht war „ein Vetorecht“, das ursprünglich den Eltern oder, im Fall von deren Tod oder Unmündigkeit, nahen Verwandten oder Vögten minderjähriger Kinder zukam, wenn sie Einwände gegen deren Eheaspirationen hatten.11 Dieses Recht wurde nun in bestimmten Fällen auf Gemeinden und Korporationen ausgedehnt: Gemeindeangehörige, die zu heiraten wünschten, konnten jetzt von diesen, sogar über die Volljährigkeit hinaus, daran gehindert werden, wenn sie von ihren Korporationen oder Gemeinden Unterstützungsleistungen bezogen oder in der Vergangenheit erhalten, aber nicht zurückbezahlt hatten.12 Die entsprechenden Neuerungen fanden unter dem Titel „Artickel und Sazungen, die Ehe betreffend“ unter dem dritten Absatz Eingang in das schriftlich verbriefte Ehegesetz von Bern. AlmosenempfängerInnen und Menschen mit leiblichen Gebrechen, denen nicht zugetraut wurde, sich und allfälligen Nachwuchs zu versorgen, konnten fortan über das 25. Lebensjahr hinaus an der Eheschließung gehindert werden.13 Faktisch wurde damit ein Ehehindernis errichtet und im Gesetzestext verankert, das arme Personen und Menschen mit körperlichen Gebrechen komplett von der Reinheitsordnung ausschloss. Die Sexualität dieser Menschen wurde per se diskreditiert, indem sie das Gesetz als ‚leichtsinnig‘ verurteilte.14 Das stellte die bisher schärfste gesetzgeberische Restriktion von Armenehen in der bernischen Ehegesetzgebung dar. Sie reihte sich in jene Entwicklung „intensivierter Kontrolle von Sexualität“ ein, die mit der starken Bevölkerungszunahme und der zunehmenden sozialen Polarisierung einherging, die Joachim Eibach für das 18. Jahrhundert aus kriminalitätshistorischer Perspektive thematisiert hat.15
In Bezug auf die frühneuzeitliche Ehegesetzgebung in Bern von der Reformation bis 1824 kann von einer beachtlichen Beständigkeit gesprochen werden. An den Prinzipien der Ehedefinition, der konstitutiven Merkmale und Anforderungen, der Rolle der Kirche und der Scheidung änderte sich im Verlauf der Frühen Neuzeit relativ wenig. Offensichtlich genügten diese dem Zweck der Herrschaftssicherung nach wie vor. Hingegen fanden im Ehehindernis für besteuerte Armengenössige bevölkerungspolitische Neuerungen Niederschlag, die der Idee aufgeklärter Staatsräson folgten und das biblische Recht auf Ehe für AlmosenempfängerInnen drastisch einschränkten.16 Die Ausdehnung des patriarchalen Zugrechts auf Gemeinden und Korporationen hatte ganz offensichtlich nicht mehr viel mit reformiert-religiösen Vorstellungen vom Menschen zu tun, der sich nicht für die vollständige sexuelle Abstinenz, das Zölibat, eignete. Durch den Ausschluss armer Bevölkerungsgruppen von der Ehe hatte man seitens der Räte und Burger im Geist reformierter Anthropologie sehr sündenbewusst uneheliche Kinder, illegitime sexuelle Beziehungen und Lebensformen in Kauf genommen. Nun wuchs aber die Angst vor dem Verlust ständischer Privilegien, insbesondere in Anbetracht der Vermehrung subalterner Schichten, dermaßen an, dass man sie kurzerhand von der reinen Gesellschaft prinzipiell ausschloss.17 Dadurch wurden diese Schichten eherechtlich prekarisiert und in der Konsequenz sexuell diskriminiert: Diese zahlenmäßig große Gesellschaftsgruppe wurde somit rechtlich verunsichert, materiell noch verletzlicher gemacht und sexuell tendenziell inkriminiert.18 Die Beobachtungen von Eibach in Bezug auf den markanten Anstieg von Sexual- und Eigentumsdelikten im 18. Jahrhundert erhärten diese These.19
Die gesetzliche Normierung entwarf die reine Ordnung in der Folge in zunehmendem Ausmaß als eine immer exklusivere Gesellschaft. Außerdem war mit der Säkularisierung im Zuge der Aufklärung die Furcht vor göttlicher Kollektivstrafe gesunken, was die Bedeutung der gesamtgesellschaftlichen Reinheit aus theo-logischer Perspektive reduziert erscheinen ließ. Gleichzeitig nahm die ökonomistische Furcht vor materieller Armut und dem Zerfall des diesseitigen Wohlstands zu. Im 18. Jahrhundert wurden transzendentale Heilsvorstellungen von einer ökonomistischen Sichtweise abgelöst, die moralisch-sozialpolitisch auf diesseitige Güter fokussierte.20 Der religiöse Wert der moralischen Reinheit war einer utilitaristischen Konnotation der Reinheit gewichen, die Armut und Unreinheit miteinander verschränkte. In dieser Verquickung wurde die Reinheit mit Hygiene in Zusammenhang gebracht, wenn es hieß, dass die außereheliche Sexualität, „die verderblichsten Krankheiten nach sich zieh[e]“.21 Sexuelle und damit moralische Unversehrtheit wurden in Bern Mitte des 18. Jahrhunderts quasi als schriftlich fixiertes Privileg der besitzenden Klasse im gedruckten Ehegesetz manifestiert. Dadurch wurde sie unverhohlen als ein ökonomisches Vorrecht kodifiziert. Der von Daniel Schläppi bezüglich des Armenwesens von Bern konstatierte „Sog der Ökonomisierung“ im Verlauf des 18. Jahrhunderts offenbarte sich ebenso in der Ehegesetzgebung der Berner Obrigkeit: Er zeigte sich auch hier „in effizienterem und sparsamerem Umgang mit den vorhandenen Ressourcen“ und „beeinträchtigte [ebenfalls] das integrative Potential“ des Ehegesetzes.22