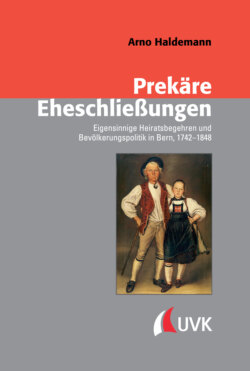Читать книгу Prekäre Eheschließungen - Arno Haldemann - Страница 7
3.1 Theorie: Eigensinn, Strategie und Taktik
ОглавлениеUm die Transformationen und deren Ursachen im Bereich der Eheschließung am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert einzufangen, empfiehlt es sich, die Geschichte der Eheschließung „von den Rändern“ her zu betrachten.1 Die Ränder befinden sich dort, wo von der Norm abweichendes, also deviantes Verhalten auftritt.2 An dieser Stelle werden die eigensinnigen „Aneignungen“ jener heiratswilligen AkteurInnen sichtbar, die mit ihren konkreten Heiratsbegehren die gesetzlichen und sozialen Normen im lokalen und familiären Umfeld herausforderten.3 Durch ihr taktisches Handeln stellten sie gewollt oder unabsichtlich Konventionen in Frage und provozierten dadurch Reaktionen von OpponentInnen und strategische Urteile der Eherichter.4 Mit dieser Perspektive folgt die Studie Alf Lüdtkes Konzept des Eigen-Sinns, das im weiteren Verlauf der Arbeit mit der Handlungstheorie von Michel de Certeau kombiniert werden wird.5 Diese Handlungstheorie gewinnt ihr Profil dadurch, dass sie insbesondere benachteiligten Menschen Handlungsmöglichkeiten zugesteht, die unablässig versuchen, sich die herrschenden Strukturen anzueignen. Sie ergänzt sich sehr gut mit dem Konzept des deutschen Historikers, der seinerseits „Eigensinn“ in Anlehnung an G. W. F. Hegel als jene stark limitierte Freiheit beschreibt, die dem ‚Knecht‘ in seiner Abhängigkeitssituation bleibt.6 Dabei steht die Figur des Knechts bei Lüdtke stellvertretend für „die Besitzlosen“.7 Das trifft teilweise gut auf die hier untersuchten ehewilligen AkteurInnen zu. Tatsächlich waren sie nicht selten Knechte und die Akteurinnen Mägde in landwirtschaftlichen Anstellungsverhältnissen. In vielen anderen Fällen waren sie besitzlos oder zumindest unvermögend. Der „eigene Sinn“ dieser Benachteiligten und zum Teil Mittellosen wurde wahrnehmbar, weil er sich „gegen alle und alles“ – im konkreten Fall gegen Familie, Gemeinden, Korporationen und Obrigkeit – wenden konnte.8 Der Eigensinn bedeutet in dieser Studie die „Uneinheitlichkeit in der Auffassung von der Grundlage der Ehe und der Einstellung zur Sexualität“ der ehewilligen AkteurInnen mit den OpponentInnen und dem Gericht.9 Mit de Certeau lässt sich dann erklären, auf welche Weise und mit welchem Einsatz die am Aushandlungsprozess der Ehe beteiligten und mit unterschiedlicher Handlungsmacht ausgestatteten AkteurInnen und Gruppen ihre Vorstellungen beziehungsweise ihre Normen durchzusetzen versuchten.
Um die Konflikte an den Rändern in den Blick zu bekommen, werden für das ausgehende Ancien Régime und die Zeit nach der Helvetik bis zur Bundesstaatsgründung Ehevorhaben erforscht, die aus dem sozialen Nahraum mittels sogenannter ‚Eheeinsprachen‘ vor der zuständigen ehegerichtlichen Instanz im Territorium angefochten wurden. Die „streitig gemachte[n] Eheversprechung[en]“10 – ein zeitgenössischer Quellenbegriff –, die vor Gericht gezogen wurden, werden analysiert, weil in ihrer Verhandlung Praktiken auf Normen prallten und dadurch Reaktionen der Richter auslösten. Diese unablässigen Kollisionen führten, so die begründete Vermutung, zu jenen „kleinen Ereignisse[n]“, die in ihrer Kumulation durchaus zu größeren Veränderungen führen konnten und zumindest ihrem Potential nach transformativ waren.11 Durch die gewählte Herangehensweise werden in der vorliegenden Studie somit Ehegesetz, gesellschaftliche Vorstellungen und individuelles Handeln aufeinander bezogen und in ihren Wechselwirkungen begriffen. Die Praxis der Eheschließung kommt dadurch multiperspektivisch von ‚oben‘ (das Gericht), der Mitte (die Opponierenden) und von ‚unten‘ (die Ehewilligen) in den Blick. Weiterführende Erörterungen zu dieser Unterscheidung folgen weiter unten im Text.
Anhand der umstrittenen, konfliktreichen Fälle wird ersichtlich, was vom Gericht und der Gesellschaft als ‚normal‘ erachtet wurde, also was das zeitgenössische Eheverständnis war und wogegen sich Opposition formierte.12 Beim Abschreiten der Ränder und Grenzen des Normalen stößt man in den Quellen auf jene AkteurInnen, die de Certeau als „Helden des Alltags“ qualifiziert hat, und die in seiner metaphorischen Sprache „den Chor der am Rande versammelten“ ausmachen.13 Ihre eigensinnigen Ehebegehren standen den Gesetzen und den gesellschaftlichen Normvorstellungen widerspenstig und fremd gegenüber. Um ihren Eigensinn vor Gericht durchzusetzen, mussten sie frei nach de Certeau listen- und trickreiche Taktiken entwickeln.14 Dort schlugen ihnen die Argumente der einsprechenden Opponierenden entgegen, während die Richter ihre strategischen Urteile über den Ausgang der Verhandlungen fällten.
In der Differenzierung von Strategie und Taktik folgt die Arbeit der Handlungstheorie des französischen Historikers: Die Strategie zielt auf „die Beherrschung der Zeit durch die Gründung eines autonomen Ortes“.15 Sie entwickelt dabei nicht nur laufend die Macht, diesen Ort nach ihren Rationalitäten zu organisieren und zu besitzen. Sie grenzt ihn durch strategische Handlungen auch laufend gegen außen ab. Im konkreten Fall stellte dieser Ort, den es durch die Strategen – die Berner Obrigkeit und die Eherichter – zu beherrschen galt, die Ehe dar. Bei der Erhaltung und Organisation dieses Ortes, das heißt bei der Behauptung der Herrschaftsverhältnisse konnten sie auf mächtige Ehegesetze und bevölkerungspolitische Diskurse zurückgreifen, die ihrerseits von ihnen produziert wurden.
Dagegen definiert de Certeau die Taktik als etwas, das gegenüber der Strategie tendenziell „durch das Fehlen von Macht bestimmt“ ist. 16 Die Taktik kennt „nur den Ort des Anderen“ und „muss mit dem Terrain fertigwerden, das ihr vorgegeben wird, wie es das Gesetz einer fremden Gewalt organisiert“.17
„Gerade weil sie keinen Ort hat, bleibt die Taktik von der Zeit abhängig; sie ist immer darauf aus, ihren Vorteil ‚im Fluge zu erfassen‘. […] Sie muss andauernd mit den Ereignissen spielen, um ‚günstige Gelegenheiten‘ daraus zu machen. Der Schwache muss unaufhörlich aus den Kräften Nutzen ziehen, die ihm fremd sind. Er macht das in günstigen Augenblicken, in denen er heterogene Elemente kombiniert […]; allerdings hat deren intellektuelle Synthese nicht die Form eines Diskurses, sondern sie liegt in der Entscheidung selber, das heißt, im Akt und in der Weise wie die Gelegenheit ‚ergriffen wird‘.“18
Die verfolgte Herangehensweise legt somit den Akzent der Untersuchung darauf, dass sich die Aushandlungsprozesse rund um die Eheschließung stets in wirkungsmächtigen, aber in der Praxis immer auch manipulierbaren und daher zeitlich begrenzten Strukturen abspielten.19 Heiratswillige AkteurInnen mussten sich aufgrund ihrer eigensinnigen Ehebegehren mit gesetzlichen und bevölkerungspolitischen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Sie wurden aufgrund ihrer eigensinnigen Vorstellungen und ihres subversiven Handelns sowohl von AkteurInnen aus dem sozialen Nahraum als auch vom Gericht geradezu zur Konfrontation gedrängt. Um sich das Privileg der Ehe trotz der Einsprachen anzueignen, waren sie gezwungen, das ihnen fremde Gesetz kreativ zu ihren eigenen Gunsten auszulegen – de Certeau hat für diese Handlung das passende Verb „umfrisieren“ verwendet.20 Im gesetzlich normierten Raum suchten die heiratswilligen AkteurInnen taktisch kreativ nach Lücken und Gelegenheiten, um ihre eigensinnigen ehelichen Interessen durchzusetzen, wenn ihre Beziehungskonstellationen nicht den herrschenden Konventionen entsprachen. Dagegen versuchten einsprechende Familien, Verwandte, Gemeinden, Korporationen und selten auch Nebenbuhler ihrerseits die Eheschließungen mit ehehindernden Taktiken zu verunmöglichen.