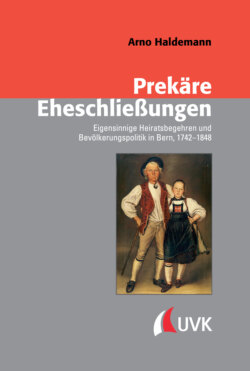Читать книгу Prekäre Eheschließungen - Arno Haldemann - Страница 8
3.2 Begriffliches: Prekär
ОглавлениеOpponentInnen gegen die hier untersuchten eigensinnigen Eheschließungen konnten Familienmitglieder, Verwandte, Nachbarn, Vögte, Gemeinden, ständische Korporationen oder Nebenbuhler der Eheaspiranten sein. Auch das entsprechende Gericht konnte von Amtes wegen auf den Plan treten. Durch die Einsprachen wurden die zwischen Individuen partnerschaftlich-konsensual gegebenen Eheversprechen ‚widerruflich‘. Die eheliche Einsegnung, die formale Vollziehung und Anerkennung der Ehe, stand dann auf dem Spiel und wurde ‚unsicher‘. Somit waren die Ehevorhaben in ihrer misslichen und heiklen Lage permanent gefährdet und drohten zu scheitern. Folgt man im Duden der Bedeutungserklärung und den Herkunftsangaben des Lemmas ‚prekär‘, dann handelt es sich bei den hier untersuchten Eheschließungen um solche, die den Eigenschaften dieses Adjektivs exakt entsprechen. Das deutsche Wörterbuch schreibt zur Bedeutung von prekär: „in einer Weise geartet, die es äußerst schwer macht, die richtigen Maßnahmen, Entscheidungen zu treffen, aus einer schwierigen Lage herauszukommen; schwierig, heikel, misslich“.1
Diese Begriffsdefinition schließt sich einem kulturwissenschaftlichen Konzept an, das „‚Prekarisierung‘ als einen Prozess, der nicht nur Subjekte, sondern auch ‚Unsicherheit‘ als zentrale Sorge des Subjekts produziert“, begreift.2 Es geht maßgeblich auf den französischen Soziologen Pierre Bourdieu zurück. Dieser hat damit zwar eine präzedenzlose Herrschaftsform im 20. Jahrhundert charakterisiert, die mit dem Neoliberalismus einhergeht, aber in den Konsequenzen augenfällige Analogien mit dem frühindustriellen Kapitalismus aufweist.3 Seither haben verschiedene Sozialwissenschaftler*innen sich bemüht, die postulierte Beispiellosigkeit der Herrschaftsform für unsere Gegenwart besonders mit Blick auf moderne Anstellungsverhältnisse zu zementieren.4 In den Augen von Historiker*innen haben sie damit aber wenig Plausibilität für ihre These dazugewonnen, weil ihnen der fundierte historische Vergleich fehlt. Tatsächlich gleichen aber die von ihnen beschriebenen Effekte für das 20. und 21. Jahrhundert jenen Erscheinungen sehr stark, die die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Eheschließung im 18. und 19. Jahrhundert für die hier untersuchten heiratswilligen AkteurInnen hatte.5 Die von Bourdieu beschriebene „objektive Unsicherheit“ löste bei den Menschen in Bezug auf die Eheschließung im 18. und 19. Jahrhundert ebenso „eine allgemeine subjektive Unsicherheit“ aus, die auch jene bedrohte, die von ihr nicht oder zumindest nicht unmittelbar betroffen waren.6 Die vorliegende Arbeit verwendet den Begriff, weil dieser ihren Untersuchungsgegenstand akkurat charakterisiert. Sie möchte damit historisch differenziert zur inhaltlichen Schärfung des Konzepts beitragen.
Folglich werden hier prekäre Eheschließungen in Bern am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert untersucht. Diese wiesen ein spezifisches konfiguratives Element auf: Ihnen ging ein ursprünglich einvernehmliches Eheversprechen der Brautleute voraus. Gegen dieses konsensuale Ehebegehren wurde im Nachhinein von den bereits erwähnten OpponentInnen Einspruch erhoben. Entsprechende Ehehindernisse wurden geltend gemacht, um den Vollzug der Eheschließung durch die Einsegnung des Pfarrers in der Kirche zu verhindern.7 Dazu wurden sogenannte ‚Eheeinsprachen‘ oder ‚Zugrechtsklagen‘ zunächst vor dem Pfarrer oder lokalen Chorgericht geltend gemacht.8 Dies geschah jeweils in Reaktion auf das Eheaufgebot, das in Bern durch die sogenannten ‚Kanzelverkündigungen‘ durch den Gemeindepfarrer geschah. Die Verkündigungen hatten an drei aufeinander folgenden Sonntagsgottesdiensten von der Kanzel in der Kirche der Heimat- und Wohngemeinde der Ehewilligen zu erfolgen. Sie waren in der Chorgerichtssatzung, dem Berner Ehegesetz, kodifiziert und obligatorisch. Allerdings bestand vor der Helvetik (1798–1803) für Angehörige des Patriziats, der hohen Beamtenschaft und des Klerus die Möglichkeit der Dispensation.9 Für alle anderen Personen diente das Rechtsinstitut als offizielle öffentliche Ankündigung einer gewünschten Eheschließung, weshalb durch die untersuchten Einsprachen potentiell weite Teile der bernischen Bevölkerung aus unterschiedlichen Ständen und Schichten ins Spektrum der Untersuchung kommen. Die Verkündigungen ermöglichten kommunale, korporative und verwandtschaftliche Kontrolle und die Zurückweisung ehelicher Ansprüche. Damit sollten klandestine Ehen gegen den Willen und die Interessen der involvierten Familien, Gemeinden und Korporationen sowie Bigamie verhindert werden. Insofern waren prekäre Ehen durchaus „das Produkt eines politischen Willens“.10 Die deponierten Eheeinsprüche sollten dann ex officio vor das territoriale beziehungsweise kantonale Ehegericht gelangen. Die Mehrheit der Fälle, die vor dem Oberehegericht landeten, wurde durch dessen Urteil abgeschlossen. Gerichtsverhandlungen und Rekurse kosteten viel Geld, mussten folglich finanziert werden und waren zeitaufwendig. Die Investition von materiellen und immateriellen Ressourcen setzte eine Aussicht auf potenziellen Erfolg voraus. Zahlreiche KlägerInnen und AntworterInnen fanden sich daher mit dem Urteil des Oberehegerichts ab. Sie arrangierten sich damit, da ein Rekurs trotz großem Ressourcenaufwand wenig erfolgsversprechend erschien. Diese Fälle finden sich im Staatsarchiv Bern (StABE) in den sogenannten ‚Chorgerichtsmanualen‘ wieder.11
Einige sehr aussagekräftige Verhandlungen wurden allerdings von besonders eigensinnigen AkteurInnen vor den Rat gezogen und weitergeführt, weil eine der involvierten Parteien außergewöhnlich hartnäckig war und den Entscheid des Gerichts nicht annehmen wollte.12 Die Gerichtsfälle, die zum Weiterzug vor den Rat geführt hatten, sind Gegenstand der vorliegenden Studie. Sie werden hier herangezogen, weil sie den Eigensinn und die Persistenz der AkteurInnen in besonderem Ausmaß demonstrieren und letztendlich von oberster Regierungsinstanz, dem Rat von Bern, beurteilt werden mussten. Hier forderten ehewillige Akteur-Innen in maximaler Weise Handlungsmacht gegenüber ihrem familiären und kommunalen Umfeld ein und veranlassten das obrigkeitliche Gericht zu strategischen Reaktionen in der praktischen Normierung heraus. Für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit sind diese politisch aufgeladenen Eheschließungen daher in besonderem Maße aufschlussreich. Dass in der Untersuchung auch Fälle von armen und besitzlosen Personen in den Blick kommen, dafür sorgten zwei Umstände: Einerseits wurde gegen viele Urteile von den OpponentInnen rekurriert, weil sie mit dem Ausgang der Verhandlung nicht zufrieden waren. Andererseits existierte ein „besonderes Armenrecht“, das es unvermögenden Menschen erlaubte, den Fall weiterzuziehen und so ihren Eigensinn trotz fehlender Mittel durchzusetzen.13 Gleichzeitig waren, wie noch zu zeigen sein wird, an gewisse eigensinnige Ehebegehren auch Interessen einer Gemeinde geknüpft. Wenn zum Beispiel eine mittellose Verlobte bereits schwanger war, konnte das durchaus dazu führen, dass die Gemeinde der Frau kurzfristig Mittel in den Aushandlungsprozess investierte, um langfristig kommunale Ressourcen zu sparen.
Insofern beweist die Konstellation der untersuchten und hier als prekär bezeichneten Fälle eine besondere, vorerst aus dem Handeln der AkteurInnen abgeleitete Form des Eigensinns: Erstens entsprachen die aspirierten ehelichen Verbindungen nicht den Interessen, dem ‚Gemeinsinn‘ und den Rechtsvorstellungen von Verwandten, Gemeinden, ständischen Korporationen und Kirchendienern. Auf diese Weise erschienen sie per se eigensinnig, weil sie durch ihren Wunsch im unmittelbaren sozialen Nahraum Widerstand evozierten. Sie wichen von allgemeinen Normvorstellungen ab und waren somit deviant.
Zweitens mussten die Heiratswilligen zum Teil ihren Fall gegen solchen Widerstand im Sinne der „Justiznutzung“ selbstständig vor die zuständige gerichtliche Instanz in Bern ziehen.14 Die oben beschriebenen Eheeinsprachen und Zugrechtsklagen sollten eigentlich auf Amtswegen an das Oberehegericht in Bern gelangen. Denn dieses war zuständig für die Beurteilung dieser Fälle. In der Praxis untersagten aber Gemeinden wiederholt zwar die weiteren Verkündigungen, leiteten aber die Einsprüche nicht an das Oberehegericht weiter. Dadurch konnte es zu keiner weiteren Verhandlung kommen. Die Ehewilligen mussten unter diesen Umständen ihr Recht vor dem Oberehegericht selbstständig einfordern, wollten sie ihr eheliches Vorhaben in die Tat umsetzen. Gemeinden hielten das Pfarrpersonal teilweise auch ohne offiziellen Einspruch an, die obligaten Verkündigungen in der Pfarrei der Braut, des Bräutigams und allenfalls den davon abweichenden Wohnorten der beiden auszusetzen. Dadurch unterbrachen und behinderten sie den ehekonstituierenden Gesamtprozess und vereitelten die abschließende eheliche Einsegnung der Verbindung durch einen Pfarrer auf lokaler Ebene auf unbestimmte Zeit. Das konnte die Justiznutzung seitens der Ehewilligen provozieren, um den individuellen Willen durchzusetzen.
Drittens spricht für eine spezifische und besonders intensive Form des Eigensinns in den hier als prekär klassifizierten Fällen, dass die ehewilligen sowie die gegen den Ehevollzug opponierenden Parteien bei abschlägigem Urteil des Oberehegerichts dazu bereit waren, sogar gegen das Urteil des Oberehegerichts zu rekurrieren. Sie zogen den Fall bis vor die höchste Instanz, den Berner Rat. Das Rekursverfahren war entsprechend ressourcenintensiv. Den Fall aus dem lokalen chorgerichtlichen Kontext nach Bern in den Rat zu ziehen, beanspruchte Zeit, war mit unterschiedlichen physischen und psychischen Strapazen des Reisens verbunden und verzehrte Geld für die Reisekosten der Parteien und deren vorgeladene Zeugen. Die Richter, der Gerichtsschreiber und die Anwälte hatten ebenfalls ihren Preis. Auch die übrigen Verfahrenskosten und die ausgestellten Dokumente mussten bezahlt werden, sofern die Kosten vom Gericht nicht abgeschlagen wurden.15 Hinzukommen konnten je nach Beziehungskonstellation und der sexuellen Vorgeschichte des Paares, das den ehelichen Status anstrebte, Geldstrafen und ehrrührige Bußpraktiken, zum Beispiel bei Ehebrechern und unehelich Schwangeren. Diese konnten sowohl finanzielles als auch symbolisches Kapital kosten. Entsprechende Beschwerlichkeiten und Risiken ging man entweder ein, weil man unbedingt heiraten wollte, aber von der anderen Partei vor Gericht gezwungen wurde. Oder man war so eigensinnig, seinen Heiratswillen gegen ständische Hindernisse selbstständig vor Gericht und durch dessen Sanktionierung zur gemeinschaftlichen Anerkennung zu bringen.