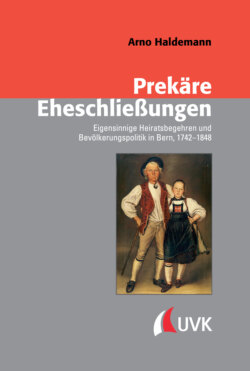Читать книгу Prekäre Eheschließungen - Arno Haldemann - Страница 17
1 Normen und Debatten: Ehegesetze und bevölkerungspolitische Diskussionen
ОглавлениеNachdem die reformatorische Vorgeschichte erörtert wurde, werden an dieser Stelle der Arbeit die Handlungsräume ausgelotet, die das ehepolitische Dispositiv den um prekäre Eheschließungen versammelten AkteurInnen im 18. Jahrhundert ließ.1 Dabei liegt der Schwerpunkt auf der zweiten Hälfte des Centenniums. Um dieses Dispositiv rund um die Eheschließung für Bern zu rekonstruieren, beleuchtet die vorliegende Untersuchung zum einen den relevanten ehegesetzlichen Rahmen für das Handeln der ehewilligen AkteurInnen. Das geschieht anhand von Ehegerichtsordnungen und deren Revisionen. Dabei folgt die Studie Foucaults Unterscheidung von Gesetz und Norm, nach der die Funktion des Gesetzes in der Kodifizierung und somit der schriftlichen Kondensation der Norm liegt.2 Erst die Fixierung der Norm lässt das abweichende Verhalten historischer AkteurInnen am Rande der Gesetze hervortreten.3 In den folgenden Ausführungen werden die kodifizierten Normen der Berner Herrschaft zur ehelichen Konstitution des Zusammenlebens von Mann und Frau – die familiäre Koexistenz war ausschließlich heterosexuell gedacht – zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten des 18. Jahrhunderts (1743 und 1787) miteinander verglichen. Sie werden jeweils als Ausdruck unterschiedlicher Konjunkturen bevölkerungspolitischer Logiken, Ansichten und Meinungen der Berner Regierung interpretiert, die von den Wechselwirkungen zwischen Ehe- und Sexualverhalten der AkteurInnen auf dem Land sowie in der Stadt und der obrigkeitlichen Wahrnehmung sozioökonomischer Verhältnisse im Herrschaftsgebiet Berns abhingen. Da sich die vorliegende Arbeit der Erforschung der Sattelzeit widmet, stellt die revidierte bernische Chorgerichtssatzung von 1743 formal einen idealen Anfangspunkt für diese Studie dar. Zudem fiel das Erscheinen des oberchorgerichtlichen Rekursmanuals beinahe exakt mit der Einsetzung dieser revidierten Ehegerichtsordnung zusammen und stand in direktem Zusammenhang damit. Die vom Gerichtsschreiber verfassten Manuale bilden die materielle Grundlage für die weiteren Untersuchungen zur Akteurspraxis von Heiratswilligen, eheeinsprechenden Personen und Parteien sowie der Gerichtstätigkeit.
Zum anderen wird für den angestrebten Vergleich die bevölkerungspolitische Debatte rund um die Oekonomische Gesellschaft in Bern berücksichtigt. Diese spätaufklärerische Sozietät war „die erste bedeutende kontinentaleurop[äische] […] dieser Art“.4 Sie setzte sich im Rahmen eines umfassenden Ökonomieverständnisses, das auch die Bevölkerungsentwicklung einschloss, mit den relativ unflexiblen ehepolitischen Strukturen auseinander und kritisierte oder stützte diese je nach Zeitpunkt. Die gelehrte Gesellschaft verschrieb sich dabei dem Generieren, Diskutieren, Verbreiten und Umsetzen von nützlichem Wissen, um die Produktion insbesondere in der Agrarwirtschaft zu steigern. Sie setzte sich in ihren sogenannten ‚Preisfragen‘ in politisch brisanter Weise mit dem Verhältnis von Bevölkerungswachstum und Ressourcen auseinander, indem sie wiederholt die Frage aufwarf, wie eine Regierung dieses Verhältnis erfolgreich steuern sollte. Für hochstehende Beiträge zur Beantwortung dieser Fragen wurden Preise ausgeschrieben und die Publikation der Schreiben in Aussicht gestellt. Damit wandte die Sozietät ein zeitgenössisch bekanntes Mittel zur Wissensgenerierung an, das schon zuvor in anderen Gelehrtengesellschaften und Akademien angewandt wurde.5 Mitglieder und Assoziierte setzten sich dezidiert mit der konkreten Frage auseinander, „wie man am besten regiert“, weil sie an „der Rationalisierung der Regierungspraxis bei der Ausübung der politischen Souveränität“ interessiert waren.6 Ihre Abhandlungen bildeten – im Kontrast zu den relativ starren obrigkeitlichen Ehegerichtsordnungen – eine unmittelbare und dynamische diskursive Auseinandersetzung mit der aktuellen Wahrnehmung demographischer Zustände und Entwicklungen ab.
Dabei bezogen einige Autoren in den auf Preisfragen hin eingereichten Schriften spezifisch Stellung zur obrigkeitlichen Ehenormierung als Kontroll- und Steuerungsinstrument bevölkerungspolitischer Bestrebungen. Darin kritisierten sie zum Teil die obrigkeitliche Bevölkerungspolitik mehr oder weniger offenkundig. Hier sollen diejenigen bevölkerungspolitisch einschlägigen Eingaben an die Oekonomische Gesellschaft in die Untersuchung des normativen Handlungsrahmens miteinbezogen werden, die die Eheschließung als Regulativ des Bevölkerungswachstums thematisierten. Sie geben Auskunft über zeitgenössische Wahrnehmungen und Einschätzungen der sozioökonomischen Zustände des Kantons in der entstehenden politischen Öffentlichkeit des 18. Jahrhunderts. Die öffentliche Debatte fand in Auseinandersetzung mit den herrschenden Gesetzen und der Erfahrung der ehegerichtlichen Praxis statt. Sie war über die Ehepraxis der Bevölkerung ebenso informiert wie sie dieselbe theoretisch und schreibend zu beeinflussen versuchte, indem sie auf Reformen in der Gesetzgebung drängte oder kritisch auf neue Mandate und Verordnungen reagierte.