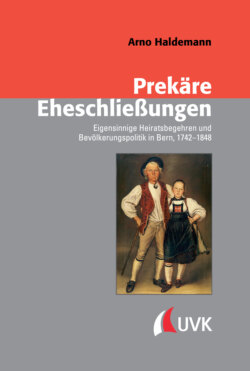Читать книгу Prekäre Eheschließungen - Arno Haldemann - Страница 22
1.4 Von der Angst vor der Entvölkerung zur Angst vor der Überbevölkerung
ОглавлениеSchon in den 1760er Jahren gab es in der Oekonomischen Gesellschaft allerdings auch Stimmen, die dem propagierten Populationismus gegenüber kritisch eingestellt waren. Sie schlugen eine ganz andere, nämlich patriarchale Ehepolitik vor, die viel stärker „der Tradition des Hausvater-Modells“ folgte1 – so zum Beispiel der Berner Landgeistliche Albrecht Stapfer,2 der für einen prosperierenden Landbau klassisch anmutende patriarchale Maßnahmen propagierte: Die Eltern sollten darauf achten, dass ihre Kinder eher spät heirateten, weil in seinen Augen Verehelichungen in jungen Jahren meistens unglücklich endeten.3 Wer sich dagegen im reifen Alter traute, tat das nicht „aus einem jugendlichen und hizigen triebe“, sondern „[gründet] sich zugleich auf vernunft“, woraus eine „zärtliche und unzertrennliche freundschaft“ in der Ehe resultiere.4 Diese Beziehungsgrundlage ließ auch in der Auffassung des Vikars den Nachwuchs „gesünder und stärker“ werden, weil die Erziehung in diesen kooperativen Ehen besser gewährleistet werden könne. Zudem stellte diese Freundschaft die Basis dar, um „einem hauswesen recht vorzustehen“.5 Die Verantwortung lag nach Stapfers Auffassung bei den Eltern, „dass sie ihren kindern nicht allzuviele freyheit in dieser so wichtigen sache gestatten“.6 Vätern und Müttern oblag es, ihre Kinder von „böser gesellschaft“ in „weinhäuser[n]“ fernzuhalten.7 Denn dort würde sich die ausgelassene Jugend treffen, die Söhne und Töchter verführte. Er warnte in durchaus aufklärerischem Duktus vor den ländlichen Gepflogenheiten der Eheanbahnung, die entweder zu unglücklichen Ehen oder einem zahlreichen unehelichen Nachwuchs führen würden.8 Stapfer forderte deswegen, dass die Eltern besonders die Schamhaftigkeit ihrer Söhne pflegten. Sie sollten diese fördern, indem sie den männlichen Nachwuchs abends im Haus behielten. Dadurch würden die Söhne vom nächtlichen Umherschweifen ab- und somit von den liederlichen Mägden ferngehalten, die in Stapfers Vorstellung nur listig danach trachteten, die Söhne „anzuloken“.9 Aus den elterlich unkontrollierten Verbindungen konnten nur zwei denkbar schlechte Szenarien resultieren. Entweder mussten die Eltern eine Frau in ihrem Haus aufnehmen, die ihnen missfiel, oder der Sohn musste in einer hier ständisch-patriarchal gedachten Ehrgesellschaft „für sein ganzes leben einen schandflek“ tragen, der ihn zeitlebens „an einer guten heyrath hindert[e]“.10 In Stapfers konservativer Abhandlung war es somit nicht vordringlich die Aufgabe des Staates, ehefördernde Maßnahmen zur Bevölkerungsvermehrung zu betreiben. Im Vordergrund stand die Obliegenheit der Eltern, die Eheschließungen ihrer Kinder in patriarchaler Manier zu kontrollieren, restriktiv zu verwalten und in die richtigen Bahnen zu lenken. Dazu sollten Väter und Mütter – nicht die Regierung – Rahmenbedingungen schaffen, damit sich die Kinder bei Tag treffen konnten. Die Eltern der potenziellen Eheleute sollten sich vorgängig kennen. Als einzige ehefördernde Maßnahme schlug der Pfarrhelfer von Oberdiessbach die Aufweichung der örtlichen Endogamie vor. Erhöhte eheliche Mobilität würde dazu führen, dass weiterhin standesgerecht geheiratet werden könnte. Denn aufgrund der streng eingehaltenen lokalen Endogamie war es für reiche Bauern schwierig, dem „sohne ein weib von seinem stande zu finden, weil ihm keine töchtern, als die von seiner gegend bekannt sind, und auf dem lande heyrathen sich die reichen eben so ungerne an ärmere, als in den städten.“11
Stapfers tendenziell konservative Stimme war aber trotz der Auszeichnung mit einem Preis durch die Gesellschaft in den 1760er Jahren in Bern nicht die dominante in bevölkerungspolitischen Fragen. Nachdem in dieser Zeit der bevölkerungspolitische Diskurs von der Angst beherrscht wurde, die Landbevölkerung sei in drastischer Abnahme begriffen, kamen in der Oekonomischen Gesellschaft Berns allerdings bereits gegen Ende der 1770er Jahre breiter abgestützte Zweifel an dieser Annahme auf. Die anhand sozialhistorischer Analysen konstatierte Lücke in Berns Bevölkerung, die ein nachholendes Bevölkerungswachstum nach sich zog, wurde zwischen ca. 1750 und 1770 allmählich geschlossen. Das zeitlich verschobene Wachstum führte dazu, dass um 1770 die Bevölkerung auch in Bern merklich zu wachsen begann. Denn jetzt war das Bevölkerungsdefizit, das die Rote Ruhr 1750 verursacht hatte, ausgeglichen und die Bevölkerung wuchs über den Umfang vor 1750 hinaus. Dadurch offenbarte sich im Kanton Bern dasselbe demographische Phänomen wie in der restlichen Eidgenossenschaft: Die Differenz zwischen Geburten- und Sterberate entwickelte sich zu Gunsten eines anhaltenden Wachstums.12
Das für Bern neuartige Bevölkerungswachstum, das das Trauma der Roten Ruhr, die Furcht vor drohender wirtschaftlicher Stagnation und die Angst vor schwindender militärischer Stärke in der öffentlichen Diskussion in den Hintergrund treten ließ, nahmen die Zeitgenossen etwas verzögert wahr. 1778 überlegte die Oekonomische Gesellschaft in einer ihrer Sitzungen, eine Preisfrage auszuschreiben, deren Inhalt nahelegt, dass das Wachstumsphänomen im Kreis der Sozietät durchaus registriert wurde. Man war sich in den Reihen der Gesellschaft nicht mehr sicher, ob die gegenwärtige Wirtschafts- und Bevölkerungspolitik der Regierung immer noch den aktuellen Bevölkerungszuständen im Territorium entsprach. Damit stand die Frage zur Debatte, ob eine große Bevölkerung wirklich automatisch zu einer prosperierenden Wirtschaft, militärischer Stärke und in der Folge zur maximalen Glückseligkeit im Sinne des Wohlstands eines Volks führte – oder aber eine Bedrohung für die Versorgungslage Berns darstellte. Gefährdete nicht gerade der drohende Versorgungsnotstand, den eine über die agrarischen Ressourcen hinauswachsende Bevölkerung erwarten ließ, die Zufriedenheit der Untertanen und damit die Stabilität der politischen Ordnung und Ruhe? Zwar vertagte die Gesellschaft eine Entscheidung über die Beantwortung dieser Frage.13 Die Debatte in der Sozietät offenbart jedoch, dass die zuvor von Entvölkerungsängsten genährte Stimmung aufgrund der Erfahrungen, die seit den 1770er Jahren mit dem aufholenden Wachstum in Bern gemacht wurden,14 langsam umschlug: Aus versorgungspolitischen Erwägungen begann man, sich zunehmend vor der Überbevölkerung zu fürchten. Inwiefern auch die Hungersnot von 1770/71 eine Rolle für diese Wende im bevölkerungspolitischen Diskurs spielte, darüber lässt sich hier im Zusammenhang mit Bern nur mutmaßen. In Bezug auf die gesamte Schweiz hat Rudolf Braun erwähnt, dass die Versorgungskrise zwischenzeitlich zu einer steigenden Zahl besitzarmer und -loser Menschen geführt hatte und sich deswegen die kritischen Stimmen zumindest mittelfristig mehrten.15 Fest steht, dass Karl Ludwig von Haller in seinem Gutachten zu den Wettschriften „Nahrungssorgen“ thematisierte und als Resultat einer zu stark anwachsenden Unterschicht interpretierte.16 Dieser in Bern in den 1770er Jahren vorerst angedeutete Wandel in der öffentlichen Bevölkerungsdebatte stellte keinesfalls ein lokales oder lediglich eidgenössisches Phänomen dar. Die geschichtswissenschaftliche Literatur zeigt, dass in den bevölkerungspolitischen Ansichten am Ausgang des 18. Jahrhunderts allgemein ein regelrechter „Paradigmenwechsel“ in Gang war.17 Dieser begann sich in Bern allerdings bereits zehn bis fünfzehn Jahre früher abzuzeichnen, als dies generell die Literatur veranschlagt.18