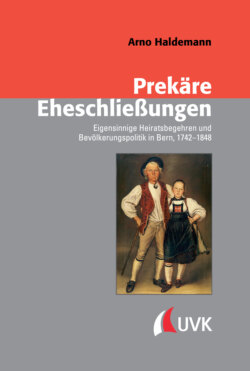Читать книгу Prekäre Eheschließungen - Arno Haldemann - Страница 5
2 Perspektive: Eheschließung als historischer Aushandlungsprozess
ОглавлениеAus geschichtswissenschaftlicher Perspektive stand bei der Verhandlung der zuvor erwähnten Fragen für die daran beteiligten Menschen, Gemeinschaften und Institutionen lange Zeit nicht weniger auf dem Spiel als die Herstellung und Verwaltung des einzigen legalen beziehungsweise ‚reinen‘ und privilegierten Ausgangspunkts für Paarbeziehungen, Sexualität und Fortpflanzung, Familie, Haushalt und Verwandtschaftsnetzwerke. Mit dem bevorzugten Stand der Ehe verband sich somit ein beachtlicher Teil der sozialen Ordnung. Diese Umstände kamen erst in den letzten beiden Jahrhunderten allmählich in Bewegung – und dies geschah nicht plötzlich, sondern erst allmählich, wobei die Ursachen dafür in der Geschichtswissenschaft nach wie vor umstritten sind.1 Mit dem Zentralereignis der Eheschließung waren so weitreichende Folgen verbunden, dass deren existenzielle Tragweite im Zusammenleben der historischen Subjekte kaum unterschätzt werden kann.2 Dies galt zumindest seit der Reformation in protestantischen Gebieten, weil es hier keine alternativen, zölibatären Lebenswege in geistlichen Diensten mehr gab.3 Die Heirat stellte in einer agrarischen Gesellschaft, die von Ressourcenknappheit und stark eingeschränkten Nahrungsspielräumen bestimmt war, den Schlüssel zu ökonomischen Vorteilen und rechtlicher Besserstellung schlechthin dar. Über die Ehe wurde Besitz zwischen Familien bewegt und zusammengeführt. Der Geburtsstand der Kinder, der weitreichende Folgen für ihre soziale Stellung und Erbfähigkeit hatte, war vom matrimonialen Status der Eltern abhängig.4 Die Eheschließung ermöglichte haushaltsökonomische Partnerschaft und stiftete dadurch immaterielle Solidarität, wirtschaftliche Sicherheit und Vorsorge in Zeiten von Krankheit und Arbeitslosigkeit sowie im Alter.5 Erst durch sie wurden spezifische Gefühle zulässig und möglich, die außerhalb der Ehe nicht für legitim erachtet wurden oder nicht zu realisieren waren. In ihr wurde die Sexualität für ‚rein‘ erachtet, während diese außerhalb des Ehebetts stigmatisiert und illegal war.6 Die Ehe war somit ein entscheidender Bezugspunkt frühneuzeitlicher Ehrvorstellungen. Die Eheschließung stellte für die längste Dauer der Neuzeit „eine ‚totale Tatsache‘“ im Leben historischer AkteurInnen dar, deren Realisation für die historischen Subjekte mit „Überlebenswille“ zu tun hatte, weil sie teilweise ihre grundlegendsten „Überlebensmöglichkeiten“ determinierte.7 Eine Eheschließung formte die Zukunftsaussichten von Individuen und Gemeinschaften umfassend und historisch stets in geschlechtsspezifischer Weise.8 Das beurteilen nicht nur Historiker*innen der Gegenwart so. Das sahen auch die zeitgenössischen Subjekte ähnlich, wenn sie beispielsweise formulierten, dass die Eheschließung „der wichtigste [Schritt]“ im Leben junger Menschen war.9 Folglich „begehrten“ die meisten Menschen den ehelichen Status und versuchten nachhaltig, sich diesen anzueignen.10
Die mit dem Begehren verbundenen Aneignungsversuche fanden nie in einem rechtsfreien Raum statt.11 Sie ereigneten sich in mächtigen zeitlichen Strukturen von lokalen Ehegesetzen und bevölkerungspolitischen Debatten, religiösen Vorstellungen und familiärer Verwandtschaftspolitik. Eheschließungen waren nicht nur begehrt, sondern auch „normiert, kontrolliert und umkämpft“, was offensichtlich auch heute noch so ist.12 Historisch betrachtet, waren sie Gegenstand von umfassenden kollektiven Ordnungsanstrengungen und obrigkeitlichen Normierungen, die im Zuge der Reformation aufgrund der Bekämpfung von klandestinen Ehen gegen den elterlichen Willen auch in katholischen Gebieten eine Intensivierung erfuhren.13 Und so gab es zahlreiche moralisch und ökonomisch begründete und gesetzlich kodifizierte Bestimmungen, die den Zugang zur Eheschließung und legitimen Sexualität begrenzten. Diese Normen strukturierten auch das Zustandekommen der Ehe, also die Form von Eheschließungen.14 Die Ehegesetze nahmen Einfluss auf die Eheführung und Geschlechterordnung und unterwarfen sie der Kontrolle der Ehegerichte. Daneben bestanden moralische, gewohnheitsrechtliche Vorstellungen lokaler Gemeinschaften und Familien, die aus dem „sozialen Nahraum“ laufend vergegenwärtigt und zum Teil in disziplinarischer Weise eingefordert wurden.15 Nicht zuletzt hatten auch die Moraltheologen der Kirche ihre Ideen von der gottgefälligen Ehe und ihrer Herstellung.16 Alle diese Faktoren formierten den multinormativen historischen Kontext der Eheschließung.17
Dennoch konstituierten Eheschließungen, vielseitigen und komplexen gemeinschaftlichen Interessen sowie Begehrlichkeiten zum Trotz, nie nur, aber letztlich immer auch Face-to-Face-Beziehungen. Darin entsprachen sie oft nicht den gesetzlichen Bestimmungen oder standen im Widerspruch zu gewohnheitsrechtlichen Idealen in lokalen Gemeinschaften. Sie konnten in Konflikt mit der Verwandtschaftspolitik der Familie geraten. Zum Teil befanden sie sich in Spannungen mit zeitgenössischen Moralvorstellungen oder stellten eine Bedrohung für gemeinschaftliche Ressourcen dar.18 Gleichzeitig konnte die Auffassung einer moralischen Ökonomie von ländlichen Gemeinschaften mit den bevölkerungspolitischen Absichten der städtischen Obrigkeit kollidieren.19 Eheschließungen waren somit „auf konstitutive Weise uneindeutig“.20 Sie oszillierten stets zwischen individuellen Bedürfnissen und Interessen unterschiedlicher Kollektive. Die Ambivalenz und Konfliktträchtigkeit, die ihnen inhärent war, begründete ihre außerordentliche gesamtgesellschaftliche „Politizität“.21 Aufgrund der weitreichenden sozialen Implikationen der Eheschließung wurde ihr Wesen kontinuierlich und zwischen ganz unterschiedlichen AkteurInnen, Gemeinschaften und Institutionen ausgehandelt.22 Das hing gerade mit dem Umstand zusammen, dass die einzelne Eheschließung in ihrem Vollzug vielfach nicht mit den gemeinschaftlichen Normvorstellungen und Ehegesetzen zur Deckung kam.23 Die vielfältige Praxis der Eheschließung erschöpfte sich nämlich keinesfalls in der Erfüllung der Normen.24 Und so existierten nicht nur zu jeder Zeit spezifische Ehevorstellungen, die entlang bestimmter „politisch-historische[r] Phasen und Konjunkturen“ verliefen.25 Daneben herrschten bereits in der jeweiligen Zeit zwischen den an der Herstellung von Ehe beteiligten AkteurInnen und Institutionen sehr unterschiedliche ideelle und praktische Assoziationen mit der Eheschließung in Bezug auf ihren Sinn und ihre Funktion. Die unterschiedlichen praktischen Interpretationen und Ausgestaltungen der Eheschließungen standen dabei oftmals in Konkurrenz zueinander. Die am praktischen Aushandlungsprozess der Ordnung beteiligten AkteurInnen konnten mit einer Eheschließung sehr unterschiedliche Interessen und Absichten verbinden. Verlobte, Nachbarn, Verwandte und die Obrigkeit mussten deshalb in der Praxis gemeinsam elaborieren, was in Bezug auf die Konstitution der Ehe ihren gesellschaftlichen „common ground“ bilden sollte.26 Während die heiratswilligen AkteurInnen eine grundlegende Verbesserung ihrer Lebenssituation anstrebten oder Heiratsunwillige im Fall einer Eheklage eine Verschlechterung derselben abzuwehren gedachten, versuchten Gemeinden und Korporationen den Zugang zu kollektiven Ressourcen und deren Belastung durch Unterstützungsbedürftige und Fremde zu begrenzen. Familien betrieben mit der gezielten Verheiratung ihrer Angehörigen Verwandtschaftspolitik. Dieser musste der individuelle Wille eines einzelnen Mitglieds untergeordnet werden.27 Die Familien sicherten damit ihren Besitz ab und erweiterten oder erschlossen neue Netzwerke, die ihnen Zugang zu Ressourcen in Aussicht stellten.28 Die Obrigkeit versuchte mithilfe von Ehegerichten und über Ehebewilligungen sowie -verbote spätestens ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur aus moralisch-religiösen, sondern vor allem auch aus bevölkerungspolitischen Gründen das Reproduktionsverhalten der Untertanen zu steuern.29 Dies erzeugte Konflikte zwischen Individuen, kommunalen Gemeinschaften und der territorialen Obrigkeit, die der Schlichtung und Mediation bedurften.