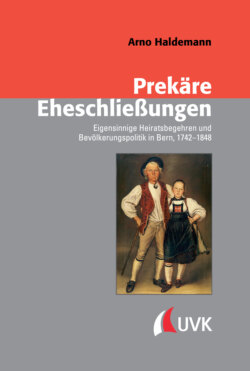Читать книгу Prekäre Eheschließungen - Arno Haldemann - Страница 6
3 Gegenstand: ‚Von den Rändern‘ der Gesellschaft in die Mitte der Staatsbildung
ОглавлениеDie vorliegende Arbeit widmet sich den beschriebenen vermittlungsbedürftigen Konflikten, die in Zeiten des Umbruchs in besonders intensiver Weise geführt wurden. In Transformationsphasen wurden die Ordnungsprinzipien einer Gesellschaft zeitlich konzentriert herausgefordert, weil herkömmliche Normen häufiger und stärker strapaziert und in Frage gestellt wurden.1 So waren Zeiten tiefgreifender Wandlungsprozesse immer auch „Zeiten intensiver Beschäftigung mit der Ehe“, da sie im Zentrum sozialer und geschlechterspezifischer Ordnung stand.2
Mit einem von der Geschichtswissenschaft als solche Transformationsphase klassifizierten Zeitabschnitt, der sogenannten ‚Sattelzeit‘, beschäftigt sich die vorliegende Studie.3 Sie widmet sich der Erforschung der Eheschließung im Gebiet der ehemals mächtigen und wohlhabenden reformierten Stadtrepublik Bern zwischen ausgehendem Ancien Régime und Bundessstaatsgründung (1848).4 Dabei verfolgt sie das Ziel in einem lokalen Kontext im Rahmen der historischen Ehe- und Familienforschung mit einem praxeologischen Ansatz zu einer differenzierten Einschätzung der Genese der modernen Familie zu gelangen und etablierte Meinungen dazu kritisch zu hinterfragen.5
Die reformierte Stadtrepublik – nota bene „die grösste nördlich der Alpen“ im Ancien Régime,6 deren Territorium bis zu ihrem Untergang ca. ein Drittel der Fläche der Eidgenossenschaft ausmachte7 – bietet sich am Übergang vom Ancien Régime zum 19. Jahrhundert innerhalb der Eidgenossenschaft als besonders vielversprechender und relevanter Untersuchungsraum an, nicht zuletzt weil dem Gebiet von der Geschichtswissenschaft immer wieder ein ambivalentes Verhältnis zur Moderne nachgesagt wird. Es scheint unklar und eine Frage der historiographischen Perspektive zu sein, wann und in welcher Weise diese in Bern eigentlich einsetzte.8 Im späten Ancien Régime waren die Verhältnisse in der gesamten Alten Eidgenossenschaft, zu deren 13 Mitgliedstaaten Bern seit 1353 durch multi- und bilaterale Bündnisverträge gehörte,9 von einem spannungsreichen Nebeneinander einerseits verfassungspolitischer Stagnation und andererseits sozialer und wirtschaftlicher Dynamik geprägt. Soziale Ungleichheiten akzentuierten sich in Stadt und Land und auch zwischen diesen Kulturräumen. An den meisten Orten wuchsen Bevölkerung und Wirtschaft. Ressourcenknappheit nahm zu und mit ihr Verteilungs- und Nutzungskonflikte. Das Konsumverhalten der Menschen veränderte sich, Wissen und Ideen wurden von neu entstehenden Bildungsinstitutionen und durch zunehmende Öffentlichkeit multipliziert. Dennoch spielten sich diese dynamisierenden Prozesse in ständisch-korporativen und feudalen Strukturen ab.10 Innerhalb dieser Entwicklung stellte Bern eher die Regel als die Ausnahme dar. So sei gerade Bern im 18. Jahrhundert in der Eidgenossenschaft zum „Inbegriff des aristokratischen Ancien Régime“ geworden,11 das sowohl Elemente sozioökonomischer Dynamik wie politischer Stagnation integrierte.
Das sehr große und vor allem agrarisch geprägte Territorium, das bis 1798 die Untertanengebiete Aargau und Waadt miteinschloss, erstreckte sich im 18. Jahrhundert vom Jura im Norden über das Mittelland bis in die Alpen im Süden. Folglich war die große kulturelle und wirtschaftliche Diversität ein konstitutives Merkmal des ehemals mächtigen Kantons.12 Das Territorium von Bern beheimatete gegen Mitte des 18. Jahrhunderts über die zwanzigfache Bevölkerung (300‘000) der verhältnismäßig kleinen Stadt (weniger als 15‘000 Einwohner), von wo aus im 18. Jahrhundert ein selbstbewusstes und sich zunehmend verengendes städtisches Patriziat über ungefähr einen Drittel aller BewohnerInnen der damaligen Eidgenossenschaft regierte. So gilt Bern im 18. Jahrhundert nicht nur aufgrund seiner ausgeprägten innereidgenössisch militärischen Stärke neben Zürich als „Primus inter Pares“ innerhalb des Corpus Helveticum, sondern auch wegen seiner Ausdehnung und Bevölkerungsgröße.13 Die soziale Ungleichheit war auf dem Gebiet des Stadtstaats im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert stark ausgeprägt und erfuhr in Regionen ausbleibender Protoindustrialisierung sogar eine Akzentuierung. In der Landwirtschaft hing das ökonomische Wohlergehen von der Größe des Hofs ab. Während Großbauern durchaus wohlhabend sein konnten, waren Kleinbauern und landlose Tauner für ihr Auskommen auf Nebeneinkünfte aus gewerblichen Arbeiten angewiesen, die eng mit der Landwirtschaft verzahnt waren.14 Die Nebenerwerbe wurden vor allem in der Textilindustrie erzielt. Diese produzierte primär Leinwand – sowohl für den heimischen Markt als auch für den Export vor allem nach Frankreich, wo aus Flachs in Heimarbeit Garn gesponnen wurde.15
Bis zur Abdankung von Schultheiß, Rät und Burger im Zuge der Invasion französischer Truppen im Rahmen der Helvetischen Revolution bestimmte im 18. Jahrhundert eine seit dem Abschluss des Burgerrechts 1651 immer schmaler werdende Machtelite die politischen Geschicke von Bern. Während der Große Rat ursprünglich die Versammlung aller Burger von Bern darstellte, wurde dieser im Verlauf der Frühen Neuzeit zu einem vollzählig 299 Ratsherren umfassenden Repräsentationsorgan der Bürgerschaft, der nur noch ergänzt wurde, wenn die Zahl der Räte unter 200 fiel. Das war seit 1683 noch ungefähr alle zehn Jahre der Fall.16 In Zahlen ausgedrückt bedeutete das, dass weniger als 27% der Bevölkerung der Stadt Bern oder 1 % der gesamten Bevölkerung des Territoriums über die Menschen in Stadt und Kanton regierte. Dabei verengte sich der Kreis der regimentsfähigen Familien immer rapider, während gleichzeitig immer weniger dieser regierungsbefugten Geschlechter tatsächlich Einsitz in der Regierung nahmen. Die Ratssitze wurden durch ein komplexes Mischverfahren von Kooptation und Wahlen besetzt.17 Zwar vermochte sich der Große Rat seine Souveränität gegenüber dem Kleinen Rat in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts noch zu verbriefen. Dennoch verlagerte sich das Machtgefälle des auf Ausgleich ausgelegten Politsystems zwischen den beiden Räten zu Ungunsten des Großen Rats. An der Spitze der aristokratisch organisierten Stadtrepublik standen die beiden vom Großen aus dem Kleinen Rat auf Lebzeiten gewählten stillstehenden und amtenden Schultheißen, die sich jährlich in ihren jeweiligen Aufgaben abwechselten. Der Kleine Rat setzte sich aus 27 Mitgliedern zusammen, die vom Großen Rat gewählt wurden. Sie bestimmten die Traktanden des Großen Rats und verfügten durch ihre täglichen Zusammenkünfte über einen wesentlichen Informations- und Wissensvorsprung gegenüber der großen Ratskammer.18 Trotz dieser ausgeprägten Machtkonzentration gelang es der Berner Obrigkeit nicht, vereinheitlichte Verwaltungsstrukturen auf der Landschaft zu implementieren. So zeichnete sich das Territorium durch eine Vielzahl unterschiedlicher Herrschaftsverhältnisse und Partikularrechte aus, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Bestand hatten. Auch neue Abgaben waren von der Obrigkeit kaum durchzusetzen.
Ausgehend von dieser Skizze der politischen und sozio-ökonomischen Verhältnisse in Bern am Ausgang des 18. Jahrhunderts wird hier einerseits präsupponiert, dass die zwischen ca. 1700 und 1850 veranschlagte Zeit auch für Bern eine Episode ähnlich tiefgreifender Veränderungen war, wie es die ursprünglich begriffsgeschichtliche Konzeption der Sattelzeit in einem größeren räumlichen Kontext plausibel gemacht hat. Ereignis- und verfassungsgeschichtlich steht dies außer Frage: Bern verwandelte sich in diesem Zeitraum von einem reformierten, tendenziell reformabsolutistisch organisierten souveränen Stadtstaat, der unter dem Ancien Régime von einem oligarchischen Patriziat regiert wurde, über die Helvetik (1798–1803), die Mediation (1803–1815), die Restauration (1815–1831) und die Regeneration (1831–1848) in einen demokratisch organisierten Kantonsteil des föderalistischen Schweizerischen Bundesstaats (ab 1848), der weitgehend säkularisiert war – die Eheschließung stellte nota bene eine Ausnahme dar.19
Von einer fundamentalen Veränderung im veranschlagten Zeitraum auszugehen, legt zudem nicht nur die Verfassungsgeschichte, sondern auch die Wirtschafts- und Sozialgeschichte nahe. Sie wähnt das damalige Gebiet von Bern in diesem Zeitraum zumindest in einem „Strom der Modernisierung“, also in zügiger Bewegung.20
Bezüglich der Eheschließungspraxis hat die internationale und schweizerische Verwandtschaftsforschung auf die Zunahme von Heiraten in nahen Verwandtschaftsgraden als Ausdruck fundamentaler struktureller Veränderungen hingewiesen.21 Und Foucault hat mit seinen diskursanalytischen Auseinandersetzungen zur sogenannten ‚Gouvernementalität‘, also zur Regierungslogik, längst auf die Bedeutung der Überschreitung der „biologische[n] Modernitätsschwelle“ im 18. Jahrhundert aufmerksam gemacht.22 Wie noch zu zeigen sein wird, fand die Überwindung dieser Schwelle um die Jahrhundertmitte auch in Bern schrittweise statt und hatte großen Einfluss auf die Konzeption, Verwaltung und Praxis der Eheschließung.
Dennoch soll die begriffsgeschichtliche Qualifizierung der Sattelzeit in ihrem empirischen Gehalt aber nicht überschätzt werden.23 Stattdessen wird untersucht, „was von den […] strukturellen Änderungen dieser Epoche eigentlich wie ‚unten‘ […] ankommt“, beziehungsweise vor allem wie in umgekehrter Richtung das Verhalten von ‚unten‘ strukturelle Veränderungen evoziert.24
So möchte die vorliegende Arbeit zu einer differenzierteren Betrachtung des konstatierten Wandels beitragen. Dazu untersucht sie die Eheschließung im Spannungsverhältnis von Norm und Praxis im spezifischen Kontext der Stadtrepublik Bern. Dieser räumliche Zusammenhang umfasst die Stadt und das Territorium beziehungsweise das Kantonsgebiet, das sowohl Landstädte als auch ländliche Dörfer und Bergregionen einschließt. Dadurch wird weder der urbanen noch der agrarischen Kultur der Vorzug gegeben, sondern sie werden zusammen und in Wechselwirkung betrachtet. Dank diesem Zugang geraten die Eheschließungsversuche von Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten, sozialen Stratifikaten und Berufen ins Blickfeld der Analyse.