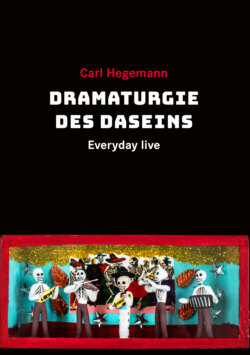Читать книгу Dramaturgie des Daseins - Carl Hegemann - Страница 11
Glücklich im Unglück
ОглавлениеParadoxien des Genießens
Das Glück ist eine leichte Dirne,
Und weilt nicht gern am selben Ort;
Sie streicht das Haar dir von der Stirne
Und küßt dich rasch und flattert fort.
Frau Unglück hat im Gegenteile
Dich liebefest an’s Herz gedrückt;
Sie sagt, sie habe keine Eile,
Setzt sich zu dir an’s Bett und strickt.
(Heinrich Heine)
Nicht nur Heine in seiner Matratzengruft, selbst Goethe, das Weltkind und der Liebling der Götter, hielt Glück für einen ausgesprochen flüchtigen Zustand. Die glücklichen Momente in seinem Leben ließen sich an einer Hand abzählen, gab er als alter Mann zu Protokoll, dabei hatte er an »leichten Dirnen« bis ins hohe Alter keinen Mangel. (Es nagte an ihm, weil er seine Leistung für die Menschheit nicht in seinen Dichtungen sah, deren Wert er eher für gering erachtete, sondern in seiner revolutionären Farbenlehre, die aber niemanden interessierte.)
Wenn man die Flatterhaftigkeit und Vergänglichkeit des Glücks für seine wichtigsten Merkmale hält und trotzdem das Glück in den Mittelpunkt seiner Bestrebungen stellt, kommen etwas triviale Theorien dabei heraus, wie sie vorzugsweise unter Gymnasiasten kursieren: Das Leben ist eine lange dunkle Straße, die nur an wenigen Stellen durch Laternen erleuchtet wird. Und die Aufgabe, die man im Leben hat, ist, möglichst schnell von einer Laterne zur nächsten zu kommen. Das heißt sich immer dann zu verabschieden, wenn Dunkelheit und Kälte drohen, und schnell wieder Licht und Land zu finden.
Solche Vorstellungen sind wahrscheinlich etwas für eher einfachere Gemüter. Überhaupt sehen viele im »Glücksgebimmel« (F.-P. Steckel) nur eine Ablenkung von den wirklich wichtigen Fragen. Komplexere Gemüter wie Karl Heinz Bohrer erklären Glück sogar für prinzipiell inexistent, weil Glück für Lebende nicht erreichbar und für Tote nicht erfahrbar sei. Sie sprechen vom Glück genauso wie Giorgio Agamben von der Erlösung. Sie sei zwar möglich, aber nur, wenn wir sie nicht mehr wollen. Weil Leben und Unerlöstheit untrennbar sind, ist Erlösung nur jenseits des Lebens vorstellbar. Aber wir können diesen Zustand der Erlösung nicht genießen, weil, wie es bei Kleist (im Prinz Friedrich von Homburg) heißt, »das Auge modert, das diese Herrlichkeit erblicken soll«. Deshalb sagt Agamben: »Erlösung ist möglich, aber nicht für uns.« Dauerhaftes Glück wäre so etwas wie Erlösung bei lebendigem Leibe. Diese paradoxe Vorstellung vollkommenen Glücks bei vollem Bewusstsein treibt die Menschheit nach wie vor um, ob sie sich nun in religiös fundamentalistischer Weise auf eine positive Transzendenz bezieht oder ob sie diesseitig liberalistisch oder sozialistisch angestrebt wird. Selbst große und kritische Denker gehen wie selbstverständlich von der Hoffnung auf ein dauerhaftes und allgemeines Glück aus, selbst wenn sie wissen, dass dies noch kein Sterblicher erfahren und keine bekannte gesellschaftliche Organisation ermöglicht hat. Die Denkanstrengungen, die sie unternehmen müssen auf der Suche nach dem Glück, sind in der Regel von anderer Qualität als die des Schönheitschirurgen oder des Genetikers, die ja auch an der Verlängerung oder Verewigung von Glück arbeiten und am »Abschied vom Jammertal«.
Ein radikales Beispiel für ein reflektierteres Glücksmodell findet sich bei Theodor W. Adorno, dessen Kryptoauswirkungen auf die Gegenwart wahrscheinlich gar nicht überschätzt werden können. Adorno hat dem Glücksbegriff, auch wenn er sicher nicht konstitutiv ist für seinen negativen Begriffsapparat, im Sinne der abendländischen Utopie zumindest am Ende seines Lebens einen entscheidenden Wert zugestanden, ohne wie sein Kollege Horkheimer den kritischen Impuls einer altersreligiösen Kehrtwende zu opfern.
In einem seiner letzten Aufsätze, Resignation, in dem Adorno sich 1969 gegen den Vorwurf seiner Studenten wendet, er habe resigniert, findet er das Glück, ja sogar das universelle Glück der Menschheit ausgerechnet im Denken des Unglücks:
Das Glück, das im Auge des Denkenden aufgeht, ist das Glück der Menschheit. Die universale Unterdrückungstendenz geht gegen den Gedanken als solchen. Glück ist er, noch wo er das Unglück bestimmt: indem er es ausspricht. Damit allein reicht Glück ins universale Unglück hinein. Wer es sich nicht verkümmern läßt, der hat nicht resigniert.
Nicht nur reicht Glück ins Unglück hinein, das dich nach Heine »liebefest an’s Herz gedrückt«, das heißt sich umfassend und auf Dauer bei dir einquartiert hat, das Glück wird durch die Anstrengung des Denkens nach Adorno auch selbst umfassend und dauerhaft: Die »leichte Dirne« wird sozusagen zur Ehefrau.
»Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend: Denken hat die Wut sublimiert. Weil der Denkende es sich nicht antun muß, will er es auch den anderen nicht antun.« Die Eiswüste der Abstraktion als Ort eines Glücks, das universal ist und darin besteht, sich nichts vorzumachen. Das ist ein zwiespältiges Modell. Zumindest für Menschen, die nicht im Denken ihren Hauptlebensinhalt sehen, scheint diese Konstruktion vollkommen unbrauchbar. Was macht man als Glück suchender Nichtphilosoph? Vielleicht geht man ins Theater. Ist Philosophie »ihre Zeit in Gedanken erfaßt« (Hegel), so fasst das Theater die Zeit in Bilder und Vorgänge. In der Tragödie bestimmt das Theater das Glück, indem es das Unglück ausspricht, vielleicht noch drastischer und deutlicher als dies im Bereich des reinen Denkens möglich ist. Und für den Regisseur Peter Stein war eine gelungene Tragödie, das Bild notwendigen Scheiterns, das »Glück, das [ihn] im Theater am Leben hält«. Zum Beleg kann die kleine Tragödientheorie aus seiner Goethepreisrede von 1988 dienen, die mich damals sehr beeindruckt hat:
Was man auch tut, was man auch unternimmt, führt grundsätzlich zu nichts Gutem. Diese Vorstellung, daß man im Grunde genommen nichts tun kann, und wenn man etwas tut, man im Verbrechen endet, diese entsetzliche Wahrheit müßte eigentlich zum sofortigen Selbstmord der Menschheit führen, wenn sie ernst genommen würde. Sie wird im Theater so schonungslos und rücksichtslos und so bewegend und so wahr durch Lüge zum Ausdruck gebracht, daß sich in der Tat eine – auch heute kann man so etwas noch herstellen – lähmende Hoffnungslosigkeit über den Zuschauerraum und über die Theatermacher selber herniedersenkt. Und dann gibt es seltsamerweise einen Moment, den kann man organisieren, aber er ist glückhaft, wenn er eintritt, einen Moment, in dem diese Hoffnungslosigkeit seltsamerweise umschlägt in die Bereitschaft, genau dieses Schicksal, diese Dichotomie der menschlichen Existenz auf sich zu nehmen, und zwar freudig und hoffnungsvoll. Das ist das Seltsame, das nennt man, glaube ich, in anderen Theorien Katharsis.
Ich weiß nicht, ob man dieses Bekenntnis als eine theaterbezogene Variante von Adornos Gedanken betrachten kann, aber die Produktion äußerster Vergeblichkeit als Basis eines »glückhaften« Umschlags in Freude und Hoffnung verweist zumindest auf eine gewisse Familienähnlichkeit zwischen dem Glück der Tragödie bei Peter Stein und dem glücklichen Unglücksbewusstsein bei Adorno.
Dass Erlösung für Sterbliche nicht zu haben ist und Scheitern nicht nur dazugehört, sondern unvermeidlich ist, kann offenbar auch im Theater Glück evozieren.
Dass es etwas gibt, das wir nicht im Griff haben, sondern das uns im Griff hat, ist nicht nur der Grund unseres Unglücks, sondern gleichzeitig ein Grund zu stetiger Freude. Die klassischen Dichotomien, die dahinterstecken, wie »Selbst und Welt«, »Form und Stoff«, »Freiheit und Determination« sind offenbar nicht totzukriegen.
Auch die Dekonstruktivisten, die solche Dualismen als konstitutive Form beseitigen und nur noch Monismen und Vielheiten oder die »différence« untersuchen wollten, kehren in entscheidenden Situationen wieder zu tragödienkonstitutiven Antinomien zurück. Beim späten Derrida zum Beispiel kehrt der Dualismus wieder als Antinomie von Gleichheit und Alterität. Alle Menschen sind gleich und trotzdem ist jeder anders als alle anderen. Derridas ganzes Demokratiemodell basiert auf diesem Gegensatz, den er »tragisch« nennt:
Keine Demokratie ohne Achtung vor der irreduziblen Singularität und Alterität. Aber auch keine Demokratie […] ohne Berechnung und Errechnung der Mehrheiten, ohne identifizierbare, feststellbare, stabilisierbare, vorstellbare, repräsentierbare und untereinander gleiche Subjekte. Diese beiden Gesetze lassen sich nicht aufeinander reduzieren; sie sind in tragischer und immer verletzender Weise unversöhnbar.
Aber Derrida bleibt sich trotz seiner Rückkehr zum Dualismus treu und erweist sich vielleicht gleichzeitig als einer von Adornos konsequentesten Schülern. »Was einmal gedacht ward, kann unterdrückt, vergessen werden, verwehen. Aber es läßt sich nicht ausreden, daß etwas davon überlebt. Denn Denken hat das Moment des Allgemeinen«, schreibt Adorno gegen die Resignation. Und dieses Überleben, das »weder vom Leben noch vom Sterben abgeleitet« ist, ist auch das letzte Thema Derridas. In einem Interview kurz vor seinem Tod führt er Adornos Glücksreflexion auf eine sehr persönliche und doch allgemeine Weise weiter und über sich selbst hinaus. Aus dem Raum des Denkens und des Theaters kommt er zurück zum gewöhnlichen Leben und damit zum Tod:
Nie werde ich derart von der Notwendigkeit zu sterben heimgesucht als in den Augenblicken des Glücks und des Genießens. Genießen und den ungeduldig lauernden Tod beklagen, das ist für mich ein und dasselbe.
Genuss verwandelt sich in Klage. Aber die Klage ist Genuss. Und das Unglück wird als Glück erfahrbar:
Wenn ich mir mein Leben in Erinnerung rufe, bin ich geneigt zu denken, daß ich das Glück und die Chance gehabt habe, selbst die unglücklichen Momente meines Lebens zu lieben und für sie dankbar zu sein (sie zu segnen). Fast alle, von einer Ausnahme abgesehen. Und wenn ich mir die glücklichen Momente in Erinnerung rufe, so bin ich auch für sie dankbar (segne ich natürlich auch sie), gleichzeitig drängen sie mich jedoch dem Gedanken an den Tod, dem Tod entgegen, denn es ist vergangen, vorbei …
Für Derrida ist die Fähigkeit zum Glück, die unglücklichen Momente des Lebens »lieben« zu können, von der Theorie ins tägliche Leben übergegangen, mit »einer Ausnahme«, sonst wäre diese Transformation ein bloßer Automatismus. Nur mit den glücklichen Momenten hat er Probleme: Sie sind nicht wirklich glücklich, weil sie stark an den Tod gekoppelt sind, weil sie als Momente, in denen nichts fehlt, in denen alles eins wird (hen kai pan), auf den Abschied von der Dualität verweisen, die unser Dasein in der Welt ausmacht. Das deutet darauf hin, dass wir mit dem Unglück offenbar ganz gut zurande kommen können. Wir müssen aber noch lernen, mit den glücklichen Momenten umzugehen. »Genießen als Chance«, »Erfolg als Chance«, »Glück als Chance«: So lauten die wahrscheinlich heute subversiveren Parolen. Deshalb heißt es noch gar nicht viel, wenn wir uns Derrida als glücklichen Menschen vorstellen. Glück ist kein Ziel, sondern nur eine Chance, genau wie der Tod, der Abschied allen Abschieds. Von diesem Abschied haben wir keine Ahnung und keine Meinung. Das ist kein öffentliches Thema unserer Kultur. Auch den Tod als Chance zu sehen, fällt schwer, ist aber vielleicht das Beste, was uns bei lebendigem Leibe passieren kann.
Brecht ist einer der wenigen nicht religiösen Dichter, die auch hier noch weiter gedacht haben, wie die folgenden Zeilen aus seiner »Sterbelehre«, dem Badener Lehrstück vom Einverständnis, zeigen: »Habt ihr, die Wahrheit vervollständigend die Menschheit verändert, so verändert die veränderte Menschheit. Gebt sie auf! Marschiert! Ändernd die Welt, verändert euch! Gebt euch auf! Marschiert!« Vorwärts und nicht vergessen: den Tod.