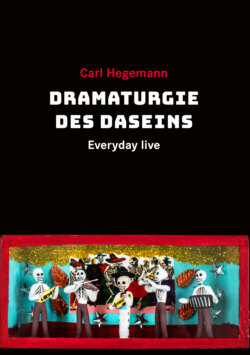Читать книгу Dramaturgie des Daseins - Carl Hegemann - Страница 19
3.
ОглавлениеMit dem Ende der allmächtigen Herrscher scheint der Traum von der Allmacht ausgeträumt – in Europa spätestens mit der Französischen Revolution. Die Enthauptung Ludwigs XVI. im Januar 1793 markiert drastisch das Ende der verlängerten Allmachtsphase als Herrschaftsform. Die nachfolgenden Diktatoren und Alleinherrscher widerlegen das nicht, sondern bestätigen es eher, denn sie können sich nicht mehr auf ihre Gottgleichheit berufen, sondern müssen ihre Herrschaft mittels großer Ideale legitimieren, die beispielsweise nationalistisch oder sozialistisch (oder beides) sein können. Die Anfälligkeit der Menschen für totalitäre Herrschaft ist deshalb allerdings keineswegs aus der Welt – und die Trauer über den Verlust der Allmacht offenbar immer noch nicht überwunden. Vielleicht ist ein Ende der Trauer auch gar nicht möglich, solange die Menschen ihre schönste Zeit zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr verbringen.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Aufwertung, die das Ästhetische und die Kunst nach dem Ende des absoluten Königtums erfahren haben. Vielleicht ist es kein Zufall, dass Friedrich Schiller 1795, also zwei Jahre nach dem Tod des Königs auf der Guillotine, in seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen den Versuch gemacht hat, den Traum von der Allmacht zu retten, und zwar in der Kunst und durch die Kunst, die nach der Revolution und im Zuge der Aufklärung nicht mehr als Repräsentation von weltlicher und göttlicher Macht betrachtet wurde, sondern, wie es bei Schiller heißt, als »eine Tochter der Freiheit«. Mitten in der Welt der physischen Zwänge, die wir nicht beseitigen können, und der menschlichen Gesetze, die wir uns zwar selbst gegeben haben, die uns aber ebenfalls streng beschränken, forderte er ein »drittes, fröhliches Reich«, das der »ästhetische Bildungstrieb«, den er gerne auch »Spieltrieb« nannte, hervorbringen sollte, ein Reich, in dem den Menschen »die Fesseln aller Verhältnisse« abgenommen und sie »von allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen« entbunden sind. Das klingt nach Allmachtsanspruch und nicht nach der »moralischen Anstalt«, die man mit Schiller gerne verbindet. Schiller fordert eine Freiheit für die Kunst, die sich durch nichts beschränken lassen muss. Dieser Gedanke ist bis heute entscheidend für die Kunstpraxis geblieben: »Kunst zu machen bedeutet zu verfügen, dass die Dinge so und nicht anders sein sollen – und zwar ohne jede ›objektive‹ Begründung«, schreibt Boris Groys in seinem Kommunistischen Postskriptum. Was Schiller wie Groys für die Kunst einfordert, scheint exakt »dem traumhaften, poetischen Lebensgefühl, dem keinerlei Grenzen und Restriktionen gesetzt waren«, zu entsprechen, das Sagan bei den frühen Königen gefunden hat – allerdings mit einem wichtigen Unterschied.
Wollte Schiller den allmächtigen Herrscher mittels Kunstpraxis wieder einführen? Haben Hitler und Stalin Schiller so verstanden? Der Staat als Kunstwerk? Ist Schiller der Vorläufer und Ideengeber für die totalitären Verhängnisse des letzten Jahrhunderts? Es gibt Leute, die seine Briefe tatsächlich so verstehen wollen (zum Beispiel Paul de Man). Dazu muss man den Staat nur als Kunstwerk und den oder die Herrschenden als Künstler betrachten. Aber einen solchen Ansatz zur Legitimation von totalitärer Herrschaft gibt es in Schillers Vorstoß zu einer freien Kunst gerade nicht (und bei Groys auch nicht). Denn in demselben Brief, dem 27. und letzten, in dem Schiller diese Freiheit von allen physischen und moralischen Zwängen, von der Schwerkraft und von jeder allgemeinen Gesetzgebung fordert, macht er auch klar, dass dieses Reich der Kunst das Physische und das Sittliche nicht vereinigen oder ersetzen kann und soll. Die Auflösung des Widerspruchs und die totale Freiheit sollen nur als ästhetische stattfinden, und zwar in einer Schein- und Spielwelt, die von den Künstlern und den Rezipienten auch als solche wahrgenommen wird. Das ist der Unterschied zur Allmacht der Könige.
Was Schiller vorschwebt, könnte man als Musterbeispiel für eine Heterotopie ansehen, wie sie Foucault später beschrieben hat: als abgeschlossenen Ort, der zwar ein Teil der Welt ist, an dem aber all das erlaubt und möglich ist, was in der Welt sonst verboten und unmöglich ist, also als einen Ort, wo dieses sonst Verbotene oder Unmögliche sich autonom entfalten kann. Die Autonomie der Kunst ist auf diesen Ort beschränkt, nur dort kann sie sich als »Spiel« realisieren – in einer Sphäre des »ästhetischen Scheins«. Sie darf sich nicht mit der wirklichen oder wirkenden Welt verwechseln oder mit ihr verwechselt werden. Das Verbotene wird nur gespielt, die Allmacht der Künstler ist nur ästhetischer Schein, und alle, die daran teilnehmen, der Stab und die Schauspieler, aber auch die Zuschauer, wissen wie Schiller, dass das Menschenleben beschränkt und ohnmächtig ist und dass wir, solange wir leben, keine ganzen Menschen sein werden. Wenn Schiller also behauptet, »der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt«, dann heißt das, dass es die vollständige Realisierung seines Wesens in der wirklichen physischen Welt sterblicher Menschen nicht geben kann, sondern nur im Spiel, nur als ästhetisches Ereignis. Das ist die Tragik der Kunst und speziell des Theaters, seine offensiv vertretene Nutzlosigkeit und Zweckfreiheit haben hier ihren Grund. Nichts, was auf der Bühne passiert, nichts, was ein Künstler als Kunst generiert, greift funktional in die Prozesse des täglichen Lebens ein. Schiller wird nicht müde zu betonen, dass der ästhetische Schein in der wirklichen Welt nichts zu suchen hat und dass die wirkliche Welt als Funktionssystem nichts in der Kunst zu suchen hat. Die ästhetischen Freiheiten des schönen Scheins zum politischen Programm zu erklären, um die Welt nach ästhetischen Kategorien zu perfektionieren, ist kein Weg zur Befreiung, sondern markiert den Beginn totalitärer Gewalt.
Gerade im Theater herrscht deshalb ein verschärftes Gewaltverbot. Weil man sich im Spiel auf menschliche Abgründe, auf ungebändigte Natur, auf unwahrscheinliche Sensationen einlässt und das, was einem sonst einfach passiert, autonom produziert, bedarf es großer Sachlichkeit und Nüchternheit bei der Herstellung dieser Kunstwerke. Gewaltexzesse und Psychoterror, Intimität und Verrat auf die Bühne zu bringen, ist leichter, wenn außerhalb der Bühne und bei der Herstellung des Kunstwerks (bei den Proben) Vorsicht und Rücksicht herrschen, auch wenn sich Parallelen zwischen Kunst und Leben nicht immer fein säuberlich trennen lassen. Die Exzesse der Kunst und speziell des Theaters lassen sich nur diszipliniert und möglichst unabhängig von der eigenen Triebstruktur realisieren, das unterscheidet sie strukturell von den Exzessen der Könige, die Sagan beschreibt. Die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, das man selbst ist, ist für die Akteure des Ästhetischen eine große Herausforderung und führt zu starken physischen und psychischen Belastungen, die als solche normalerweise nicht Teil des Kunstwerks sind. Ein Regisseur, der Unwahrscheinliches produziert, kann häufig nicht erklären und begründen, was er auf der Bühne oder vor der Kamera sehen will – und erst recht nicht, warum er es sehen will. Das muss keine Unfähigkeit sein, sondern mag gerade an der Fähigkeit des Künstlers liegen, etwas zu können, was sonst keiner kann. Das »Können des Nicht-Könnens«, wie Christoph Menke in seiner Theorie ästhetischen Handelns deutlich macht, das, wofür es (noch) keine Gebrauchsanweisung und -begründung gibt, dieses Segeln im Unbekannten, macht die Arbeit in der Kunst so reizvoll und gefährlich. Sie für den persönlichen Machterwerb in der wirklichen Welt auszunutzen, ist arm und kunstfeindlich. (Und – ist es wirklich nötig, das zu sagen? – niemand sollte sich das gefallen lassen, so sehr er auch bereit ist, sich auf der Bühne und in der Kunst in Ausnahmezustände und psychische wie physische Gefährdungen zu begeben.)
Die lebendige Kraft, die jenseits von Gut und Böse ist, die einfach ohne unser Zutun da ist, noch vor jeder Bestimmung – das Vorsubjektive, das Nicht-Identische, das Reale, das Dunkle oder wie man sie auch nennen will –, können wir in den Spiel- und Scheinwelten der Kunst ans Licht bringen, und dies ist wiederum nur dann möglich, wenn die Rahmenbedingungen rational geregelt sind und nicht mit dem Produkt verwechselt werden. Exzess und Disziplin bedingen einander. Das wusste schon Hölderlin: »Da wo die Nüchternheit dich verlässt, da ist die Grenze deiner Begeisterung.« Wer sich im Theater und in der Kunst auf seine Abgründe einlässt, braucht eine Verankerung, die es ihm ermöglicht, auch wieder herauszukommen. Je stärker diese Verankerung ist, desto tiefer kann er sich auf die Abgründe einlassen. Riskant bleibt es trotzdem, Kunst zu machen oder sich zum Material der Kunstpraxis eines anderen zu machen. Denn auch ein Regisseur, der kein Despot ist, muss im Umgang mit dem Material möglichst unbeschränkt sein können. Man erwartet von ihm, dass er tut, was er will – sogar ohne Begründung –, aber auch, dass er diese Freiheit auf das Spiel beschränkt. Letzteres bedeutet allerdings nicht, dass dadurch die Probebühne zum safe space würde. Die Herausforderungen der ästhetischen Praxis, die sich mit dem Leben beschäftigt, auch mit dem eigenen, können auch ohne Übergriffigkeiten und Machtmissbrauch tiefgehende seelische und körperliche Belastungen hervorrufen.