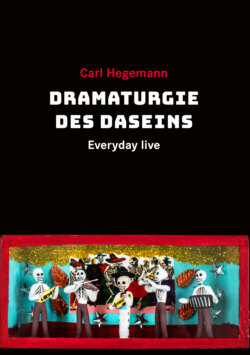Читать книгу Dramaturgie des Daseins - Carl Hegemann - Страница 15
ОглавлениеFlucht in die Kunst
oder: Der ideale Staat
Eben mal zwischen Volksbühnenabwicklung, Dernierenmarathon, dem großen Abschiedsfest und der letzten Gastspielreise nach Avignon den idealen Staat entwerfen? Für Theater heute? Mit nicht mehr als 7500 Zeichen? Kein Problem: Dem Dramaturgen in seiner berufsbedingten Vermessenheit ist nichts zu schwer und diese Aufgabe gehört, bei der Vielfalt seiner Tätigkeiten, vielleicht noch zu den leichteren.
Den idealen Staat gibt es nämlich schon. Man findet ihn im Bienenstock oder im Ameisenhaufen. Da läuft’s doch. Alles ist perfekt geregelt und greift ineinander wie in einer gut geölten Maschine. Und alle menschlichen Entwürfe eines idealen Staats laufen auf eine solche maschinelle Konstruktion heraus. Friedrich Hölderlin, der nebenbei auch ein tiefschürfender Staatstheoretiker war, behauptete allerdings, dass man von einer Maschine keine Idee haben kann und vom Staat also genauso wenig. »Nur, was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee«, schreibt er mit Hegel im Ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus. Und Maschinen, die sich ja grundsätzlich durch Berechenbarkeit definieren und zuverlässig Erwartbares produzieren, schließen genau deshalb jede Freiheit aus. Der ideale Staat ist daher ein Unding oder ein Unfug. Der Staat ist lediglich »die raue Hülse um den Kern des Lebens«, sagt Hölderlin. Und das Gegenteil von Freiheit. Im Systemprogramm wird sein Verschwinden gefordert: »[…] jeder Staat muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er nicht; also soll er aufhören.«
Dass sich ein Staat die Freiheit seiner Angehörigen zum Ziel machen kann, wird hier schlichtweg für unmöglich erklärt. Wenn er es trotzdem tut, ist es vermessen. Denn der Staat »darf nicht fordern, was er nicht erzwingen kann. Was aber die Liebe gibt und der Geist, das läßt sich nicht erzwingen. Das laß er unangetastet, oder man nehme sein Gesetz und schlag es an den Pranger!« Von den Menschheitsbeglückungs- und Veredelungsmaschinen in Tschernyschewskis Was tun?, dem Vorbild Lenins, bis zum digital vernetzten gerade in Kalifornien entstehenden »Homo deus«, der mit Hilfe künstlicher Intelligenz, universeller Überwachung und vollständiger Daten-Feedbackschleife jeden denkbaren Mangel überwinden und selbstverständlich als unsterblich gedacht werden soll, haben alle idealischen Modelle der Gesellschaftsorganisation diesen Haken: Sie wollen die menschliche Freiheit durch Rechnen erzwingen oder ersetzen. Wohin das führt, hat zwei Generationen nach Hölderlin Dostojewski schon gültig beschrieben. In den Aufzeichnungen aus dem Kellerloch formulierte Dostojewski vielleicht als Erster (noch vor Nietzsche und Bataille), welche Art von Widerstand solche institutionellen und kalkulierten Optimierungsstrategien mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auslösen: Wenn eine übergeordnete Institution wie der Staat weiß, was für die Menschen gut ist, und ihre Optimierung nach wissenschaftlichen Berechnungen vorantreibt, wollen die so beglückten Menschen nur noch eins:
beweisen, daß sie keine Drehorgelstifte sind, wenn sie nicht tun, was man von ihnen erwartet, sondern etwas Unsinniges. Darin besteht ihre ganze Kraft. […] Nach unserem eigenen uneingeschränkten und freien Wollen, nach unserer allerausgefallensten Laune zu leben – die zuweilen bis zur Verrücktheit verschroben sein mag? Das, gerade das ist ja jener übersehene allervorteilhafteste Vorteil, der sich nicht klassifizieren läßt und durch den alle Systeme und Theorien fortwährend zum Teufel gehen.
An diesem unvermeidbaren Impuls lebender Organismen, sich der Berechenbarkeit zu entziehen, scheitert regelmäßig, wer »den Staat zur Sittenschule machen« (Hölderlin) und das Glück verordnen will. Er scheitert nicht nur, er bewirkt das Gegenteil.
Deshalb kann es, anders als für Bienen und Ameisen, für Menschen keinen idealen Staat geben. Der Staat kann lediglich Rahmenbedingungen schaffen, die die Handlungsfähigkeit und Entfaltung, aber auch die Kontemplation und Empfindungsfähigkeit seiner Mitglieder möglichst wenig blockieren. Bewährt hat sich dabei im Kleinen das Modell »Republik Castorf« an der Volksbühne, die sich bis zu ihrem Ende nach 25 Jahren als streng hierarchischer und gleichzeitig vollkommen anarchischer Organismus reproduziert hat. Hier machte jeder, was er wollte, und unterwarf sich gleichzeitig dem, was Jonathan Meese als die »Diktatur der Kunst« bezeichnet hat, was nicht nur eine Metapher ist, sondern auch konkrete Herrschaftsverhältnisse zur Folge hat. Dieses Modell freier Selbstentfaltung und Selbstunterwerfung war aber nur möglich, weil es ein Außen hatte: Man konnte es jederzeit ohne allzu große Friktionen verlassen. Man arbeitete freiwillig an diesem Ort.
Den Staat im Großen, als das umfassende System, kann man aber nicht so ohne Weiteres verlassen, wenn er einem nicht mehr gefällt. Außer der kompletten Isolation, und die ist für Menschen nicht geeignet, findet sich auf der ganzen Welt keine Alternative zum Staat. Man findet nur unterschiedliche Staatsformen, aber keine entgeht dem Hölderlinschen Räderwerk-Verdikt, nicht mal die Demokratie. Und die Welt, wenn sie einem nicht mehr gefällt, kann man bei lebendigem Leibe überhaupt nicht verlassen. Insofern ist sie das ausbruchsicherste Gefängnis überhaupt. Das Recht auf Flucht, das die Volksbühne als frei produzierende Zwangsgemeinschaft überhaupt erst möglich gemacht hat, müsste eigentlich jeder Staat per Verfassung dekretieren, nur so wäre die Freiwilligkeit der Staatsangehörigkeit garantiert. Dieses Recht ist aber schwer zu realisieren, weil man nicht weiß, wohin man fliehen soll. Aus einem Staat kann man nur in einen anderen Staat fliehen, während man aus dem Theater fliehen kann, ohne zwangsläufig in einem anderen Theater zu landen. Das ist der Unterschied. Und deshalb kann man den Castorf-Staat nicht zum allgemeinen Modell machen. Es sei denn, man nähme das Theater als Heterotopie wirklich ernst, als einen Ort jenseits der staatlichen Ordnung, als einen Ort, an den man dem Staat entfliehen kann. Das »Recht auf Flucht«, das Alexander Karschnia im Geiste von Schlingensiefs Chance 2000 gerne in die Verfassung aufnehmen würde, ließe sich dann als Recht auf Flucht in das Theater (oder die Kunst) konkretisieren. Wer den Staat nicht aushält, flüchtet in die Kunst, und wer die Härten der Kunst nicht aushält, flüchtet aus der Kunst in den Staat. Das wäre eine glorreiche Perspektive, die auf einen Schlag die Alternativlosigkeit, die unser politisches Handeln seit einigen Jahrzehnten lähmt, in einen spannungsvollen und dynamischen Prozess verwandeln könnte. Man könnte nicht nur aus dem Theater flüchten, sondern auch ins Theater. Diese Möglichkeit des »Switchens« zwischen Kunst und Demokratie käme der tragischen menschlichen Verfasstheit, die sich in der Spannung zwischen Realität und Traum bewegt, sehr entgegen. Slavoj Žižek hat diese Spannung mit der ihm eigenen Konsequenz schon vor Jahren auf den Punkt gebracht (in seinem Buch Ärger im Paradies – Vom Ende der Geschichte zum Ende des Kapitalismus):
Wir flüchten uns in die Träume, um einen Zusammenbruch im wirklichen Leben zu vermeiden, aber dann ist das, was uns im Traum begegnet, noch schlimmer, sodass wir am Ende buchstäblich aus dem Traum zurück in die Realität entkommen. Es fängt damit an, dass Träume für die Leute da sind, die für die Realität nicht stark genug sind, es endet damit, dass die Realität für die existiert, die ihre Träume nicht aushalten.
Anhang:
Flucht in den Baumstamm
»In unserer Gesellschaft riskiert jeder, der bei der Beerdigung seiner Mutter nicht weint, die Todesstrafe.« Dieser Satz ist für Camus die Quintessenz seines Romans Der Fremde. Und auch wenn zumindest hierzulande die Todesstrafe einstweilen abgeschafft und der Verhaltenskodex bei Beerdigungen naher Familienangehöriger liberaler geworden ist, haben Gedanken wie dieser nichts von ihrer beunruhigenden Wirkung verloren. Camus vergleicht seinen Antihelden Meursault mit Jesus. Und er behauptet, Meursault sterbe wie Jesus für die Wahrheit. Der Welt der verlogenen Konventionen setze er das nicht immer erfreuliche, aber wahrhaftige Bild eines Menschen entgegen, der seinen Impulsen folgt. Und Dinge sagt, die man zwar vielleicht denken mag, aber nicht aussprechen sollte: »Alle vernünftigen Menschen haben mehr oder weniger den Tod derer gewünscht, die sie liebten.« Heute erscheint dieser vermeintliche Wahrheitsrigorismus des amoralischen Individuums selbst schon wieder als Konvention, als »Style«, der zur Schau getragen wird, wenn man genug davon hat, angepasste und berechenbare Standardspiele zu spielen. Deshalb liegt der Reiz des Romans heute eher in den Lebensstrategien, die er offeriert, als in der Suche nach Wahrheit. Die existentielle Frage lautet: Wie kann ich auch gegenüber dem Schlimmsten, was mir zustoßen könnte, einen klaren Kopf bewahren und die gute Laune nicht verlieren? Meursault sagt sich: »Wenn man mich in einem verdorrten Baumstamm leben lassen würde, mit keiner anderen Beschäftigung, als die Oberfläche des Himmels über meinem Kopf anzusehen, würde ich mich allmählich daran gewöhnen.« Am Ende ist er so weit, dass er selbst die Aussicht auf seine Hinrichtung vor einem Publikum, das ihn »mit Schreien von Hass« empfängt, als Glück genießen kann. In der Tat: Wer seine eigene Hinrichtung als Glück empfindet, dem kann nichts Schlimmes mehr passieren. Und sein Autor bekommt den Nobelpreis. Da wir alle zum Tode verurteilt sind, selbst wenn wir nichts Böses getan haben, ist es vielleicht für niemanden ein Fehler schon mal zu üben, wie man damit umgeht, wenn eines Tages alle Gnadengesuche abgelehnt sind.