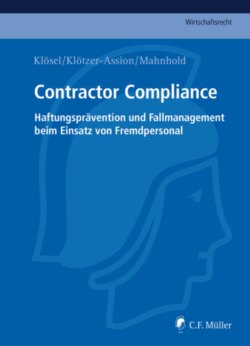Читать книгу Contractor Compliance - Christoph LL.M. Frieling - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Teil Problemaufriss: Contractor Compliance › II. Herausforderungen einer Contractor Compliance › 2. Vielzahl „weicher“ Abgrenzungskriterien
2. Vielzahl „weicher“ Abgrenzungskriterien
29
Neben diesen Abgrenzungsschwierigkeiten aufgrund der zahlreichen und jeweils für sich verschiedenen Beschäftigungsformen an der Grenze zu einer vermeintlichen Scheinselbstständigkeit sind die vorzunehmenden Statusfragen aber auch in rechtlicher Hinsicht mit zahlreichen Problemen verbunden. Dies geht vor allem zurück auf das Fehlen klarer und trennscharfer Abgrenzungskriterien zwischen einer selbstständigen Beschäftigung auf Basis von Werk- bzw. Dienstverträgen einerseits und einer Scheinselbstständigkeit bzw. verdeckten Arbeitnehmerüberlassung andererseits, was einen erheblichen richterlichen und behördlichen Entscheidungsspielraum eröffnet und somit – gerade in einem derart stark (wechselnden) rechtspolitisch geprägten Entscheidungsumfeld – zu erheblichen Herausforderungen für eine vorausschauende Fallbewertung unter Compliance-Gesichtspunkten führt.
a) Vielzahl von Kriterien
30
Dies ist zunächst auf die bloße Vielzahl der maßgeblichen Abgrenzungskriterien zurückzuführen. Vor allem die Rechtsprechung hat zwar einige grundlegende Abgrenzungskriterien zur Scheinselbstständigkeit entwickelt – beispielsweise das Vorliegen von Weisungen nach Inhalt, Zeit und Ort der Tätigkeit durch den Auftraggeber, die Eingliederung in eine fremde Arbeitsorganisation durch eine Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern des Auftraggebers oder durch das Nutzen dessen Betriebsmittel etc. – die dann auch den maßgeblichen Entscheidungen zugrunde gelegt werden. Diese Vielzahl der einzelnen Abgrenzungskriterien wird allerdings ohne Bestehen einer klaren Hierarchie oder anderweitiger verbindlicher Abwägungsvorgaben einer ergebnisoffenen Gesamtschau zugeführt, die im Ergebnis über das Vorliegen eines selbstständigen Dienst- bzw. Werkvertragsverhältnisses oder einer Scheinselbstständigkeit bzw. verdeckter Arbeitnehmerüberlassung entscheidet.[1] In § 611a BGB-E sollen diese Kriterien jetzt auch gesetzlich festgelegt werden, wobei sich auch diese Regelung auf die Benennung von Regelbeispielen beschränkt, die für Feststellung eines Arbeitsnehmerstatus „insbesondere maßgeblich“ sein sollen (vgl. zur Kritik Rn. 3).
31
Vor diesem Hintergrund gibt es sicherlich auch Einzelfälle, bei denen nahezu alle Kriterien für oder gegen eine selbstständige Beschäftigung vorliegen und damit die Statusfeststellung verhältnismäßig einfach vorzunehmen ist. So wird beispielsweise für den oben geschilderten Fall, dass ein Werkunternehmer branchenübergreifend einer Vielzahl von Auftraggebern hochspezialisierte und nicht zu deren jeweiligen Kernkompetenzfeld gehörende Leistungen wie z.B. die Herstellung und Wartung bestimmter IT-Produkte anbietet und die hierbei eingesetzten Mitarbeiter des Werkunternehmers weder mit jenen des Auftraggebers in Kontakt kommen noch jedwede Betriebsmittel des Auftraggebers einsetzen, ohne begründeten Zweifel von dem Vorliegen eines echten Werk- oder Dienstvertrags auszugehen sein. Dagegen werden ernste Zweifel insbesondere dann angemeldet sein, wenn vormals durch eigene Arbeitnehmer getätigte Leistungen auf Werkvertragsunternehmen ausgelagert werden und Unternehmen nunmehr zur Erledigung der gleichen Tätigkeiten auf Fremdpersonal zurückgreifen, ohne dass es zu jedweden Veränderungen in der Organisation dieser Tätigkeiten gekommen ist.[2]
32
In der Praxis ist eine derart einfache Zuordnung bei einer Vielzahl von Fällen allerdings nicht möglich. Wie die Beispiele auch aus der jüngeren Rechtsprechung zeigen, handelt es sich oftmals um Tätigkeitsformen an der Grenze zu einer vermeintlichen Scheinselbstständigkeit, die sowohl zahlreiche Kriterien „für“ aber auch „gegen“ das Bestehen freier Werk- oder Dienstverträge erfüllen. Dies eröffnet den betroffenen Gerichten oder Behörden einen erheblichen Entscheidungsspielraum, der – gerade bei gerichtlichen Entscheidungen – dazu führt, dass der jeweiligen Statusfeststellung ein umfassender Abwägungsvorgang zugrunde liegt, dessen Ausgang oftmals nur durch Kleinigkeiten bestimmt wird. So kann es etwa dazu kommen, dass die betriebliche Eingliederung aufgrund der Benutzung von technischen Gerätschaften des Auftraggebers in einigen Fällen entscheidend zur Annahme einer Scheinselbstständigkeit führt, in anderen Fällen dagegen anderweitige Kriterien wie das Fehlen einer Weisungsbefugnis des Auftraggebers für schwerwiegender bewertet werden und zu der Annahme einer selbstständigen Tätigkeit führen.[3]
b) „Weiche“ Kriterien
33
Zusätzlich zu dieser Vielzahl von Abgrenzungskriterien ermöglichen aber auch oftmals die einzelnen durch die Rechtsprechung entwickelten Kriterien an sich bereits keine trennscharfe Abgrenzung zur Scheinselbstständigkeit. Wie bereits gezeigt, besteht gerade bei diesem Thema ein stark (rechts-)politisch geprägtes Entscheidungsumfeld, mit der Folge, dass die Bedeutung einzelner Kriterien – parallel zur Entwicklung dieses (rechts-)politischen Umfelds – erheblichen Veränderungen unterliegt.
34
Ein Beispiel hierfür bildet etwa die Rechtsprechung zur Abgrenzung von werks- und arbeitsbezogenen Weisungen von Repräsentanten des Auftraggebers gegenüber den durch den Auftragnehmer zur Erledigung der vertraglich geschuldeten Tätigkeiten eingesetzten Mitarbeitern. In früheren Jahren, d.h. noch in den Zeiten der politisch geförderten „Ich-AG“ Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre, hatte die Rechtsprechung hier noch verhältnismäßig lockere Kriterien angelegt und das Vorliegen lediglich werksbezogener Weisungen und damit eines Werkvertrags selbst in Fällen bestätigt, in denen eingesetzte Mitarbeiter – unter dem Fehlen jedweder Repräsentantenmodelle – über Jahre keinerlei Weisungen mehr von dem Auftragnehmer als ihrem Arbeitgeber erhalten haben und „Beanstandungen ihrer Arbeit“ ausschließlich unmittelbar von dem Werkstattleiter des Auftraggebers ausgesprochen wurden.[4] Mit Blick auf die neuere Rechtsprechung, d.h. in den Zeiten der aufkommenden rechtspolitischen Kritik am sog. „Missbrauch von Werkverträgen“, wird dagegen selbst dann von Scheinwerkverträgen und einer verdeckten Arbeitnehmerüberlassung ausgegangen, wenn – im Gegensatz zu den früheren Fällen – sogar Repräsentantenmodelle zur Koordinierung der Interaktionen zwischen dem Auftraggeber und den durch den Auftragnehmer eingesetzten Mitarbeitern eingeführt sind, in der Praxis aber lediglich nicht durchgängig gelebt werden.[5]
c) Variierender Kriterienkatalog
35
Zusätzlich zu dieser Vielzahl „weicher“ Abgrenzungskriterien ist bei der Beurteilung von Statusfragen ebenfalls zu berücksichtigen, dass jedenfalls in einigen Sonderfällen ein abweichender Kriterienkatalog zugrunde zu legen ist, der entweder angesichts der betroffenen Rechtsgüter modifizierte Maßstäbe enthält oder in den noch weitere rechtliche Kriterien einzustellen sind.
36
In diesem Zusammenhang ist unter anderem die Rechtsprechung zur Abgrenzung eines Arbeitsverhältnisses zum freien Dienstverhältnis im Fall sog. „programmgestaltender Mitarbeiter“ im Rundfunkbereich zu nennen. Der in diesen Fällen zu beachtende verfassungsrechtliche Schutz der Rundfunkfreiheit nach Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG führt dazu, dass in diesen Fällen im Rahmen der Abgrenzung zur Scheinselbstständigkeit zusätzlich berücksichtigt werden muss, ob die verfügbaren Vertragsgestaltungen in einem Arbeitsverhältnis – z.B. in Form von Teilzeit- und Befristungsabreden – in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht zur Sicherung der Aktualität und Flexibilität der Berichterstattung überhaupt in gleicher Weise geeignet sind wie die Beschäftigung in freier Mitarbeit.[6] Unabhängig davon zeigen aber auch andere Fallgestaltungen, dass mit Blick auf den konkreten Einzelfall auch anderweitige rechtliche Aspekte wie eine öffentlich-rechtliche Beleihung der eingesetzten Mitarbeiter oder weitere öffentlich-rechtliche Vorgaben z.B. im Rahmen einer Personalgestellung zur Erledigung öffentlicher Aufgaben weitere Indizien für oder gegen eine Scheinselbstständigkeit liefern können.[7]
d) Uneinheitliche Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis
37
Insgesamt führt diese Vielzahl „weicher“ Abgrenzungs-Kriterien unter Compliance-Gesichtspunkten somit zu erheblichen Herausforderungen für eine vorausschauende Bewertung der jeweiligen Statusfragen. Es ist daher auch keine Seltenheit, dass – wie sich ebenfalls an einem Fall aus jüngerer Vergangenheit zeigen lässt – ein erstinstanzliches Arbeitsgericht das Vorliegen eines freien Werkvertrags bestätigt, das in zweiter Instanz zuständige Landesarbeitsgericht diesen Fall dagegen anders beurteilt und von einem Arbeitsverhältnis ausgeht, das Bundesarbeitsgericht in letzter Instanz – und das Ganze nahezu 5 Jahre nach Klageerhebung – den Fall dann aber wiederum mangels hinreichender Sachverhaltsaufklärung über die tatsächliche Vertragsdurchführung für nicht entscheidungsreif befindet und an das zuständige Landesarbeitsgericht zurückverweist.[8]