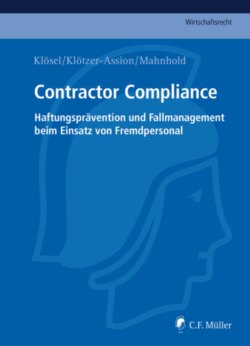Читать книгу Contractor Compliance - Christoph LL.M. Frieling - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Inhaltsverzeichnis
ОглавлениеVorwort
Bearbeiterverzeichnis
Inhaltsübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Teil Problemaufriss: Contractor Compliance
I.Fremdpersonaleinsatz als vernachlässigtes Compliance-Thema
II.Herausforderungen einer Contractor Compliance
1.Vielzahl von Beschäftigungsformen
a)Solo-Selbstständige
b)Outsourcing/Werkvertragsunternehmer
c)Neuartige Fälle: Interim-Management, Scrum, „Work-on-Demand“ etc.
2.Vielzahl „weicher“ Abgrenzungskriterien
a)Vielzahl von Kriterien
b)„Weiche“ Kriterien
c)Variierender Kriterienkatalog
d)Uneinheitliche Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis
3.Vielzahl betroffener Rechtsgebiete
4.Vielzahl erforderlicher Compliance-Maßnahmen
a)Vertrag und/oder gelebte Vertragspraxis?
b)Vertragsmanagement
c)Fallmanagement
d)Sonstige Maßnahmen
5.Vielzahl von weiteren compliance-relevanten Bereichen
a)Regulierung der Haftungsrisiken
b)Regulierung von Eigentums- und Nutzungsrechten
c)Keine Beschränkung auf Statusfragen
III.Eckpfeiler einer Contractor Compliance
2. Teil Der Arbeitgeberbegriff in der deutschen Rechtsordnung
1. KapitelDefinition des arbeitsrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
I.Einführung
II.Abgrenzungskriterien
1.Weisungen
a)Inhalt
aa)Vertragliche Definition des Leistungsgegenstandes
bb)Werk- vs. arbeitsvertragliche Weisungen
cc)Eingeschränkte Bedeutung bei „höherwertigen Leistungen“
b)Zeit
c)Ort
2.Betriebliche Eingliederung
a)Ort der Leistungserbringung
b)Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern des Einsatzunternehmens
aa)Eigenständige betriebliche Organisation
bb)Weniger problematische Fälle: Betriebsfremde Leistungen, Outsourcing von betrieblichen Nebenleistungen (IT, Werkschutz, Kantine etc.)
cc)Problematische Fälle: Repräsentantenmodelle bei Onsite-Werkverträgen in arbeitsteiligen Prozessen und On-Demand-Werkverträge
c)Einsatz von Betriebsmitteln („Mietmodelle“)
3.Umfang der Tätigkeit
4.Unternehmerrisiko
5.Weitere Kriterien
6.Abweichende Kriterien in Sonderfällen: „Programmgestaltende Rundfunkmitarbeiter“ etc.
III.Tatsächliche Durchführung
IV.Wertende Gesamtbetrachtung
V.Umgehungsmodelle: „Ein-Mann-GmbH“ und Vorratserlaubnis
VI.Fazit
2. KapitelDefinition des sozialversicherungsrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
I.Einführung
II.Abgrenzungskriterien: Parallelität und Unterschiede zum Arbeitsrecht
III.Fazit
3. KapitelDefinition des steuerrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
I.Einführung
II.Einzelheiten zum steuerrechtlichen Arbeitgeberbegriff
1.Lohnsteuerlicher Arbeitgeberbegriff nach § 1 Abs. 2 LStDV
a)Arbeitgeber und Pflicht zum Lohnsteuereinbehalt
b)Bestimmung des Dienstverhältnisses durch Gesamtschau sämtlicher Indizien
aa)Wertungskriterien
bb)Schulden der Arbeitskraft
cc)Weisungsgebundenheit
dd)Fehlendes Vermögensrisiko – Abgrenzung zur Selbstständigkeit
c)Arbeitgeber und Arbeitnehmer
d)Arbeitslohn und Lohnsteuerabzug
2.Zur Terminologie im Umsatzsteuerrecht
III.Fazit
IV.Einzelfälle zur Abgrenzung der selbstständigen Tätigkeit von einer Tätigkeit als Arbeitnehmer im Steuerrecht
4. KapitelDefinition des strafrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
I.Einführung
II.Arbeitgeber im Sinne des § 266a StGB
1.Genuiner Arbeitgeberbegriff in § 266a StGB?
2.Bestimmung des strafrechtlichen Arbeitgeberbegriffs im Schrifttum
a)Auslegung am Maßstab des Sozialversicherungsrechts
b)Rückgriff auf Kriterien nach der Rechtsprechung des BSG
c)Dreipersonenverhältnisse/Arbeitnehmerüberlassung
3.Begriffsprägung durch den BGH in Strafsachen
a)Auslegung nach dem Sozialversicherungsrecht, das seinerseits auf das Dienstvertragsrecht verweist
b)Kriterien
4.Kritik
5.Einfügung einer Arbeitgeber-Definition in das BGB/Auswirkungen diesbezüglicher Initiativen auf die Begriffsbestimmung im Strafrecht
6.Zur Arbeitgeberstellung bei Fremdpersonaleinsatz im Rahmen der europäischen Niederlassungsfreiheit
7.Der faktische Geschäftsführer als Arbeitgeber im Sinne des § 266a StGB
III.Arbeitgeber im steuerstrafrechtlichen Sinne
1.Vorbemerkung
2.Keine Definition des Arbeitgeberbegriffs in § 370 AO
a)Herleitung aus § 1 LStDV
b)Rückgriff auf Kriterien des BFH
3.Begriffsbestimmung durch den BGH in Steuerstrafsachen? – Fehlanzeige
4.Faktische Arbeitgeberstellung nach steuerrechtlichen Kriterien
5.Ergebnis
5. KapitelGemeinsamkeiten und Divergenzen bei der Bestimmung des Arbeitgeberbegriffs
I.Gemeinsamkeiten
1.Wesentliche Kriterien im Arbeitsrecht
2.Wesentliche Kriterien im Sozialversicherungsrecht
3.Wesentliche Kriterien im Steuerrecht
4.Wesentliche Kriterien im Strafrecht
II.Divergenzen
1.Schwerpunktsetzung der Arbeitsgerichte und Sozialgerichte
2.Schwerpunktsetzung der Finanzgerichte
3.Schwerpunktsetzung der Strafgerichte
III.Konsequenzen für den Rechtsanwender
IV.Ausblick
6. KapitelBesonderheiten beim internationalen/grenzüberschreitenden Sachverhalt
I.Einführung
II.Compliance-relevante Fallkonstellationen
1.Solo-Selbstständige (Zweipersonenverhältnis)
a)Inbound
b)Outbound
2.Werkunternehmer (Dreiecksverhältnis)
a)Inbound
b)Outbound
III.Risikoanalyse im Zweipersonenverhältnis („Solo-Selbstständige“)
1.Internationale Zuständigkeit (IZPR)
a)Zuständigkeiten bei Arbeits- und Dienst-/Werkverträgen
aa)Objektive Zuständigkeiten: Erfüllungs- vs. Arbeitsort
bb)Individuell: Einschränkungen bei Gerichtsstandsvereinbarungen im Arbeitsvertrag
b)Statusabgrenzung im IZPR: Der unionsrechtliche Arbeitnehmerbegriff
2.Anwendbarkeit ausländischen Rechts (IPR)
a)Vertragsstatut bei Arbeits- und Dienst-/Werkverträgen
aa)Objektives Vertragsstatut: Aufenthalts- vs. Arbeitsort
bb)Individuell: Eingeschränkte Rechtswahl bei Arbeitsvertrag
b)Abgrenzung zwischen Arbeits- und Werkvertrag im IPR
IV.Risikoanalyse im Dreiecksverhältnis („Werkunternehmer“)
1.Internationale Zuständigkeit (IZPR)
a)Zuständigkeiten bei Inbound-Fällen
b)Zuständigkeiten bei Outbound-Fällen
2.Anwendbarkeit des Rechts (IPR)
a)Statusabgrenzung: Feststellung illegaler Arbeitnehmerüberlassung
b)Rechtsfolgen: Fiktion von Arbeitsverhältnissen und Equal-Pay
V.Öffentliches Recht: Insbesondere Sozialversicherungsrecht
VI.Fazit
3. Teil Anlass und Möglichkeiten der Feststellung der Arbeitgebereigenschaft
1. KapitelBeschreitung des Arbeitsrechtswegs
I.Anlass zur Statusfeststellung
1.Mögliche Interessenträger
2.Ausgangspunkte
II.Möglichkeiten der Statusfeststellung
1.Initiative durch Arbeitgeber
a)Grundsätzliches
b)Statusklage
c)Leistungsklage
d)Beschlussverfahren
2.Initiative durch Arbeitnehmer
a)Grundsätzliches
aa)Allgemeines
bb)Eröffnung des Rechtswegs
b)Beendigungsszenarien
aa)Kündigungsschutzklage
(1)Klagegegner
(2)Klagefrist
(3)Feststellungsinteresse
(4)Darlegungs- und Beweislast
(5)Rechtsfolge
bb)Befristungskontrollklage
(1)Klagegegner
(2)Klagefrist
(3)Feststellungsinteresse
(4)Darlegungs- und Beweislast
(5)Rechtsfolge
c)Statusklage
aa)Allgemeines
bb)Klagegegner
cc)Klagefrist
dd)Feststellungsinteresse
ee)Darlegungs- und Beweislast
ff)Rechtsfolge
d)(Weiter)Beschäftigungsanspruch
III.Betriebsrat
1.Einleitung
2.Abstrakte Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft
a)Zulässigkeitsvoraussetzungen
aa)Rechtsverhältnis im Sinne des § 256 ZPO
bb)Beilegung der Streitigkeit zwischen den Beteiligten
cc)Feststellungsinteresse
b)Materiell-rechtliche Voraussetzungen
c)Rechtsfolgen
3.Konkrete Anlässe zur Statusprüfung
a)Wahlberechtigung/Wählbarkeit
b)Zahl der Betriebsratsmitglieder
c)Freistellung
d)Betriebsgröße
4.Sonstige Anlässe zur gerichtlichen Feststellung
IV.Gewerkschaft
2. KapitelSozialversicherungsrechtliche Feststellungmöglichkeiten
I.Anlass zur Statusfeststellung
1.Zweifel auf Seiten der Vertragspartner über den sozialversicherungsrechtlichen Status des Auftragnehmers
2.Erkenntnisse aus angrenzenden Rechtsgebieten
3.Ermittlungen und verdachtsunabhängige Prüfungen
II.Möglichkeiten der sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellung
1.Statusfeststellung nach § 7a SGB IV
2.Statusfeststellungen aus Anlass einer Betriebsprüfung der DRV
a)Regelprüfung nach § 28p SGB IV
b)Außerordentliche Prüfung und kürzere Prüffristen nach § 28p Abs. 1 S. 2 SGB IV
c)Ad-hoc-Prüfung, § 28p Abs. 1 S. 3 SGB IV
3.Prüfung im Auftrag der Unfallversicherungsträger, § 28p Abs. 1b SGB IV
4.Verdachtsprüfung ohne vorherige Ankündigung
5.Verfahren nach § 28h Abs. 2 SGB IV
III.Schwerpunkt: Das optionale Anfrageverfahren nach § 7a Abs. 1 S. 1 SGB IV
1.Verfahrensfragen
a)Zuständigkeit
b)Antragsberechtigung
c)Form
d)Rücknahme des Antrages
e)Zulässigkeit des Antrags
f)Mitwirkungsobliegenheiten und Amtsermittlungspflichten
g)Grundsätze der Verfahrensdurchführung
2.Verfahrensgegenstand des Anfrageverfahrens
3.Ziel des Verfahrens und Rechtsnatur der Entscheidung der DRV
4.Bindungswirkung der Entscheidung
5.Rechtsfolgen
a)Feststellung einer Beschäftigung nach § 7 SGB IV
b)Feststellung der Selbstständigkeit
6.Überprüfbarkeit der Entscheidung
IV.Spezielle Konstellation: Obligatorische Statusfeststellung nach § 7a Abs. 1 S. 2 SGB IV
3. KapitelSteuerrechtliche Feststellungsmöglichkeiten zur Arbeitgebereigenschaft
I.Einführung
II.Anrufungsauskunft nach § 42e EStG
1.Einführung
2.Auskunftsberechtigung und Anfragevoraussetzungen
3.Bindungswirkung nur gegenüber dem Arbeitgeber
4.Rechtsbehelfsmöglichkeiten
III.Verbindliche Zusage aufgrund einer Außenprüfung nach § 204 AO
1.Funktion und Anwendungsbereich des § 204 AO
2.Voraussetzungen für die Erteilung einer verbindlichen Zusage
3.Zukunftsbezogenheit und Zusageinteresse
4.Rechtsbehelfsmöglichkeiten
IV.Verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO
1.Verhältnis zu anderen Auskünften und Zusagen
2.Funktion und Voraussetzungen einer verbindlichen Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO
3.Bindungswirkung
4.Rechtsbehelfsmöglichkeiten
4. KapitelBindungswirkung behördlicher und/oder gerichtlicher Entscheidungen
I.Wechselwirkung arbeitsgerichtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Entscheidungen
II.Bindungswirkung im Steuerrecht
III.Bindungswirkung im Strafrecht
1.Auswirkungen behördlicher Statusfeststellung auf den Tatbestand des § 266a StGB
2.Bindung durch sozialgerichtliche Entscheidungen
3.Auswirkungen der Statusfeststellung gem. § 7a SGB IV auf § 370 AO
4. Teil Konsequenzen der Statusverfehlung
1. KapitelArbeitsrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
I.Einführung
II.Individualrechtliche Folgen: Arbeitsverhältnis
1.Zwei-Personenverhältnis
a)Laufzeit des Vertrags: Befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis?
b)Höhe des Arbeitsentgelts
c)Sonstiges
2.Dreiecksverhältnis
a)Beginn des Arbeitsverhältnisses
b)Inhalt des Arbeitsverhältnisses
III.Individualrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten
1.Zwei-Personenverhältnis
a)In Bezug auf das Arbeitsverhältnis
b)In Bezug auf die Rückabwicklung des Scheinwerk/-dienstvertrags
2.Dreiecksverhältnis
IV.Fazit
2. KapitelSozialversicherungsrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
I.Feststellung der Versicherungs- und Beitragspflicht
II.Nacherhebung von Gesamtsozialversicherungsbeiträgen
III.Anfall von Säumniszuschlägen auf nicht entrichtete Beiträge
IV.Tatbestandswirkung nicht angefochtener Bescheide
V.Regressmöglichkeiten des Unfallversicherungsträgers
VI.(Fort)Bestehen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung – Wirkungen für die Zukunft
3. KapitelSteuerrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
I.Einführung und Ausgangslage
1.Haftung für nicht abgeführte Lohnsteuer
a)Haftung des Arbeitgebers
b)Rückgriff beim Arbeitnehmer
2.Konsequenzen bei der Umsatzsteuer
a)Korrektur von Umsatzsteuer und Vorsteuerabzug
b)Zivilrechtliche Rückabwicklung
3.Kontrollmöglichkeiten der Finanzbehörden
II.Zur Haftung des Arbeitgebers für die Lohnsteuer nach § 42d EStG
1.Einführung und Voraussetzungen
2.Umfang der Haftung und Haftungsbescheid
3.Haftung bei Arbeitnehmerüberlassung
III.Persönliche Haftung von Vertretern des Unternehmens, §§ 34, 69, 70 f. AO
1.Einführung
2.Voraussetzungen der Haftung gesetzlicher Vertreter gem. § 69 S. 1 AO
3.Haftung des Steuerhinterziehers nach § 71 AO sowie Haftung nach § 70 AO
IV.Lohnsteuer-Nachschau nach § 42g EStG
1.Einführung
2.Ablauf und Voraussetzungen einer Lohnsteuer-Nachschau
3.Rechtsbehelfsmöglichkeiten
V.Lohnsteueraußenprüfung und allgemeine Außenprüfung
1.Einführung
2.Allgemeine Außenprüfung gem. §§ 193 ff. AO
3.Rechtsbehelfsmöglichkeiten
VI.Umsatzsteuer-Nachschau nach § 27b UStG
4. KapitelStraf- und bußgeldrechtliche sowie außerstrafrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
I.Straf- und bußgeldrechtliche Verantwortung der Geschäftsleitung – Grundsätze
II.Strafbares Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen, § 266a StGB
1.§ 266a Abs. 1 StGB
2.§ 266a Abs. 2 StGB
a)§ 266a Abs. 2 Nr. 1 StGB
b)§ 266a Abs. 2 Nr. 2 StGB
3.Zusammentreffen von § 266a Abs. 1 und Abs. 2 StGB
4.§ 266a StGB als Vorsatzdelikt
a)Grundsatz
b)Rechtsprechung des 1. Strafsenats des BGH zu den Anforderungen an die subjektive Tatseite
c)Beachtliche Gegenansichten der Tat- und Zivilgerichte
aa)LG Ravensburg, Urteil vom 26.9.2006
bb)LG Karlsruhe, Urteil vom 27.2.2009
cc)AG Schwetzingen, Urteil vom 6.4.2010
dd)LG Bochum, Urteil vom 28.5.2014
d)Auffassung im Schrifttum
e)Eigene Auffassung
5.Rechtsirrtümer und § 266a StGB
a)Regelungsinhalt des § 17 StGB
b)Behandlung von Irrtümern über die Arbeitgebereigenschaft durch den 1. Strafsenat des BGH
c)Einwände
6.Rechtsfolgen des § 266a StGB
a)Strafandrohung bei Verwirklichung des Grunddelikts
b)Strafverschärfung bei Vorliegen eines besonders schweren Falles
7.Absehen von Strafe und Strafaufhebung, § 266a Abs. 6 StGB
8.Verfolgungsverjährung
9.Exkurs: Gesetzeskonkurrenz zwischen § 266a StGB und § 263 StGB
a)§ 266a StGB als lex specialis
b)Strafbarkeit nach § 263 StGB
III.Lohnsteuerhinterziehung nach § 370 AO
1.Tatbestandsvoraussetzungen des § 370 AO
2.Tathandlungen und Taterfolg bei der Lohnsteuerverkürzung
3.Subjektiver Tatbestand
4.Rechtsfolgen
a)Verwirklichung des Grunddelikts
b)Strafschärfung im besonders schweren Fall
c)Ergebnis
5.Versuchsstrafbarkeit
IV.Umsatzsteuerverkürzung gem. § 370 AO
V.Zwischenergebnis zu den strafrechtlichen Konsequenzen
VI.Bußgeld- und außerstrafrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
1.Vorbemerkung
2.Ausgewählte Ordnungswidrigkeiten
a)§ 111 SGB IV
b)§ 23 AEntG
c)§ 21 MiLoG
d)§ 16 AÜG
e)Sanktionsmöglichkeiten in Fallgestaltungen mit (EU) Ausländern
f)Aufsichtspflichtverletzung, § 130 OWiG
g)Verbandsbuße, § 30 OWiG
VII.Eintragungen rechtskräftiger Strafen und Bußen, Vergabesperren
1.Gewerbezentralregister
2.Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, black list
3.Landes-Korruptionsregister
4.Bundeszentralregister
VIII.Vermögensabschöpfungsmaßnahmen
5. KapitelZivilrechtliche Konsequenzen für Organe
I.Ausgangspunkt
II.Haftungssubjekt „Organ“
III.Außenhaftung
1.Anspruch der Einzugsstelle nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 266a StGB
2.Anspruch der Finanzverwaltung nach § 69 AO
IV.Innenhaftung
1.Die Pflichtenstellung
a)Geschäftsführer und Vorstand
aa)Objektive Pflichtwidrigkeit
(1)Organisationsermessen/Business Judgement Rule
(2)Weisung oder Einverständnis der Gesellschafter/Hauptversammlung
bb)Subjektive Pflichtwidrigkeit – Verschulden
cc)Kausalität/Zurechnung – Rechtmäßiges Alternativverhalten
b)Aufsichtsrat
c)Vertragliche Haftung
2.Entlastungsbeschluss der Gesellschafter/Hauptversammlung
3.Compliance-Pflicht im Konzern
4.Ersatzfähiger Schaden und Kausalität
a)Sozialversicherungsbeiträge und Säumniszuschläge
b)Verbandsgeldbuße
c)Aufklärungskosten, Kosten einer internal investigation
d)Lohnsteuer
5.Darlegungs- und Beweislastverteilung
6.Verjährung
V.Versicherbarkeit von Haftungsrisiken: D&O-Versicherung
VI.Ehrenamtliche Leitungsorgane
VII.Besondere Insolvenzverschleppungsrisiken, § 15a InsO
5. Teil Strategien zur Haftungsvermeidung
1. KapitelCompliance
I.Grundlage der (Schein-) Selbstständigen-Compliance in der Contractor Compliance
II.Motive zur Implementierung einer (Schein-) Selbstständigen-Compliance
1.Unternehmensimage
2.Haftungsprävention
a)Vermeidung von Problemfällen
b)Vermeidung von Geldbußen etc
c)Haftungsprävention durch Wissensmanagement
III.Struktur einer (Schein-) Selbstständigen-Compliance
1.Einführung einer (Schein-) Selbstständigen-Compliance
a)Risikoanalyse
b)Integration der (Schein-) Selbstständigen-Compliance in Compliance-Strukturen
2.Elemente eines Compliance-Konzepts
a)Maßnahmen „nach innen“ ins eigene Unternehmen
aa)Aufklärung von Zielgruppen im Unternehmen
(1)Leitlinien/Verpflichtungserklärungen
(2)Schulungen
bb)Beratungsmöglichkeiten
cc)Hinweisgebersysteme
dd)Monitoring
ee)Behandlung von Problemfällen
b)Maßnahmen „nach außen“ gegenüber Vertragspartner
aa)„Contractor Due Diligence“
bb)Vertragsmanagement
(1)Vertragliche Informations- und Dokumentationspflichten
(2)Freistellungserklärungen
(3)Beschränkung der Nachunternehmerkette
(4)Auditierungsrechte
(5)Sonderkündigungsrechte
3.Organisation des Fremdpersonaleinsatzes und Vertragsgestaltungen als Element der Haftungsprävention
a)Kontaktsteuerung/Repräsentantenmodelle
aa)Zwischenschaltung von Disponenten etc. – Einfache Repräsentantenmodelle
bb)Ticketsysteme – Institutionalisierte Repräsentantenmodelle
cc)Räumliche Abgrenzung
b)Durchprogrammierung des Arbeitsprozesses im Vertrag
c)Gründung von „Ein-Mann GmbH“
d)Betriebsführungsvertrag
e)Gemeinschaftsbetrieb
f)Personalgestellung und Selbstständigen-Contracting
2. KapitelVertragsgestaltung
I.Ausgangspunkt/Bedeutung der Vertragsgestaltung
II.Individuelle Vertragsgestaltung und AGB-Recht
1.Begriff der AGB
2.Einbeziehung
3.Verbot überraschender Klauseln
4.Unklarheitenregel
5.Inhaltskontrolle
6.Einschränkungen des Anwendungsbereichs
7.Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit
8.Beweislast
III.Die einzelnen Regelungsgegenstände
1.Vertragsgegenstand
a)Allgemeines
b)Rahmenvertrag
2.Vergütung und Abrechnung
3.Verhältnis des Selbstständigen zu Dritten
a)Tätigkeit für andere Auftraggeber
b)Einschaltung Dritter als Erfüllungsgehilfen
4.Geheimhaltung und Datenschutz
a)Geheimhaltung/Verschwiegenheit
b)Datenschutz
5.Aufbewahrung und Rückgabe von Geschäftsunterlagen
6.Nutzung von Betriebsmitteln des Auftraggebers
7.Wettbewerbs- und Abwerbeverbot
8.Vertragsdauer und Kündigung
9.Compliance
10.Sorgfaltsmaßstab und Qualitätskontrolle
11.Gewährleistung und Haftung
a)Gewährleistung
b)Haftung
aa)Haftungsbeschränkung
bb)Haftungserweiterung
cc)Verfallklauseln
dd)Vertragsstrafe/Pauschalierter Schadensersatz
c)Haftpflichtversicherung
12.Rechte an Arbeitsergebnissen
13.Gerichtsstand
14.Rechtswahl
15.Schlussbestimmungen
a)Schriftform
b)Salvatorische Klausel
3. KapitelSozialversicherungsrechtliche Möglichkeiten der Haftungsvermeidung
I.Einholung von Rechtsrat
II.Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status des Auftragsverhältnisses
III.Einfluss der Festsetzungsverjährung auf das Haftungsrisiko
1.Regelverjährung
2.Verjährung bei vorsätzlicher Verletzung von Beitragspflichten
IV.Verteidigung gegen Inanspruchnahme durch den Rentenversicherungsträger
1.Nutzung des Anhörungsverfahrens
2.Ausschließliches Abstellen auf Ermittlungsergebnisse des FKS unzulässig
3.Berechnung des Nacherhebungsbetrages
4.Unverschuldete Unkenntnis von der Zahlungspflicht/Vermeidung von Säumniszuschlägen
4. KapitelSteuerrechtliche Möglichkeiten der Haftungseingrenzung
I.Einholung verbindlicher Auskünfte bzw. Zusagen der Finanzverwaltung
1.Möglichkeiten bei der Lohnsteuer
2.Möglichkeiten bei der Umsatzsteuer
3.Einholung externer steuerlicher Expertise
II.Rechtsbehelfs- und Klageverfahren
1.Einspruchsverfahren gemäß §§ 347 ff. AO
2.Klageverfahren zum Finanzgericht
3.Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung, § 361 AO, § 69 FGO
III.Einbindung und Verantwortung externer steuerlicher Berater
1.Externe steuerliche Berater im Compliance-System
2.Aufgaben des mit der laufenden Steuerberatung betrauten Steuerberaters
3.Voraussetzungen einer Haftung des externen steuerlichen Beraters
5. KapitelStrategien zur Vermeidung strafrechtlicher Haftung und/oder der Sanktionierung wegen Ordnungswidrigkeiten
I.Grundsätzliche Erwägungen
II.Vermeidung strafrechtlicher Haftung nach § 266a StGB
1.Auswirkungen des Anfrageverfahrens nach § 7a Abs. 1 S. 1 i.V.m. Abs. 6 SGB IV auf den Tatbestand des § 266a StGB
a)Feststellung einer selbstständigen Betätigung durch die DRV
aa)Bescheid erwächst in Bestandskraft
bb)Anfechtung des Bescheids
cc)Bestands-/Rechtskraft der abweichenden Entscheidung
b)Feststellung einer versicherungspflichtigen Beschäftigung im Anfrageverfahren
aa)Entscheidung erwächst in Bestandskraft
bb)Entscheidung wird angefochten
2.Möglichkeiten im laufenden Auftragsverhältnis nach § 7a Abs. 1 SGB IV
3.Bindung der Strafgerichte an die Entscheidung nach § 7a SGB IV?
4.Erkenntnisse aus dem Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV und ihre Verwertbarkeit im Strafverfahren vor dem Hintergrund der Selbstbelastungsfreiheit
a)Risikosetzung durch Mitwirkung
b)Auffassung von Schrifttum und Rechtsprechung
c)Zusammenfassung
5.Haftungsvermeidung durch Einholung adäquaten Rechtsrats
6.Strafbefreiende Selbstanzeige gemäß § 266a Abs. 6 StGB
7.Haftungsvermeidung oder -minimierung durch Verteidigung
III.Vermeidung der strafrechtlichen Haftung nach § 370 AO
1.Einholung von Auskünften und Zusagen/Haftungsvermeidung durch Prävention
2.Strafbefreiende Selbstanzeige nach § 371 AO
a)Grundsätzliches
b)Teilselbstanzeigemöglichkeit bei Lohn- und Umsatzsteuervoranmeldungen
c)Berichtigungsmöglichkeiten im Rahmen von Jahreserklärungen
aa)Abgabe einer wahrheitsgemäßen Lohnsteueranmeldung
bb)Korrektur im Rahmen der Umsatzsteuerjahreserklärung
cc)Problem der Tatentdeckung für Folgezeiträume bei Abgabe berichtigter Jahreserklärungen
d)Kein Sperrgrund nach § 371 Abs. 2 Nr. 3 AO
3.Sperrgrund der Tatentdeckung durch Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach § 266a StGB?
IV.Vermeidung der Haftung nach § 378 AO
V.Haftungsvermeidung durch Verteidigung
VI.Haftungsvermeidung, wirksame Delegation von Arbeitgeberpflichten
6. Teil Beteiligungsrechte des Betriebsrats
I.Einleitung
II.Beteiligung bei Einstellungen im Sinne des § 99 Abs. 1 BetrVG
1.Begriff
2.Einzelfälle
III.Beteiligung bei Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung sowie in personellen Angelegenheiten
1.Unterrichtungs- und Beratungsrechte aus § 90 BetrVG
2.Personalplanung, § 92 BetrVG
3.Beschäftigungssicherung, § 92a BetrVG
IV.Anspruch auf Unterrichtung und Vorlage von Unterlagen nach § 80 BetrVG
1.Einleitung
2.Informationspflichten
a)Voraussetzungen des Informationsanspruchs
b)Reichweite des Informationsanspruchs
c)Zeitpunkt der Unterrichtung
3.Überlassung der erforderlichen Unterlagen
4.Durchsetzung
V.Mitbestimmung bei sozialen Angelegenheiten, § 87 BetrVG
1.Anwendungsbereich
2.Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats des Dienst- oder Werkunternehmers gegenüber eigenen Arbeitnehmern
3.Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats des Einsatzbetriebes gegenüber Fremdarbeitnehmern
VI.Unterrichtung des Wirtschaftsausschusses nach § 106 BetrVG
VII.Mitbestimmung bei Betriebsänderungen
VIII.Compliance-Konzepte
1.Einholung von Verpflichtungserklärungen
2.Nutzung von Ticketsystemen
3.Kontaktsteuerung
4.Meldemöglichkeiten (Whistleblowing)
5.Mitbestimmung bei Schulungen
7. Teil Work on Demand – Trends der Arbeitsflexibilisierung
I.„Work on Demand“ in Zeiten des „Arbeitens 4.0“
II.„Work on Demand“ in Beispielen
1.Crowdwork
2.Scrum
3.Interim Management
4.Selbstständigen-Contracting
III.Fazit
Anhang
1.Fallübersicht Arbeitsrecht
a)Arbeitsrechtlicher Arbeitgeberbegriff
b)Fallübersicht Arbeitsrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
c)Fallübersicht Besonderheiten beim grenzüberschreitenden/internationalen Sachverhalt
d)Fallübersicht Arbeitsrechtsweg
e)Fallübersicht Bindungswirkung
2.Fallübersicht Sozialversicherungsrecht
a)Sozialversicherungsrechtlicher Arbeitgeberbegriff
b)Sonstige Fälle
3.Fallübersicht Steuerrecht
4.Fallübersicht Strafrecht
5.Fallübersicht Haftungsrecht
Stichwortverzeichnis