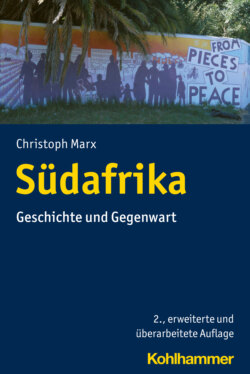Читать книгу Südafrika - Christoph Marx - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Die Zeit der Vereinigten Ostindischen Kompanie 2.1 Die Gründung der Kapkolonie
ОглавлениеAls 1651 der erste Niederländisch-Englische Krieg ausbrach, sahen die Niederländer den Zeitpunkt für eine Präventivmaßnahme gekommen, um zu verhindern, dass die Engländer sich in der Tafelbucht festsetzten. Der Oberkaufmann Jan van Riebeeck wurde mit drei Schiffen ausgesandt, um eine Lebensmittelstation zu gründen. Er sollte einen Gemüsegarten anlegen und die Schiffsbesatzungen künftig mit frischer Nahrung sowie mit Trinkwasser versorgen. Die Khoikhoi bemerkten, dass die Europäer diesmal nicht nur kurzzeitig an Land gingen, sondern bleiben wollten. Darauf reagierten sie feindselig, da das Gebiet um die Tafelbucht und auf der Kaphalbinsel wegen der guten Bewässerung ein begehrtes Weidegebiet für ihre Tiere war. So war das erste Gebäude, das die Weißen im südlichen Afrika errichteten, eine Festung.
Die Versorgungsstation war keineswegs allein den Schiffen der VOC vorbehalten, sondern zu manchen Zeiten lagen mehr Schiffe aus anderen europäischen Ländern vor Kapstadt auf Reede als niederländische. Zwischen 1688, als der niederländische Statthalter Wilhelm III. in der Glorious Revolution König von England wurde, und 1781 waren die beiden Länder enge Bündnispartner. Für die VOC war dies eine lukrative Einnahmequelle, weil sie sich die Versorgung gut bezahlen ließ. Auch die freien Bewohner Kapstadts konnten tüchtig verdienen, wenn sie Kneipen und Unterkünfte für die Schiffsbesatzungen unterhielten. Wegen der geringen Zahl freier Siedler dauerte es etwa 30 Jahre, bis die Kapkolonie von Getreideimporten aus Batavia unabhängig wurde und ihrerseits Überschüsse produzierte, die sie an die Schiffsbesatzungen verkaufen konnte.
Zunächst sollten Angestellte der VOC den Anbau der Nahrungspflanzen übernehmen, doch erkannten die stets besorgt auf ihre Kosten blickenden Direktoren der Kompanie, dass sich dies mit freien Farmern besser bewerkstelligen ließ, solange die Kompanie ihr Monopol sichern konnte. Ehemalige Angestellte durften sich als sogenannte Freibürger (Vryburger) im Land niederlassen und Parzellen bewirtschaften. Allerdings mussten sie ihre Produkte an die Kompanie veräußern, die sie ihrerseits an die niederländischen und andere europäische Schiffe weiterverkaufte. Die Parzellen konnten sie, oft auf Kredit, als Eigentum erwerben und erhielten von der Kompanie Besitztitel.
Die Kapkolonie war von der Dynamik ihrer gesellschaftlichen Entwicklung stärker geprägt als von ihren staatlichen Institutionen, die kaum lenkend eingriffen. Die VOC als kommerzielles Unternehmen wollte ihre Ausgaben so gering wie möglich halten, obwohl sie sich von einer Aktiengesellschaft durch die weitreichenden staatlichen Hoheitsaufgaben unterschied, die ihr die Republik der Niederlande eingeräumt hatte, um möglichst effektiv in Asien agieren zu können. In Südafrika erwiesen sich die VOC-Vertreter durchweg eher als kleinliche Pfennigfuchser denn als energische Staatengründer. Die Expansion der Kolonie war ursprünglich überhaupt nicht vorgesehen, weil das ganze Unternehmen nur als Lebensmittelstation geplant war. Hier machten sich bald nicht beabsichtigte Folgen ihres Vorgehens bemerkbar, denn als die VOC den Anbau an Farmer übergab, setzte sie genau die Dynamik in Gang, die am Ende zu einer großen Flächenkolonie führte. Außer Kosten brachte sie der Kompanie aber kaum etwas ein.
Kapstadt wuchs gewissermaßen aus dem Fort heraus. Die Festung, ursprünglich nahe am Strand gelegen, beherbergte zunächst die gesamte europäische Siedlerschaft mitsamt Gouverneur und Soldaten sowie die Gebäude und Magazine der VOC. Doch schon nach wenigen Jahren wurde sie zu klein und die ersten Bewohner begannen, in der näheren Umgebung Häuser zu errichten. Bis zum Ende der VOC-Herrschaft blieb sie der Mittelpunkt der politischen und administrativen Ordnung: Residenz des Gouverneurs, Sitz der Verwaltung und Kaserne. Eine erste einfache Konstruktion aus Holz und Erdwällen wurde schon nach wenigen Jahren durch ein imposanteres Steingebäude mit Wassergraben und dem Grundriss eines fünfzackigen Sterns ersetzt. Dieses Gebäude kann man noch heute in Kapstadt besichtigen.
Wirtschaftlich war in den frühen Jahren der Garten das Herzstück der kleinen Siedlung. Dort bauten Sklaven, von deren rechtlichem und sozialem Status im folgenden Abschnitt ausführlich die Rede sein wird, Obst und Gemüse für die Schiffsbesatzungen an, was ja schließlich der Daseinszweck der ganzen Unternehmung war. Direkt vor dem Garten wurde die Unterkunft der Sklaven errichtet, die heute das kulturhistorische Museum der Stadt beherbergt. Gegenüber stand das Krankenhaus, in dem die Skorbutkranken gepflegt wurden, die mit jedem Schiff hier ankamen. Zwischen dem Kranken- und dem Sklavenhaus befand sich eine Gracht, denn Kapstadt wurde wie viele niederländische Kolonialstädte, etwa Batavia oder Neu-Amsterdam (heute New York), mit Grachten versehen. In Kapstadt dienten sie der Kanalisierung der zahlreichen, sich vom Tafelberg ergießenden Bäche. Einer von ihnen wurde sogar in Form einer Wasserleitung auf eine künstlich angelegte Mole geführt, um die Wasserfässer der Schiffe direkt befüllen zu können. Die Grachten existieren noch heute, verlaufen aber unterirdisch, weil sie seit dem 19. Jahrhundert mit dem heutigen Straßennetz überbaut wurden. Kapstadt unterschied sich von zeitgenössischen europäischen Städten dadurch, dass es nicht ummauert war. Jedoch versuchte bereits der Koloniegründer Jan van Riebeeck, mit einer Dornenhecke die Kaphalbinsel vom Rest des Kontinents zu trennen, um die Khoikhoi fernzuhalten, die immer wieder des Viehdiebstahls bezichtigt wurden. Erst ab dem späteren 18. Jahrhunderts bildeten sich wohlhabendere und ärmere Viertel heraus; bis dahin wohnte Arm und Reich noch Seite an Seite. Bis zum Ende der VOC-Herrschaft 1795 hatte die Stadt mit ihren ca. 15 000 Einwohnern allenfalls die Größe einer Kleinstadt nach heutigen Maßstäben erreicht, wobei die Hälfte der Einwohner Sklaven waren.
Sämtlicher Handel wurde über das Monopol der VOC abgewickelt, weshalb die Bewohner Kapstadts sich auf Dienstleistungen, Handwerk und Kleingewerbe konzentrierten, da sich der Anbau von Lebensmitteln bald ins Umland verlagerte. Selbst der Kompaniegarten verwandelte sich im Lauf des 18. Jahrhunderts in einen reinen Ziergarten, in dem exotische Pflanzen aus Asien die Spaziergänger erfreuten. Schiffsladungen wurden von der VOC-Regierung öffentlich versteigert. Weil es keine festen Läden gab, waren der Handel und die Versorgung der Stadt von Lieferungen abhängig, die sporadisch erfolgten und zeitlich nicht zu kalkulieren waren.
Die Kolonialregierung der VOC in Kapstadt gab den Interessen der Kompanie stets Priorität vor denjenigen der Siedler. Aus VOC-Sicht war das nur zu verständlich, hatte sie doch die Siedlung am Tafelberg einzig zur Versorgung ihrer Ostindien-Segler gegründet. Dennoch war sie immer mit einer negativen Bilanz konfrontiert, denn Südafrika lieferte weder Gewürze noch wertvolle Stoffe, weder Edelhölzer noch wichtige Rohstoffe für das niederländische Gewerbe. Aus der Perspektive der Siedler dagegen war das VOC-Regiment ein Ärgernis, da seine Monopole ihre eigenen wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten beschränkten.
Die kleine Kolonie am Kap der Guten Hoffnung wurde vom javanischen Batavia aus regiert. Bis 1735 gehörte sie administrativ zum Raum des Indischen Ozeans, erst danach wurde die Kolonie direkt den Heren XVII, dem obersten Leitungsgremium der VOC in den Niederlanden, unterstellt. Die Heren XVII waren 17 Delegierte der verschiedenen »Kammern« der VOC, in denen die Städte und Provinzen der Niederlande repräsentiert waren, und nominell die höchste Autorität der Kompanie. Doch aufgrund der Kommunikationsprobleme im Zeitalter der Segelschiffe genoss der Generalgouverneur in Batavia weitreichende Autonomie, auch wenn er seine Entscheidungen im Einvernehmen mit dem ebenfalls dort ansässigen Indienrat der VOC traf. Ihm unterstand das gesamte, weit gespannte Handelsreich der VOC im Raum des Indischen Ozeans, das von Kapstadt bis Nagasaki in Japan reichte. Es umschloss zahlreiche Faktoreien in Indien und auf Ceylon ebenso wie die eher prekären Handelsposten an den Küsten Vietnams und Chinas. Wenn es für die Kapkolonie also eine wirksame Autorität gab, musste sie eher auf Java als in Nordwesteuropa gesucht werden. Doch was für Batavia im Verhältnis zu den Heren XVII galt, bestimmte auch die Beziehungen zwischen Kapstadt und Batavia: Weil die Wege so weit waren und Befehle wie Nachrichten so langsam übermittelt wurden, konnte, ja musste der Gouverneur weitgehend selbstständig entscheiden. Nur eigens ausgesandte Generalkommissare sowie die Admiräle der Ostindienflotten übten eine gelegentliche Kontrolle aus. An der Spitze der Kolonie stand in den Anfangsjahren der Kommandant, dessen Amt unter van Riebeecks Nachfolger Simon van der Stel (Amtszeit 1679–1699) im Jahr 1690 zum Gouverneur aufgewertet wurde. Im 18. Jahrhundert wurden vorzugsweise Männer mit militärischer Erfahrung zu Gouverneuren ernannt, schließlich sollten sie gegenüber den Schiffen und Schiffsgeschwadern anderer europäischer Länder bewaffnete Macht demonstrieren. Das VOC-System in der Kapkolonie war die verkleinerte Kopie dessen, was die VOC in Batavia für den ganzen Indischen Ozean aufbaute. Ähnlich wie der gesamte Handel des niederländischen Kolonialreiches durch Batavia geschleust wurde, fungierte Kapstadt für Südafrika als das Nadelöhr eines von der VOC kontrollierten Handelsmonopols. Wie der Generalgouverneur ohne den Indienrat keine Entscheidungen treffen konnte, so war auch der Gouverneur der Kapkolonie kein Autokrat, sondern an den Politischen Rat gebunden. Dieser war jedoch aus ihm untergebenen Angestellten der VOC zusammengesetzt. Ähnliches galt für den Justizrat, den obersten Gerichtshof, sowie die ihm untergeordneten Gerichte und andere zentrale Einrichtungen wie das Waisenhaus. In allen Gremien mit Ausnahme des Politischen Rates war auch eine Minderheit von Bürgern vertreten, die allerdings von der Regierung berufen und nicht frei gewählt wurde. Diese Verwaltungsstruktur wurde überwuchert von einem Geflecht personaler Beziehungen und Abhängigkeiten, das vom Gouverneur und den hohen Beamten in die subalternen Gruppen der VOC hineinreichte. Das Ergebnis war Vetternwirtschaft und Korruption, die in der Kapkolonie wie in der gesamten VOC im Verlauf des 18. Jahrhunderts immer stärker um sich griffen.
Die Rechtsordnung Südafrikas beruhte auf dem römisch-holländischen Recht, wozu die spezifischen Rechtsartikel kamen, die die VOC in ihrem Einflussbereich im Indischen Ozean, vor allem in Batavia, entwickelt hatte. In der Kapkolonie galten zusätzlich noch die vom Politischen Rat erlassenen Rechtsverordnungen, die sogenannten Plakkaten, eine ergänzende lokale Rechtsgrundlage. Oberste Zuständigkeit für das Recht hatte der Fiscaal, dessen Amt nach dem des Gouverneurs und seines Stellvertreters den dritthöchsten Rang in der Kolonie beanspruchte. Er war unabhängig, weil er direkt an die Heren XVII berichten konnte und von ihnen Weisungen erhielt, d. h. er musste nicht über den Gouverneur oder über Batavia kommunizieren. Seine Funktion war die eines Staatsanwalts und Anklägers. Das Amt bot Chancen für den Aufbau einer unabhängigen Machtstellung, wobei der Fiscaal auch über zahlreiche Bereicherungsmöglichkeiten verfügte. Die eigentliche Rechtsprechung oblag dem Justizrat, dessen Vorsitz zuerst der Gouverneur, später sein Stellvertreter innehatte. Dieses Gericht war für Strafprozesse und alle schwerwiegenden Fälle zuständig, in denen es um einen Streitwert von mehr als 100 Rixdollar (Reichstaler) ging. Daneben gab es einen Gerichtshof für Bagatellfälle, aber keine eigenen Sklavengerichte. Denn Sklaven und Bürger wurden von denselben Gerichten be- und verurteilt. In den Distrikten im Hinterland war der Landdrost als oberster Verwaltungsbeamter der VOC auch der Vorsitzende der lokalen Gerichte, die sich aus den gewählten Heemraden – meist wohlhabende Farmer – konstituierten. Diese Lokalgerichte unterstanden jedoch den Weisungen und der Aufsicht des Justizrates. Sie durften zudem nur Fälle von untergeordneter Bedeutung und von einem Streitwert bis zu 50 Rixdollar behandeln. Die Möglichkeiten des Landdrost wie des Fiscaal, Verhaftungen vorzunehmen, waren eingeschränkt und wurden vom Justizrat kontrolliert. Ebenso wurde die Folter als Befragungsmethode eher selten angewandt, galt aber wie in Europa prinzipiell als legitim.
Die umfassende Kontrolle von oben schloss kirchliche Angelegenheiten ein. Da nur die Reformierte Kirche zugelassen war und die Prediger und Pastoren Angestellte der Kompanie waren, verfügte die Kirche im Gegensatz zu den Niederlanden selbst über keinerlei Autonomie. Vor allem die Gemeinden hatten keine Möglichkeit, ihren Pastor selbst zu wählen. Kapstadt besaß keine Stadtrechte, es galt sogar für lange Zeit nicht einmal als Stadt. Die Verwaltung war streng zentralistisch, eine kommunale Autonomie existierte nicht.
Die VOC erließ kurz nach der Koloniegründung ein ausdrückliches Verbot, die indigene Bevölkerung zu versklaven, da sie fürchtete, dass Übergriffe zu Racheakten und teuren Konflikten führen könnten. Die Heren XVII wiesen van Riebeeck an, die Khoisan als Fremde zu behandeln, die nicht der Kapkolonie angehörten und aus der Gesellschaft der niederländischen Siedlung ausgeschlossen bleiben sollten. Vielmehr sollte er ihnen als externen Handelspartnern begegnen, mit denen der Kommandant wie mit einer auswärtigen Macht Verträge abschließen konnte.
Mit der Gründung der Kolonie änderten sich die Beziehungen rasch, neben den bis dahin zentralen Handel trat nun die Konkurrenz um Land. Denn die VOC belegte die Kaphalbinsel mit Beschlag, sodass die lokalen Khoikhoi ihre bisherigen Weidegründe verloren. Seit 1652 nahmen die Europäer dauerhaft Land in Besitz, um es zu bebauen. Dies führte zu Konfrontationen, wobei die Khoikhoi aufgrund ihrer instabilen politischen Strukturen militärische Anfangserfolge, wie etwa bei einem Angriff auf die europäische Siedlung im Jahr 1659, nicht fortsetzen konnten. Allmählich gewannen die Europäer die Oberhand, zumal sie über Feuerwaffen und vor allem eine bessere Organisation verfügten.
Als sich die Niederländer fest eingerichtet hatten, nahm die Zahl der Schiffe zu, die in der Tafelbucht Halt machten, und damit wuchs auch die Nachfrage nach Fleisch. Dies wiederum hatte zur Folge, dass die Khoikhoi immer schneller ihre Herden verloren, die sie gegen Verbrauchsgüter, wie Tabak, Kleidung oder Metallgegenstände, eintauschten. Zwar gaben die Khoikhoi ihre Rinder nur zögerlich her, weil ihnen bewusst war, dass die Gegengaben der Weißen keineswegs adäquat waren, doch spielten die Niederländer verschiedene Khoikhoi-Gruppen gegeneinander aus und lockten Herdenbesitzer aus dem Landesinneren an die Küste, um dort Handel zu treiben. Die in Küstennähe lebenden Khoikhoi waren nämlich ob des rapiden Rückgangs ihrer Herden alarmiert und gingen europäischen Händlern aus dem Weg. Doch ihre Chiefs wurden nun immer stärker unter die Kontrolle der Kompanie gebracht, was sich in der zeremoniellen Verleihung von Amtsstäben durch den Gouverneur manifestierte. Zudem reagierte Jan van Riebeeck auf die fortgesetzten Diebstähle der Khoikhoi, die freilich andere Eigentumsvorstellungen hatten als die Europäer, indem er Chiefs als Geiseln nahm, um die gestohlenen Güter zurückzuerhalten. Auf diese Weise verschlechterten sich allmählich die Beziehungen und wurden von nachhaltigem Misstrauen gefärbt.
Die VOC begründete ihren Anspruch auf die Kapkolonie mit dem Recht des Eroberers, wodurch die Khoikhoi das Land verloren hätten. Tatsächlich war es ein Prozess gradueller Ausbreitung der Kolonie und der Verdrängung und Unterwerfung der Khoikhoi. In dessen Verlauf kam es zu erstaunlich wenigen kriegerischen Konfrontationen mit den Khoisan, was deren militärische Schwäche belegt, die ihnen offenkundig nur zu bewusst war. So wurden die Khoisan im Lauf der Jahrzehnte immer stärker in die Kolonialgesellschaft hineingezwungen, jedoch ohne ihre rechtliche Stellung formal zu ändern. Bezeichnenderweise äußerte sich die VOC in der Folgezeit dazu gar nicht, was den Schluss zulässt, dass sie die Angleichung der Khoisan an die Position von Sklaven akzeptierte, ohne diesen Schritt rechtlich abzusegnen. Man hielt aus nicht mehr zu rekonstruierenden Gründen lieber an einer Fiktion fest und schuf eine juristische Grauzone.
Als Simon van der Stel 1679 das Kommando über die Kolonie übernahm, gingen die Angriffe vermehrt von den Niederländern aus, die mit verschiedenen Strafaktionen auf tatsächliche oder vermeintliche Übergriffe der Khoikhoi reagierten. Weil die Khoikhoi politisch keine Einheit bildeten, hatten die Niederländer selten Probleme, Verbündete unter ihnen zu finden. Einzelne Chiefs, wie Dorha von den Chainouqua, profitierten davon, weil sie als Mittelsmänner den Viehhandel mit dem Landesinneren organisierten, was der VOC sehr zupass kam.
Im Hinterland pflegte die VOC einen administrativen Minimalismus, indem sie die Zahl der Distrikte so klein wie nur irgend möglich hielt. Darum umfassten sie riesige Territorien, die mit einer Handvoll Personen verwaltet werden mussten. Der höchstrangige Amtsträger in den Distrikten war der Landdrost, ein von Kapstadt ausgesandter Beamter der VOC. Ihm oblagen die Verwaltung, die Rechtsprechung sowie das Oberkommando über die Siedlermiliz und die gelegentlich vorhandenen regulären Truppen. Letztere waren gegen Ende des 18. Jahrhunderts meist farbige Soldaten, die sogenannten Kappanduren, die in Kapstadt stationiert und bei den Weißen besonders verhasst waren, weil sie die Bewaffnung von Nicht-Weißen generell ablehnten. Die zahlreichen Zuständigkeiten des Landdrosts setzten sich bei den ihm untergeordneten Veldkornets fort, die die Unterbezirke verwalteten. Im Gegensatz zum Landdrost wurden sie aus den Reihen der lokalen Notablen gewählt und vom Politischen Rat anschließend ernannt. Diese Universalämter legen beredtes Zeugnis von der marginalen Verwaltung und dem Sparzwang der Kolonialregierung ab. Dem Landdrost stand ein repräsentatives Amts- und Residenzgebäude zu, um das herum sich im Lauf der Jahrzehnte ein kleiner Weiler bildete, mit einer Kirche, einer Schule und kleinen Läden und Handwerksbetrieben. Doch blieben diese Siedlungen winzig und auf die Kolonie bezogen Ausnahmen. Denn der überwiegende Teil der Kolonie war von der Siedlungsstruktur der weit verstreuten Einzelfarmen geprägt, während sich Dörfer oder kleinstädtische Zentren erst im 19. Jahrhundert entwickeln sollten.
Mit wachsender Entfernung von Kapstadt waren die lokalen Vorgänge von der VOC und dem Politischen Rat kaum noch kontrollierbar. Die Veldkornets etwa waren meist einflussreiche und wohlhabende Farmer, die vergleichsweise autonom handeln konnten. Es kam verschiedentlich zu Konflikten zwischen den von Kapstadt entsandten Landdrosten und der lokalen Bevölkerung, wobei die VOC nur über unzureichende Mittel verfügte, ihre Autorität durchzusetzen. Wenn es einem Landdrost nicht gelang, sich in die lokalen Sozialbeziehungen so zu integrieren, dass er über Patronage und die Kooperation mit wichtigen Personen seine Macht festigen konnte, war er bei etwaigen Konfrontationen auf seinen Sekretär und die Handvoll Soldaten angewiesen, die ihm zur Seite gestellt waren.
Mit Simon van der Stel, der insgesamt 20 Jahre als Kommandant die Kolonie verwaltete, stabilisierte sich zwar die Ordnung, doch breitete sich die für die frühe Neuzeit übliche Patronage und Korruption auch am Kap der guten Hoffnung aus. Patronage war der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhielt, ein personales Geflecht von Abhängigkeiten und wechselseitigen Verpflichtungen geschäftlicher wie freundschaftlicher Art, die die realen Machtverhältnisse stärker prägten als die formalen Hierarchien. Van der Stel selbst war Sohn eines niederländischen Vaters und einer asiatischen Mutter, was in der Kolonialwelt der VOC eher die Regel als die Ausnahme war. Als ausgesprochen tatkräftiger Kommandant mit autoritärem Temperament eignete er sich wertvolle Grundstücke an, etwa die Weinfarm Groot Constantia am Fuß des Tafelberges, die den einzigen qualitativ hochwertigen und exportierbaren Wein produzierte. Van der Stel versuchte, eine regelrechte Vorherrschaft seiner Familie zu etablieren.
Zwar konnte er bewirken, dass sein Sohn Willem Adriaan zu seinem Nachfolger (1699–1707) ernannt wurde, doch vermengte dieser Amt und Privatinteressen in einer Weise, dass es zum Streit mit einflussreichen Siedlern kam. Hatte die Kolonie in den ersten Jahrzehnten noch mit Getreide aus Batavia unterstützt werden müssen, produzierte sie nun Überschüsse, was vor allem der Ansiedlung von Hugenotten Ende des 17. Jahrhunderts zu verdanken war. Der Gouverneur nutzte seine Stellung, um die Produkte aus seinen eigenen riesigen Latifundien bevorzugt zu verkaufen, sodass die Farmer das Nachsehen hatten. Allen Drohungen und Repressalien zum Trotz gelang es seinen Gegnern, als ihre Eingaben an der Arroganz des Gouverneurs abgeprallt waren, eine Delegation nach Amsterdam zu schicken. Dort wurden sie bei der VOC-Führung vorstellig und erhoben schwere Vorwürfe wegen Amtsmissbrauchs. Es war ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der VOC, als deren Führung einen Gouverneur seines Amtes enthob. Danach war die Macht der Familie van der Stel gebrochen, obwohl die folgenden Generationen weiter als Großgrundbesitzer in der Kolonie wohnen blieben. Doch hielt die VOC ihre Monopole aufrecht, die die Freibürger als größten Missstand und Haupthindernis der wirtschaftlichen Entwicklung der Kolonie betrachteten.
Die Produktion von Lebensmitteln durch »Freibürger« funktionierte zunächst nicht, da die Farmer zu wenige Arbeitskräfte hatten. Die Kompanie verbot ihnen, die ortsansässige afrikanische Bevölkerung zur Arbeit zu zwingen, weil sie ökonomisch teure Konflikte vermeiden wollte. In den Anfangsjahren setzten sich wirtschaftlich gescheiterte Freibürger sogar ab und reisten mit heimfahrenden Segelschiffen nach Europa zurück. Deshalb beantragte van Riebeeck, Sklaven ins Land zu holen, womit ein Sklavenhandel begann, der von 1658 bis ins frühe 19. Jahrhundert andauerte. Die Sklaven wurden aus dem gesamten Raum des niederländischen Handelsreiches im Indischen Ozean nach Südafrika verschleppt, was fatale Folgen für die weitere Entwicklung der Gesellschaft haben sollte.