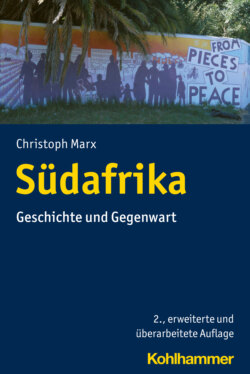Читать книгу Südafrika - Christoph Marx - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Der Zusammenbruch der VOC-Herrschaft und die Konflikte an der Ostgrenze 3.1 Annexion – Rückgabe – erneute Annexion: ein Überblick
ОглавлениеGegen Ende des 18. Jahrhunderts brach die Welt der VOC zusammen. Die Herrschaft der Kompanie am Kap der guten Hoffnung geriet immer stärker unter Druck, was vor allem Folge ihres schwachen Kolonialstaates war. Während in der östlichen Grenzregion am Ende der VOC-Zeit drei Grenzkriege zwischen den weißen Siedlern und den Xhosa aufflammten, bei denen sich rächte, dass die Regierung in Kapstadt keine Konzepte zur Begrenzung der Siedlerexpansion ausgearbeitet hatte, nahm in Kapstadt und den umliegenden Bezirken die Unzufriedenheit unter der weißen Bevölkerung zu.
Neben die alten Klagen über die leidigen Monopole der VOC traten Beschwerden über Ineffizienz und Korruption der Regierung. Wohlhabende Bürger trafen sich 1778, um ihre Kritik zu artikulieren und entsandten, ungeachtet eines vom Gouverneur ausgesprochenen Verbots, ein Jahr später eine Delegation zur VOC-Führung in die Niederlande. Sie verlangten eine Aufhebung der VOC-Monopole sowie die stärkere Beteiligung der Siedler am Politischen Rat, in dem sie die Hälfte der Sitze forderten. Die VOC-Führung arbeitete, wie immer in solchen Dingen, gemächlich und verschleppte die Angelegenheit bis 1783. Weil die 17 Herren ihre Amtsträger in Kapstadt von den Vorwürfen weitgehend freisprachen, wandten sich die Siedler direkt an die Generalstände. Doch selbst nach einer Überprüfung durch die Generalstände blieb die VOC hart. 1792 entsandte sie die beiden Kommissare Nederburgh und Frykenius ans Kap, die einen rigorosen Sparkurs erzwangen, um die VOC vor dem drohenden finanziellen Kollaps zu bewahren. Damit aber verschärften sie die Polarisierung nur weiter und beschleunigten den rapiden Autoritätszerfall der Regierung.
1787 entmachtete die Patriotenbewegung in den Niederlanden die patrizischen Regenten, woraufhin sich der Statthalter nach Großbritannien ins Exil begab. Kurze Zeit später geriet jedoch die Republik der Niederlande in das Kraftfeld der Französischen Revolution. Seit der Intervention in die Amerikanische Revolution hatte Frankreich sich verstärkt auf den Weltmeeren engagiert und im Flottenbau eine regelrechte Aufholjagd begonnen. Dabei hatten die Franzosen ein starkes Interesse am Kap der guten Hoffnung an den Tag gelegt, da dessen Besitz ihnen die Ausbreitung in den Indischen Ozean erleichtert hätte. Als 1795 die französischen Armeen die Niederlande besetzten, schlugen die Briten präventiv zu, um den Seeweg in ihre mittlerweile wertvollste Besitzung Indien zu sichern und um zu verhindern, dass Frankreich sich als neue Macht im Süden Afrikas etablieren konnte. Nach einer Demonstration der britischen Flottenmacht übergab die VOC ihre Kolonie kampflos an die neuen Herren. Die Patriotenregierung der Niederlande löste 1799 die VOC auf, die sie als Instrument der verhassten Regenten ablehnte.
Die Briten hatten 1795 zwar die Kapkolonie erobert, doch zunächst ohne die Absicht, länger zu bleiben. Die britische Herrschaft dauerte bis 1803, denn schon mit dem Abschluss des Friedens von Amiens am 25. März 1802 war allen Beteiligten klar, dass die Kolonie wieder an die Niederländer zurückfallen würde. Knapp ein Jahr später trat die Batavische Republik, ein mit Unterstützung des revolutionären Frankreichs gebildeter niederländischer Staat, das Erbe der Briten an. Nachdem General Napoleon Bonaparte den Frieden von Amiens u. a. mit den Briten abgeschlossen und damit das Wiedererstehen eines unabhängigen niederländischen Staates ermöglicht hatte, gab Großbritannien die Kolonie zurück. Die Batavische Republik verwandelte sich nach demokratischen Anfängen sukzessive in einen autoritären Staat, dem Napoleon mit der Erhebung seines Bruders Louis zum König im Jahr 1806 ein Ende setzte, was für die Briten Anlass zur erneuten Intervention wurde. Als die Feindseligkeiten zwischen Großbritannien und Frankreich einige Jahre später aufflammten, ergriff eine britische Landungstruppe am 19. Januar 1806 in Kapstadt erneut Besitz von der strategisch außerordentlich wichtigen Kolonie. Diesmal blieben die Briten und die Niederländer mussten ihnen das Gebiet in der Londoner Konvention vom 13. August 1814 abtreten, was im umfassenden Vertragswerk des Wiener Kongresses 1815 völkerrechtlich bestätigt wurde. Diese Vorgänge sind primär aus dem europäischen Kriegsgeschehen zu erklären, denn die Regierung des konservativen britischen Premierministers William Pitt schenkte der Südspitze Afrikas sonst wenig Beachtung. Es genügte ihr, dass sich die Franzosen dort nicht festsetzten.
An der Spitze der britischen Verwaltung stand ein Gouverneur, der als hoher Offizier zugleich Oberkommandierender der Truppen war. Ihm kam die höchste legislative, exekutive und rechtsprechende Autorität zu, die von keinerlei Gremien der Siedler mehr beschränkt war. Sicherlich war dies auch eine Vorsichtsmaßnahme, da man die Haltung der niederländischen Bevölkerung zunächst kaum abschätzen konnte. Der Justizrat wurde beibehalten, doch seine Zusammensetzung verändert, denn in ihm saß kein einziger Fachjurist mehr, sondern er bestand nur aus Beamten, die dem Gouverneur verantwortlich waren. Der Fiscaal als wichtigster Beamter verlor ebenfalls seine Unabhängigkeit.
Eine deutliche Veränderung gegenüber den Verhältnissen zur Kompanie-Zeit war die Einführung fester Gehälter für die Beamten, denen verboten wurde, für ihre Dienste eine andere Vergütung anzunehmen. Freilich ließen sich fest eingefahrene Praktiken nicht in kurzer Zeit beseitigen. Ein effizientes Vorgehen gegen Korruption und eine Rationalisierung der Verwaltung konnten erst in den 1820er Jahren erreicht werden.
Sechs Repräsentanten der Bürger Kapstadts traten in einem neugeschaffenen Bürgersenat zusammen, der lediglich lokale Befugnisse hatte, obwohl es nach wie vor keine kommunale Selbstverwaltung gab. Die Bürgervertretung im Justizrat wurde abgeschafft, gleichwohl konnte sich der Bürgersenat allmählich eine informelle Beratungsfunktion und eine Art Repräsentanz für die gesamte weiße Bevölkerung aneignen.
Noch 1795 lebten in der Kolonie nur 20 268 Bürger. Zwar wuchs diese Zahl durch natürliche Vermehrung, aber auch durch Zuwanderung, in erster Linie von britischen Soldaten, vergleichsweise schnell an – nämlich bis 1805 auf 25 727. Viele lebten in Kapstadt, das damals insgesamt 15 000 Einwohner hatte, worunter aber auch die große Zahl Sklaven gezählt werden muss. Keine andere weiße Siedlung konnte sich auch nur annähernd mit Kapstadt messen. Stellenbosch, die zweitälteste weiße Ortschaft Südafrikas, hatte im Jahr 1800 lediglich 1100 Einwohner, Swellendam 200. Um 1806 betrug die weiße Bevölkerung der beiden sehr ausgedehnten östlichen Distrikte ganze 7000 Personen, sie hatte gegen Ende des 18. Jahrhunderts aber stark zugenommen.
In der ländlichen Verwaltung rührten die Briten bis in die 1820er Jahre nicht an die bestehenden Verhältnisse und beließen sogar Niederländisch als offizielle Verkehrssprache im Hinterland der Kolonie. Die einzige Veränderung war die Etablierung der neuen Distrikte Tulbagh und Uitenhage unter den Bataviern im Jahr 1804 und weiterer Distrikte im Osten während der zweiten britischen Besatzung. Die Briten sorgten dafür, dass in den kleinen ländlichen Zentren, in denen Drosteien existierten, Schulen und Kirchen gebaut wurden. Allerdings blieb es im Schulbereich trotz aller aufklärerischen Bemühungen der verschiedenen Regierungen bei der engen Verbindung von Staat und Kirche. Wegen der verstreuten Siedlungsweise der Farmer machte die Verbesserung der Bildung nur äußerst langsame Fortschritte, was auch den geringen finanziellen Mitteln geschuldet war.
Die Briten bedienten sich der verfügbaren lokalen Beamten aus der Kompaniezeit, sowohl aus Kostengründen als auch, um ihre gute Gesinnung gegenüber den Buren zu zeigen und sich deren Oberschicht zu verpflichten. Kulturelle oder sprachliche Gegensätze zwischen Briten und den niederländisch sprechenden Siedlern fielen kaum ins Gewicht. Die Kolonialverwaltung zeigte sich sehr darauf bedacht, Befürchtungen der Siedler, sie würden von der fremden Macht schlechter behandelt, durch ein generöses Verhalten zu entkräften. Alle bestehenden wirtschaftlichen Privilegien der Siedler wurden anerkannt und garantiert. Zudem trugen die Briten zur Verbesserung der ökonomischen Situation bei, indem sie eine ganze Reihe verhasster Monopole aus der VOC-Zeit abschafften.
Praktiken, die als nicht mehr zeitgemäß galten, wurden beseitigt, wozu vor allem die Folter und die brutalen Formen der Todesstrafe gehörten, wie das Vierteilen oder Aufs-Rad-Flechten, während die Todesstrafe selbst beibehalten wurde. Die Vertreter der Batavischen Republik änderten nichts an dieser Entscheidung, da diese Neuerungen sich gut mit ihrem Reformprogramm vereinbaren ließen. Dies galt auch für die Religionsfreiheit, die die britische Regierung verkündete. Bereits am Ende der VOC-Herrschaft war das religiöse Monopol der reformierten Staatskirche aufgeweicht worden. Die Regierung hatte den meist deutschen und skandinavischen Lutheranern unter ihren Angestellten und Siedlern im Jahr 1780 den Bau einer lutherischen Kirche in Kapstadt genehmigt. Die Briten führten allgemeine religiöse Toleranz ein, die nicht auf die Protestanten beschränkt blieb, sondern sogar andere Religionen, wie das Judentum und den Islam, einschloss. Gerade der Islam konnte so erstmals aus seinem bisherigen Untergrunddasein heraustreten. Die Muslime durften Moscheen bauen und aktiv missionieren. Die winzige islamische Gemeinschaft unter den Sklaven und Freien Schwarzen begann sich im 19. Jahrhundert auszubreiten. Die Muslime gehörten in dieser Zeit ausschließlich der sunnitischen Glaubensrichtung an und bauten im Lauf des 19. Jahrhunderts Kontakte zur islamischen Umma, insbesondere nach Mekka und Istanbul, auf. Juden durften sich mit dem Beginn der britischen Herrschaft erstmals in der Kolonie niederlassen. Erste kleine Gemeinden von Ashkenasim entstanden in Kapstadt sowie in Kleinstädten wie Oudtshoorn. Ihre Zahl blieb bis ins späte 19. Jahrhundert sehr gering, die meisten von ihnen betätigten sich im Kleinhandel, oft als reisende Händler, sog. smouse, die im Auftrag von Kapstädter Kaufleuten die Farmen mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgten.
Außer Verhandlungen mit den unabhängigen Xhosa jenseits der Kolonialgrenze, um diese zu sichern und damit Kosten für etwaige Truppen in der Gegend auf dem absoluten Minimum zu halten, geschah während der acht Jahre britischer Besatzung nicht viel. Immerhin erforschten die Briten ihre neue Kolonie und entsandten verschiedene Expeditionen, die wertvolle Berichte über die Zustände im Hinterland lieferten. Der Bericht von John Barrow aus den Jahren 1797 und 1798 sollte Nachwirkungen haben, da Barrow scharf konturierte Kollektivportraits der angetroffenen Bevölkerungsgruppen zeichnete. Während er die Xhosa als edle Wilde charakterisierte, die ihn an antike Gestalten erinnerten, kamen bei ihm die Buren ausgesprochen schlecht weg. Er stellte sie als brutal, sadistisch, faul und provinziell dar und schuf damit Vorurteile, die bis in die Zeit nach dem Burenkrieg fortwirkten.