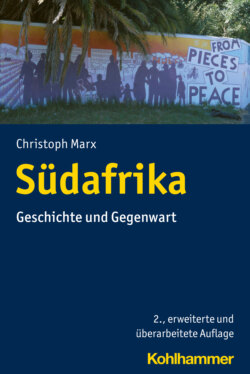Читать книгу Südafrika - Christoph Marx - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4 Die Anfänge der christlichen Mission
ОглавлениеDie VOC hatte bis fast zum Ende ihrer Herrschaft das religiöse Monopol der calvinistischen Kirche aufrechterhalten, welche weder unter den Sklaven noch unter den Khoisan missionierte und sich in Südafrika ganz ähnlich wie in den asiatischen Besitzungen der VOC verhielt. Nur zwischen 1737 und 1743 genehmigte die VOC die Tätigkeit eines Missionars der Herrnhuter Brüdergemeine unter den Khoisan, allerdings unter der Bedingung, dass er sich auf die religiöse Unterweisung beschränkte und von Taufen absah. Der Handwerker Georg Schmidt ließ sich im Süden der Kolonie in der Baviaans Kloof (Pavianschlucht) nieder und missionierte einige Jahre höchst erfolgreich. Als es jedoch ruchbar wurde, dass er doch Taufen vorgenommen hatte und die benachbarten Farmer zunehmend aggressiver reagierten, weil er ihnen angeblich die »faulen« Khoikhoi-Arbeiter weglockte, musste er die Kolonie wieder verlassen.
Die Herrnhuter bekundeten wiederholt ihr Interesse an einer Wiederaufnahme ihrer Missionsarbeit und sie durften noch vor der Aufhebung des kirchlichen Monopols der Reformierten während der ersten britischen Besatzung zurückkehren. Im Jahr 1792 erreichten drei ihrer Missionare Kapstadt und machten sich bald daran, an derselben Stelle in der Baviaans Kloof, die sie in Genadendaal umbenannten, mit der Missionsarbeit zu beginnen. Die Anfeindungen der Nachbarn waren ähnlich wie die, die Georg Schmidt auszustehen hatte, doch die Missionare gaben sich alle Mühe, die Khoikhoi zu braven Untertanen zu erziehen und damit ein besseres Verhältnis zu den Farmern aufzubauen, was ihnen langfristig auch gelang. Die Herrnhuter hatten aufgrund ihrer Verfolgungserfahrung in Europa den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit zu ihrer Maxime erhoben und vermittelten diese Haltung auch ihren Konvertiten. Dadurch beruhigten sich die Gemüter und die Herrnhuter Mission erreichte sogar ein friedliches Verhältnis zu den benachbarten Farmern, allerdings verzichtete sie auf die soziale und politische Emanzipation der Khoikhoi.
Im späten 18. Jahrhundert wurden Europa und Nordamerika gleichermaßen von religiösen Erweckungsbewegungen erfasst, die von eher informellen evangelikalen Bewegungen innerhalb etablierter Kirchen bis zur Neugründung kirchlicher Gemeinschaften wie der Methodisten durch John Wesley reichten. Dieses Great Awakening war eine der Ursachen für die im späten 18. Jahrhundert sich in Großbritannien formierende Massenbewegung gegen den Sklavenhandel. Vor diesem Hintergrund der religiös-moralisch gespeisten Abolitionsbewegung ist auch die Entstehung verschiedener Missionsgesellschaften in Großbritannien und auf dem europäischen Kontinent in diesen Jahren zu sehen. Die für das südliche Afrika wichtigste war zunächst die 1795 gegründete London Missionary Society (LMS), in der vor allem Nonkonformisten vertreten waren, also Angehörige protestantischer Glaubensrichtungen, die nicht in der anglikanischen Kirche beheimatet waren. Aufgrund ihrer heterogenen protestantischen Zusammensetzung verzichtete die LMS auf eine eindeutige theologische Festlegung. Ihre Missionstätigkeit in Südafrika begann mit einem Angehörigen der niederländischen Oberschicht, dem Intellektuellen und Offizier J. T. van der Kemp (1747–1811), der sich 1799 am Sunday River niederließ, wo er die Station Bethelsdorp gründete. Van der Kemp unterschied sich von späteren Missionaren, da er die christliche Heilsbotschaft von der europäischen Kultur und dem Zivilisierungsanspruch trennte. Dies hatte zur Folge, dass er sich in seiner Lebensweise den Khoikhoi der Grenzregion, unter denen er missionierte, anpasste und z. B. barfuß und ohne Hut herumlief, was europäischen Forschungsreisenden, die ihn besuchten, als skandalöses Verhalten eines Angehörigen der sozialen Elite erschien. Aber gerade wegen seiner Bereitschaft, sich auf die Kultur der Khoikhoi einzulassen, war van der Kemp gemeinsam mit seinem engsten Adlatus James Read besonders erfolgreich. Bethelsdorp wurde ein Zufluchtsort für Khoikhoi, die sich den Drangsalierungen durch weiße Farmer zu entziehen versuchten, was zu einem denkbar schlechten Verhältnis zwischen Missionaren und Farmern führte.
Freilich waren die Khoikhoi keine leeren Behälter, die nun mit dem Wein des Christentums gefüllt wurden, sondern sie entwickelten vor dem Hintergrund ihrer eigenen Religion ein eigenes Selbstverständnis als Christen und neue Rituale. Reisende berichteten erstaunt von der außerordentlichen Emotionalität der religiösen Zusammenkünfte, die mit heftigen Tränenausbrüchen verbunden waren und oft nachts abgehalten wurden, worin sich eine Verbindung christlicher Glaubensinhalte mit der großen Bedeutung des Mondes in den religiösen Traditionen der Khoikhoi äußerte.
Mit den Missionaren erschienen weitere wichtige Akteure an der Frontier, die je nach Lage von den übrigen Beteiligten für die eigenen Zwecke eingespannt werden konnten. Van der Kemp verbreitete nicht nur die christliche frohe Botschaft unter den Khoikhoi, sondern er vermittelte ihnen über die Missionsschule auch westliche Bildung, ohne jedoch von ihnen eine Anpassung ihrer Lebensweise, Kleidung oder Alltagsverhalten an europäische Vorbilder zu verlangen. Doch andere Vertreter der LMS teilten seine Ideale keineswegs. Sie waren überzeugt, dass sich die christliche Botschaft nicht von der europäischen Kultur und Lebensweise trennen ließ und beharrten darauf, dass alle christianisierten Afrikaner sich der europäischen Zivilisation assimilieren müssten. Mit dieser Haltung erschwerten sie ihre eigene Arbeit unter den bantusprachigen Afrikanern ganz erheblich, da sie so zentrale Institutionen wie die Polygamie und lobola, den sog. »Brautpreis«, zu einem Kernproblem ihrer Missionstätigkeit erhoben. Des Weiteren bestanden diese Missionare auf einer klaren geschlechtlichen Arbeitsteilung nach europäischem Muster. Für sie war es ein Zeichen von afrikanischer Barbarei, dass die Frauen die Felder bestellten, was sie als Versklavung durch ihre »faulen« Männer werteten, wohingegen nach ihrem Dafürhalten Frauen ins Haus gehörten.
Als van der Kemp 1811 starb und ruchbar wurde, dass Read unverheiratet mit einer jungen Khoifrau zusammenlebte, nutzten ihre Gegner die günstige Gelegenheit, um die ganze Richtung, für die die beiden standen, zu desavouieren und nunmehr ganz auf die Kombination von christlicher mit zivilisierender Mission zu setzen. Hinzu kam, dass 1812 noch auf Betreiben van der Kemps und Reads ein reisender Gerichtshof in den Osten der Kolonie kam, um den von beiden gesammelten Vorwürfen nachzugehen, dass die burischen Farmer systematisch ihre Landarbeiter misshandelten und ausbeuteten. Die eingeschüchterten Zeugen waren jedoch nicht bereit, ihre früheren Aussagen zu wiederholen, sodass die Untersuchung der Juristen mit einem Sieg der Farmer endete, was aber deren Ressentiments gegenüber den Missionaren keineswegs dämpfte.
Zwar hatten die Khoikhoi gleichen Zugang zu den Gerichten wie die Weißen – und dieses Recht wurde ihnen nach 1795 mehrfach ausdrücklich bestätigt – doch in der Realität sah es anders aus: Kaum ein Khoikhoi fand den Mut, seinen Herrn anzuklagen aus Angst vor Repressalien seines Herrn und sogar des Richters. Der Richter war in der Regel der Landdrost oder einer seiner Beamten, die selbst Farmer waren. Die britische und batavische Verwaltung versuchten, schriftliche Arbeitsverträge einzuführen, um die Rechtssicherheit der Khoikhoi zu erhöhen, doch ohne großen Erfolg. Neben diesen eher papierenen Rechten mussten die Khoikhoi weitere reale Einschränkungen ihrer Freiheit hinnehmen. 1797 und 1798 wurde in Verordnungen festgelegt, dass alle Khoikhoi verpflichtet seien, in den Distrikten Swellendam und Graaff-Reinet, d. h. dem größten Teil der Kolonie, Pässe bei sich zu tragen, sobald sie die Farm ihres Herrn verließen. Mit diesen Verordnungen sollten die Khoikhoi fester an die Farm gebunden werden. Faktisch wurden sie ihren Herren noch schutzloser ausgeliefert. Ein Khoikhoi, der seinen Herrn beim Landdrost verklagen wollte, musste auch dafür von ihm einen Pass erhalten. Es kam häufig vor, dass die wenigen Khoikhoi, die es wagten, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen und die auf dem Weg zum Landdrost waren, von anderen Farmern als Landstreicher aufgegriffen und in die eigenen Dienste gezwungen oder misshandelt wurden. Hinter diesen Maßnahmen stand allerdings auch die Angst vor der wachsenden Zahl geflüchteter Khoikhoi, die sich mangels Lebensalternativen zu Räuberbanden formierten.
Als 1799 der Aufstand der Buren an der Ostgrenze erneut aufflammte, benutzten hunderte von Khoikhoi die Gelegenheit, von den Farmen zu flüchten und sich in größeren Gruppen zusammenzuschließen. Sie zogen sich zum Teil in unzugängliche Gebiete zurück, etliche begaben sich unter den Schutz der Xhosa, viele suchten in den folgenden Jahren Zuflucht auf den Missionsstationen. Die meisten aber kehrten nach einiger Zeit aus purer Not wieder in den Dienst weißer Farmer zurück. Der Bericht des batavischen Gouverneurs Janssens nach einer Reise in die östlichen Grenzgebiete im Jahr 1803 war für die Buren nicht sehr schmeichelhaft:
»Die Grausamkeiten gegenüber den Hottentotten übersteigen alles, was man in Kapstadt davon hört, ja, was man sich überhaupt vorstellen kann. […] Klagen über das Zurückhalten von Kindern, Vieh, Lohn, und dergleichen mehr, sind dermaßen zahlreich, dass diese kaum aufzuzählen wären, ohne ein ganzes Buch zu füllen. Unterricht! Unterricht! fehlt ihnen vor allem; sie nennen sich selbst Christen, die Kaffern und Hottentotten dagegen Heiden, und auf Grund dessen glauben sie zu allem berechtigt zu sein. Ein Bruder von Thomas Ferreira, der glaubt über einige Bildung zu verfügen, hat die Entdeckung gemacht, dass die Hottentotten die Nachkommen der verfluchten Rassen von Ham seien, und darum von Gott zu Dienstbarkeit und Misshandlung verdammt.«2