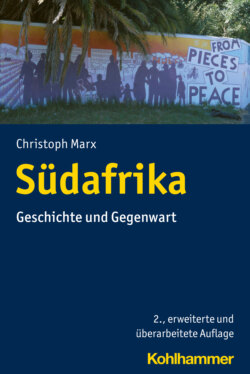Читать книгу Südafrika - Christoph Marx - Страница 12
2.2 Die Entstehung einer Sklavereigesellschaft
ОглавлениеDie Niederländer haben die Sklaverei keineswegs neu erfunden, schließlich waren die Niederlande im 17. Jahrhundert eines der freiesten Länder der Welt, in dem auch Frauen mehr Rechte hatten als in anderen europäischen Gesellschaften. Doch die VOC passte sich in Asien schnell den lokalen Verhältnissen an und übernahm die Institution der Sklaverei. Zwischen der Gründung der VOC und derjenigen der Kapkolonie vergingen 50 Jahre, in denen sich die Angestellten und Funktionsträger an das System der Sklaverei gewöhnten. Jan van Riebeeck kam aus Batavia und kannte Sklaverei aus erster Hand, sodass es für ihn nahe lag, diese Institution auch in Südafrika einzuführen. Da die VOC die Versklavung der einheimischen Bevölkerung untersagte, musste van Riebeeck die Sklaven von außerhalb holen, weswegen er sich an die Regierung in Batavia wandte. Schon sechs Jahre nach Gründung der Kolonie kamen die ersten Sklaven aus Asien in Kapstadt an, denen in der gesamten Zeit der VOC-Herrschaft noch viele folgen sollten, insgesamt ca. 63 000. Anfangs kaufte die Kolonie sogar selbst Sklaven ein, wozu sie Schiffe nach Madagaskar schickte. Später wurden die meisten von VOC-Schiffen, die auf dem Weg in die Heimat waren, mitgebracht und in Kapstadt entweder an die Kompanie oder an Privatleute verkauft.
Etwa ein Viertel der Sklaven kam aus Südasien, d. h. aus Indien und Ceylon, und weitere 20 % stammten aus dem Zentrum des niederländischen Reiches in Südostasien, etwa ein Viertel aus Madagaskar und der Rest von den ostafrikanischen Küstenregionen. Die meisten Asiaten wurden über Batavia nach Südafrika gebracht, lebten ursprünglich jedoch auf den kleineren Inseln wie den Molukken, auf Sulawesi, Bali oder Timor. Durchreisende Schiffe, die auf dem Rückweg nach Europa waren, verkauften diese Sklaven einzeln oder in kleinen Gruppen in Kapstadt. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammten Sklaven in größerer Zahl aus Mosambik, da in bezeichnender rassistischer Stereotypisierung Afrikaner als besonders geeignet für die Feldarbeit eingeschätzt wurden.
Der Anteil der Geschlechter war sehr ungleich, da Frauen im Durchschnitt nicht mehr als 20 % der nach Südafrika gebrachten Sklaven ausmachten; ihr Anteil wuchs selbst bis Ende des 18. Jahrhunderts nur auf etwa 30 %. Dies bedeutete, dass sich die meisten Sklaven nicht fortpflanzen konnten, weshalb während der gesamten Zeit der VOC-Herrschaft der Zustrom an Sklaven nicht abriss. Hinsichtlich des unausgeglichenen Geschlechterverhältnisses, aber auch im Hinblick auf die kurze Lebenserwartung vor allem der männlichen Sklaven glich die Kapkolonie in fataler Weise dem menschenverschlingenden System der Karibik. Die Zahl der Sklaven wuchs von wenigen Dutzend in der Amtszeit van Riebeecks auf 25 754 zu Beginn der britischen Herrschaft, sodass die Sklaven gegenüber den weißen Siedlern seit dem frühen 18. Jahrhundert ständig in der Mehrheit waren. Bereits 1717 gab es 2523 Sklaven in der Kolonie. Die meisten von ihnen arbeiteten im Wein- und Getreideanbau in der Nähe Kapstadts, wo sich Ausbeutungsverhältnisse einspielten, die denjenigen auf Plantagen der Neuen Welt ähnelten. Obwohl es Sklavenbesitzer gab, die über 100 Sklaven ihr Eigen nannten, besaßen sie meist mehrere Farmen, weshalb die Zahl der Sklaven pro Farm eher klein war.
Im Hinterland, wo nicht so viele Sklaven zur Verfügung standen und stattdessen die landlos gewordenen Khoikhoi als billige und faktisch unfreie Arbeitskräfte arbeiteten – obwohl sie nominell frei blieben – kam es zu sexuellen Kontakten zwischen männlichen Sklaven und Khoikhoifrauen. Kinder aus solchen Beziehungen, die sogenannten »Bastard-Hottentotten«, blieben ebenfalls frei, da die Mutter frei war, konnten aber seit 1775 als unfreie Arbeitskräfte bis zum 25. Lebensjahr auf den Farmen festgehalten werden.
Es gab zwei Kategorien von Sklaven. Die geringere Anzahl von Sklaven war Eigentum der Kompanie. Sie wurden in Kapstadt selbst, nämlich in der Festung, im Hafen, bei öffentlichen Arbeiten, eingesetzt. Sie waren in der bereits erwähnten sogenannten Slave Lodge in unmittelbarer Nähe zu den Feldern und Gärten der Kompanie untergebracht. Ihre Zahl betrug während des gesamten Zeitraums zwischen 400 und 650 Personen. Die Mehrheit der Sklaven gehörte indes Privatpersonen sowohl in Kapstadt als auch in den ländlichen Gebieten.
Bei den Privatsklaven können drei Gruppen unterschieden werden: Erstens diejenigen, die in Kapstadt lebten und meist im Haushalt ihrer Herren eingesetzt wurden, zweitens diejenigen in der näheren Umgebung Kapstadts und drittens die kleinere Zahl, die im Hinterland der Kolonie lebte. Die Situation der Sklaven in der Stadt war die erträglichste, denn viele beherrschten ein Handwerk. Sie arbeiteten als Maurer, Schreiner und Maler, als Köche oder Fischer. Manche waren in spezielleren Handwerken tätig, die ihren Herrn entsprechende Einkünfte eintrugen. Im Lauf der Jahrzehnte wurde handwerkliche Tätigkeit mit dem Stigma der Sklaverei behaftet, weshalb weiße Siedler schon im 18. Jahrhundert kaum noch Handwerker wurden. Kluge Sklavenbesitzer schufen Anreize, indem sie ihren Sklaven die Gelegenheit boten, selbst etwas Geld zu verdienen. Dies eröffnete diesen langfristig die Aussicht, sich die Freiheit zu erkaufen. Freigelassene Sklaven schlossen sich der kleinen, fast ausschließlich auf Kapstadt begrenzten Gruppe der sogenannten »freien Schwarzen« an, von denen trotz der Bezeichnung die Mehrheit nicht afrikanischer, sondern asiatischer Herkunft war. Diese ehemaligen Sklaven und ihre Nachkommen kauften ihrerseits Sklaven, aber offensichtlich erwarben diese oft nicht sehr wohlhabenden Menschen ihre Sklaven hauptsächlich, um sie so bald wie möglich in die Freiheit zu entlassen. »Kreolische« Sklaven, die in der Kapkolonie geboren waren, wurden allgemein besser behandelt, da sie bereits in die Sklaverei hineinsozialisiert waren und als weniger renitent galten.
Das Sklavereiregime war auch in Kapstadt nicht frei von Brutalität, wobei vor allem jede Form von Insubordination mit grausamen Körperstrafen geahndet wurde, von öffentlichen Auspeitschungen über Marterungen bis zur Exekution. In den 150 Jahren der VOC-Herrschaft am Kap wurde im Durchschnitt ein Sklave pro Monat exekutiert, d. h. insgesamt verloren rund 1800 Menschen so ihr Leben. Die hohe Hinrichtungsrate erklärt sich aus der Angst der VOC vor Aufständen. Tatsächlich gab es aber kaum Aufstände, weil die Sklaven zu verstreut und isoliert voneinander lebten. Formen des Widerstands waren eher Flucht, Brandstiftung, Sabotage oder Diebstahl.
Ganz anders sah es in den ländlichen Regionen in der näheren und weiteren Umgebung von Kapstadt aus. Die reichen und mächtigen Farmer, die sog. Cape Gentry, die neben ihrer Familienfarm ein Stadthaus in Kapstadt hatten, besaßen oft zahlreiche Sklaven, die für sie auf den Feldern und in den Weinbergen schuften mussten. In ihren Stadthäusern mussten die Sklaven im Haushalt arbeiten und allerlei Dienstleistungen erbringen, wozu im 18. Jahrhundert die modische Fortbewegung mit der Sänfte gehörte, die von Sklaven getragen wurde.
Die VOC trug dafür Sorge, dass ihre eigenen Sklaven, die in der Slave Lodge lebten, getauft wurden. Doch folgten ihr die Bürger in dieser Praxis keineswegs, denn eine nicht ganz eindeutige Beschlusslage der calvinistischen Synode von Dortrecht im Jahr 1618 hatte zur Taufe aufgefordert, aber die rechtlichen Folgen nicht klar artikuliert. Viele Sklavenbesitzer fürchteten, getaufte Sklaven nicht mehr verkaufen zu können oder gar gezwungen zu sein, sie freizulassen. Aus diesem Grund blieb die Zahl der getauften Sklaven bis zum Ende des 18. Jahrhunderts minimal, was zur Folge hatte, dass eine Minderheit von Sklaven sich dem Islam anschloss. Die Gleichheitslehre des Islam bot eine willkommene Alternative zur egalitären Botschaft des Christentums, die ihnen verwehrt blieb. Nur in Kapstadt aber waren die Kontakte unter den Sklaven intensiv genug, um den Islam zu verbreiten.
Abb. 2: Sklave und Aufseher.
Die Gruppe der Sklaven, die am meisten zu leiden hatte, war die zahlenmäßig größte, nämlich die jungen Männer. Während sie auf den Feldern und Weinbergen oder in Kapstadt zu schweren körperlichen Arbeiten eingesetzt wurden, waren die Frauen fast ausschließlich in den Haushalten als Köchinnen, Ammen, Haushaltshilfen tätig und etliche mussten mehr oder weniger freiwillig auch sexuell zur Verfügung stehen. Unverheiratete Männer entwickelten zu ihren Konkubinen oft ein Vertrauensverhältnis, was die vergleichsweise hohe Zahl von Freilassungen weiblicher Sklaven erklärt, allerdings meist erst testamentarisch, d. h. nach dem Tod ihres männlichen Herrn. Da insbesondere javanische Frauen als Köchinnen tätig waren, etablierte sich die südostasiatische Küche in Südafrika. Aber auch die Architektur der Wohnhäuser begann sich frühzeitig von derjenigen der Niederlande zu unterscheiden. Die für niederländische Städte typischen Häuserzeilen mit ihren dem Wasser zugewandten Giebelseiten setzten sich wegen der hohen Feuergefahr aufgrund der häufigen Stürme in Kapstadt nicht durch. Aus demselben Grund verschwanden die mit Reet gedeckten Häuser aus Kapstadt, während sie noch heute in Städten wie Stellenbosch, Paarl oder Tulbagh zu sehen sind. Sie wurden durch Häuser mit Flachdächern ersetzt, was Kapstadt ein auch in Südafrika einzigartiges architektonisches Gepräge gab. Weil Sklaven in den Häusern ihrer Herren wohnten, waren diese oft sehr groß, insbesondere die Küchen, in denen die Sklavinnen meist den ganzen Tag und die Nacht verbrachten. Die männlichen Sklaven waren entweder in einem eigenen Gebäudeteil oder in eigenen Behausungen untergebracht, weswegen ländliche Häuser Grundrisse in Form eines H oder L annahmen, da die Sklaven nie in unmittelbarer Nähe der Wohn- und Schlafräume ihrer Herren wohnten.
Die Anwesenheit der Sklavinnen im Zentrum der Haushalte hatte noch andere Folgen, da sich dort ein Assimilierungsprozess an die Lebensformen der Europäer abspielte, der vor allem ihren Nachwuchs unmittelbar prägte. Die Sklaven, insbesondere die »kreolischen«, d. h. die in Südafrika geborenen, wurden in die weißen Haushalte integriert und assimiliert, weshalb der südafrikanische Sklavereihistoriker Robert Shell mit Recht auf deren Bedeutung als Keimzellen der südafrikanischen Rassenordnung hinweist. Die verstreute Siedlungsform von Familienfarmen, die oft weit voneinander entfernt lagen, trug das ihre zu dieser Entwicklung bei. Die Sklaven blieben meist ortsansässig, selbst wenn die Farmen verkauft wurden, da sie als lebendes Inventar mitveräußert wurden. Sklaverei in Südafrika nahm damit auch Züge dessen an, was man im Fall unfreier Arbeit in Europa als »Bindung an die Scholle« bezeichnet. Dieses System wurde später auf die Khoisan- und Bantu-Bevölkerung ausgedehnt.
Die zwangseingewanderten männlichen Sklaven blieben stärker ihrer Herkunftskultur verhaftet, konnten sie aber in der Regel nicht weitergeben, da die meisten unverheiratet blieben. Die Situation von Sklavinnen war oft besser als diejenige ihrer männlichen Leidensgenossen, da sie eher Aussicht auf Freilassung hatten. Denn auch unter den Weißen gab es einen Mangel an Frauen, insbesondere waren Soldaten davon betroffen. So kam es immer wieder vor, dass sich eine stabile Beziehung zwischen einem weißen Mann und einer Sklavin entwickelte, sodass der Mann seine Gefährtin und ihre gemeinsamen Kinder schließlich freikaufte. Etlichen dieser Nachkommen gelang die Integration in die spätere »weiße« Gemeinschaft, sodass zahlreiche prominente Familien der späteren Machtelite des Apartheidstaates »nicht-weiße« Vorfahren hatten.
In Neuengland war ähnlich wie in Südafrika Land im Überfluss vorhanden, aber im Gegensatz zu Südafrika gab es für Neueinwanderer viele Alternativen zur Landwirtschaft. Beide Faktoren, Überfluss an Land und Knappheit an Arbeitskräften, führten dazu, dass die nordamerikanischen Farmer frühzeitig in Technik investierten. In Südafrika wurde bereits kurz nach der Gründung der Kolonie ein anderer Weg eingeschlagen. Hier suchte man die knappen Arbeitskräfte durch Zwangsarbeiter zu vermehren. Mit der Einführung der Sklaverei etablierte sich das Muster der administrativen Manipulation des Arbeitsmarktes, das sich dauerhaft verfestigen sollte. Die Bereitstellung billiger Arbeitskräfte prägte die Politik und Wirtschaft des Landes bis in das späte 20. Jahrhundert. Tatsächlich wurde diese Frage im Politischen Rat 1716 diskutiert, wobei man zum Schluss kam, dass unfreie Arbeit billiger und darum vorzuziehen sei. Daraufhin entschied die VOC-Leitung, keine weitere Einwanderung freier Siedler zuzulassen und verlegte sich darauf, den Zustrom von Sklaven zu sichern. Ebenso wurden lohnabhängige Weiße, die sogenannten Knechte, im Lauf der ersten Jahrzehnte der weißen Besiedlung durch unfreie Arbeitskräfte verdrängt. Die meisten Knechte wurden Lehrer für die Farmerskinder oder Handwerker in Kapstadt; später verschwanden sie als Gruppe vollständig und gingen in der weißen Farmbevölkerung auf.
Weil die Region um Kapstadt zugleich die wohlhabendste war und die Meinungsführer der weißen Bevölkerung dort lebten, entwickelten die dortigen Verhältnisse eine normative Kraft, die weit ins Hinterland ausstrahlte. Obwohl die Mehrzahl der Sklaven im Westen der Kolonie blieb und die indigene Bevölkerung nicht versklavt wurde, wirkten die unfreien Arbeitsverhältnisse wie ein Pilz, der sich in die gesamte Gesellschaft hineinfraß. Tatsächlich glichen sich die Arbeitsverhältnisse für Sklaven und Khoikhoi ungeachtet der Tatsache, dass letztere formal frei blieben, einander immer mehr an. Insofern kann man von einer faktischen Sklaverei sprechen, denn mit Hilfe zunächst lokaler Passgesetze und anderer Formen rechtlicher Ungleichheit wurde ihre Freiheit drastisch beschränkt. Gerade im Westen der Kolonie, im unmittelbaren Hinterland Kapstadts, entstanden die eindeutigsten Hierarchien zwischen Freien und Unfreien im Kontext der Landwirtschaft. Eine Stereotypisierung nach Herkunft schuf bereits die Grundlage für den späteren Rassismus, da man Sklavengruppen bestimmte Eigenschaften zuschrieb und über die Dichotomien von frei – unfrei, Landbesitzer – Landloser, Christ – Heide den Rassismus präformierte, zu dem im Lauf des späten 18. Jahrhunderts dann der Gegensatz von hell-dunkel trat.
Die Folgen der Sklavenhaltung sind bis in die Gegenwart spürbar, denn die Sklavenhalter übten ein Züchtigungsrecht aus, das sie alsbald als ein generelles Recht gegenüber Untergebenen auf ihren Farmen beanspruchten. Die häufige Anwendung von Körperstrafen und eine brutale Strafjustiz der VOC gegenüber Sklaven förderten die Entstehung einer Gewaltkultur. Die ausufernde Gewalt im gegenwärtigen Südafrika ist nicht nur ein Erbe der jüngeren Apartheid-Vergangenheit, sondern hat ihre Wurzeln in der tiefen sozialen Kluft zwischen Freien und Unfreien. Auch der Umgang der weißen Behörden im 20. Jahrhundert mit der schwarzen Bevölkerungsmehrheit, die als Problem und nicht als Bürger behandelt wurde, dürfte seine Ursprünge in einer Gesellschaft haben, in der die Sklaven wie Ware verkauft werden konnten, in der die Buschleute wie Tiere gejagt und getötet wurden und in der unfreie Arbeitsverhältnisse auf immer weitere soziale Kreise und immer größere Räume ausgedehnt wurden.