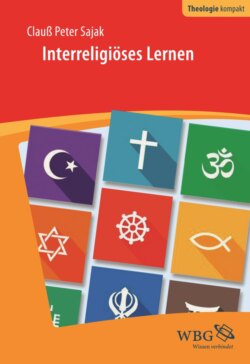Читать книгу Interreligiöses Lernen - Clauß Peter Sajak - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Migration und Säkularisierung
ОглавлениеDie religiöse Landkarte der Bundesrepublik Deutschland hat sich vor allem durch zwei Phänomene entscheidend verändert: Migration und Säkularisierung.
Deutschland als Einwanderungsgesellschaft
Als Migration dürfen die großen Einwanderungswellen bezeichnet werden, die mit den sog. Gastarbeitern aus Südeuropa und der Türkei spätestens Mitte der 1960er Jahren begannen. In den 1990er Jahren folgten Kriegsflüchtlinge aus den Balkanstaaten, Aus- bzw. Übersiedler aus Polen, Rumänien und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Nach der Jahrtausendwende kamen zunehmend Migranten aus dem Maghreb und Afrika nach Europa und damit auch immer nach Deutschland. Und zuletzt haben die über anderthalb Millionen Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, die vor Krieg und Barbarei aus Syrien, Afghanistan und Pakistan geflohen sind, vor allem die Zahl der Muslime anwachsen lassen.
Deutschland als säkularisierte Gesellschaft
Mit dem Begriff Säkularisierung wird dagegen der durch verschiedene Faktoren verursachte Relevanzverlust der beiden großen christlichen Bekenntnisse markiert: War schon durch die deutsche Wiedervereinigung 1990 die Zahl der Menschen ohne religiöses Bekenntnis zu einer erheblichen Größe geworden, so hat in den letzten fünfundzwanzig Jahren ein dramatischer Traditionsabbruch in den kirchlichen Milieus von Katholiken wie Protestanten stattgefunden, der sich vor allem im religiösen Leben und in der Glaubenspraxis von christlichen Familien, Verbänden und Gemeinden zeigt: So sinkt seit der Wiedervereinigung die Zahl der Taufen in der evangelischen wie katholischen Kirche kontinuierlich, wobei dies nicht nur mit dem demographischen Wandel, sondern auch mit der bewussten Entscheidung evangelischer und katholischer Eltern zusammenhängt, die eigenen Kinder nicht mehr taufen zu lassen. Die Quote der sonntäglichen Gottesdienstbesucher hat sich inzwischen auf 3,6 (Angaben der Evangelischen Kirche in Deutschland für 2013) bzw. auf gut 10 Prozent (Angaben der Deutschen Bischofskonferenz für 2015) eingependelt.
Stichwort
Säkularisierung
Säkularisierung (von lat. saeculum = Zeitalter, Jahrhundert, im Mittelalter auch die Welt[zeit]) wird oft mit dem Kunstwort ‚Verweltlichung‘ übersetzt. Unter dieser Rubrik werden in der Regel Prozesse zusammengefasst, die einen nachhaltigen Bedeutungsverlust von Religion im privaten wie öffentlichen Leben bewirken. Der Vorgang der Säkularisierung ist kein Phänomen der letzten Jahrzehnte, sondern ein Grundzug der Ideengeschichte der Neuzeit. So findet sich der Begriff Säkularisation bereits im Zusammenhang mit dem Westfälischen Frieden von 1648, wo er die Überführung von Kirchengütern in weltliches Eigentum bezeichnet. Entsprechend wurde der Begriff auch 1803 im Reichsdeputationshauptschluss verwendet: Hier meinte Säkularisation die Entschädigung der deutschen Fürsten für den Verlust ihrer linksrheinischen Besitztümer mit den enteigneten Kirchengütern. Als im Zuge der europäischen Aufklärung die Sphären von Welt und Religion, von Staat und Kirche sowie von Wissenschaft und Theologie immer deutlicher auseinander traten, hat vor allem Ernst Troeltsch das Fremdwort Säkularisierung aus dem oben erwähnten historischen Kontext abgeleitet und auf die zunehmende Entfremdung von Kirche und Staat im 19. Jahrhundert angewendet.
Religiosität bei Kindern und Jugendlichen
Auch für den Bereich der Kinder- und Jugendreligiosität muss festgestellt werden: Zwar empfangen die meisten katholisch getauften Kinder später auch die Erstkommunion und das Firmsakrament, doch ist die Wahrnehmung vieler, die sich in Katechese, Religionsunterricht und Jugendarbeit engagieren, ernüchternd. Im evangelischen Bereich ist für die Konfirmandenarbeit Analoges zu beobachten. Bei den Kindern und Jugendlichen beider Konfessionen zeigt sich seit einigen Jahren ein mehr oder weniger vollständiger Traditionsabbruch: Elementare Vollzüge christlicher Glaubenspraxis sind unbekannt oder werden wegen des mangelnden Unterhaltungswertes abgelehnt, fundamentale christliche Glaubensinhalte sind gar nicht bekannt oder werden zumindest rasch wieder vergessen, Sinn- und Wertentscheidungen in der konkreten Alltagswelt werden ohne religiöse Kontextualisierung und Begründung getroffen – mit dem eigentlichen Leben hat Religion nichts zu tun. Mit Charles Glock (1969), einem der Klassiker der Religionssoziologie, gesprochen: Von den fünf Dimensionen, die Religiosität ausmachen, lässt sich bei den meisten katholischen Kindern und Jugendlichen nur die rituelle Dimension – und zwar beschränkt auf Lebenswendsakramente und sporadische Gottesdienstbesuche zu Weihnachten – erkennen. Die vier anderen Dimensionen – lebensrelevante religiöse Vorstellungen, konkrete religiöse Erfahrungen, religiöses Wissen und die religiöse Ausstrahlung in das Alltagsleben – scheinen nicht mehr vorhanden zu sein.
Religionssoziologische Entwicklungstheorien
Auf der Ebene des religionssoziologischen Diskurses wird seit Jahrzehnten nach Ursachen für diese Entwicklungen, die sich nicht nur in Deutschland, sondern in ausnahmslos allen europäischen Ländern mehr oder weniger ausgeprägt finden lassen, gesucht. Inzwischen hat sich doch eine Mehrheit der Forscherinnen und Forscher für die Säkularisierungstheorie als Modell zur Erklärung dieser Phänomene ausgesprochen: „Diese Theorie geht davon aus, dass Prozesse der Modernisierung einen letztlich negativen Einfluss auf die Bedeutung der Religion in der Gesellschaft ausüben und deren Akzeptanz vermindern“ (Pollack 2013: 3). Alternative Theorien wie die Individualisierungstheorie, nach der Religion sich in einer modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft hin zu einer privaten, nicht mehr in den traditionellen Religionsgemeinschaften sichtbaren individualisierten Form entwickelt, (Luckmann 1991: „Die unsichtbare Religion“) oder die Markttheorie, nach der es einen Zusammenhang zwischen dem Bedeutungsverlust von Religion und den monopolisierten Staatskirchen in Europa gebe (Stark 2000), sind inzwischen angesichts der fortschreitenden Entwicklungen in Europa, aber auch in Australien, Kanada und inzwischen auch den USA eher in die Defensive geraten (zusammenfassend Pickel 2013).
Abb. 1 Religionssoziologische Entwicklungstheorien nach Gerd Pickel (2017: 43)
In Zahlen und Daten bildet sich diese Situation wie folgt ab: Das Statistische Jahrbuch des zuständigen Bundesamtes nennt für das Jahr 2015 eine Einwohnerzahl von 82 Millionen. Die Religionszugehörigkeit wird mit 23,7 Millionen Katholiken, 27,1 Millionen Protestanten, 3,6 Millionen Muslimen und 99.692 Juden beziffert. Die Zahl der Menschen ohne Bekenntnis wird mit 29,6 Millionen angegeben (fowid 2016). Damit stellen diese die größte weltanschauliche Gruppe in Deutschland. Die jüngere religionssoziologische Forschung hat allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass diese Menschen eben keine einheitliche Gruppe bilden, sondern – wie eingangs bereits erwähnt – durch maßgeblich vier Haltungen bestimmt sind: religiös Individualisierte, die zwar aus einer Kirche ausgetreten sind, aufgrund ihrer Sozialisation noch religiöse Vorstellungen und Einstellungen haben, religiös Indifferente, die weitgehend areligiös sind, überzeugte Atheisten, die jede Form des Gottesglaubens dezidiert ablehnen und dezidiert Areligiöse, denen Religion und Kirche gleichgültig sind (Pickel 2017: 51).
Tabelle: Religionszugehörigkeit der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2015 nach fowid (2016)