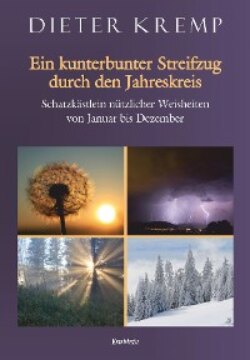Читать книгу Ein kunterbunter Streifzug durch den Jahreskreis - Dieter Kremp - Страница 39
EIN KROKUS KOMMT SELTEN ALLEIN
ОглавлениеKrokusse, sie bilden die ersten bunten Farbtupfer im noch spätwinterlichen Vorgarten, auf Rasen und in Parkanlagen. Kaum eine andere Blume verspricht uns manchmal schon im Februar so charmant, dass es nun bald wieder Frühling wird. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Bei den so früh im Februar blühenden Krokussen handelt es sich nicht um die bekannten großblumigen Gartensorten. Die da so mutig bunte Farbkleckse in den nachwinterlichen Garten malen, sind „Wildkrokusse“ oder „botanische“ Krokusse, die immer mehr Anhänger in Stadtgärtnereien und bei Hausbesitzern finden. Die großblumigen Gartenkrokusse blühen erst rund sechs Wochen später als ihre kleinblütigen Verwandten. In großen Gruppen sind die zart violett, weiß, gelb und blau blühenden Vorfrühlingsboten am allerschönsten; denn „ein Krokus kommt selten allein“.
Die lustigen, blauen, lilafarbenen, weißen und gestreiften Krokusse lassen fast vergessen, dass die Blütenkelche ihrer Vorfahren einst nur in leuchtend gelber Farbe prangten. Und manche erinnern sich an das alte Kinderlied: „Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen: Butter und Schmalz, Eier und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel.“ Doch die kleinen Plappermäulchen wussten natürlich nicht, dass sie den Krokus mit dem arabischen Wort („sa farar“ = „gelbfärben“) besangen.
Keine Märchen aus „Tausendundeiner Nacht“ aber sind die wunderlichen Hintergründe für die Namensgebung dieses reizvollen Vorfrühlingsboten. Aus Safran gewannen die alten Griechen die beliebte gelbe Farbe, mit der sie ihre Prunkgewänder färbten. Aus gelbem Krokus entstanden auch begehrte Gewürze für Speisen und Getränke. Eine mühselige Arbeit, wenn man der Überlieferung Glauben schenken darf, dass 100 000 Krokusblüten nötig waren, um zu einem Kilogramm Safran zu kommen.
Und wer in alten, staubigen Folianten blättert, erkennt bald die einstmalige Bedeutung des heute vergessenen Safran. So liest man voller Staunen die Geschichte eines griechischen Königs, der nur deshalb zu Ruhm und Ansehen gelangte, weil er es fertigbrachte, mit Safran gewürzte Speisen zu essen, ohne sich zu beschmutzen. Dieser wunderliche Bericht wird allerdings verständlich, wenn man bedenkt, dass dereinst noch mit den Fingern und nur erst bei den Griechen mit Hilfe einer für unsere Essengewohnheiten recht unpraktischen, fünfzinkigen Gabel gegessen wurde.
Weitaus rauer ging es um das Jahr 1449 in Nürnberg zu, wo der sonst einigermaßen ehrbare Händler Jobst Friedenskern sein Leben lassen musste, weil er die dunkelgelben Blüten der gewöhnlichen Färberdistel als echten Safran verkauft hatte. Nicht auszudenken, wenn diese barbarische Strafverfolgung heute noch gang und gäbe wäre.