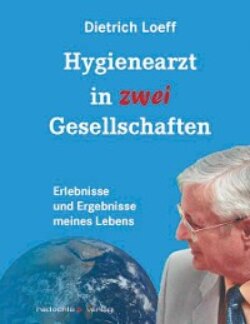Читать книгу Hygienearzt in zwei Gesellschaften - Dietrich Loeff - Страница 34
Katholische Lebens- und Berufsauffassung
ОглавлениеEine weitere Famulatur absolvierte ich im kleinen katholischen Krankenhaus Hedwigshöhe, bei Berlin-Grünau, einer Zweigstelle des bekannteren Hedwigskrankenhauses im Berliner Zentrum. Ich hatte mich dort beworben, weil ich, obwohl damals selbst nur noch Christ pro forma, christliche Menschlichkeit aus der Nähe kennen lernen wollte. Schon die Anmeldung bot eine Überraschung. Frage der Anmeldeschwester: „Religion?“ Ich stutzte – diese Frage war in der DDR unzulässig und unüblich. Sie sah mein verdutztes Gesicht und entschied kühl: „Also evangelisch“ und traf es damit. Offenbar wurden die Ergebnisse dieser Befragung nicht nur notiert. Als wir Famuli – wir waren im ganzen Hause wohl drei – eines Tages in unseren Aufenthaltsraum kamen, lag kommentarlos ein großer Bildband auf dem Tisch. Er zeigte in ausgezeichneten Fotos mit Erläuterungen Prozessionen zum katholischen Fronleichnamsfest. Das Vorwort widmete den Prachtband ausdrücklich den Menschen nicht-katholischen Glaubens. Sie sollten bildhaft sehen, welche seelisch erhebenden Feiern Katholiken begehen und wie große Menschenmassen die Kirche mobilisieren konnte. Wir blätterten das Buch sorgsam durch und damit war die Sache erledigt. Niemand sagte uns, er habe es hingelegt, niemand fragte uns, ob es uns gefiele. Einige Tage später war der Band wieder fort. Da wir in keiner Weise bedrängt wurden, nahmen wir die Sache als faires geistliches Angebot, das uns zu nichts verpflichtete.
Im Krankenhaus Hedwigshöhe begegnete ich zum ersten Mal im Leben Nonnen, Krankenschwestern, die dem Boromäer-Orden angehörten. Ihre große, klapperhart gestärkte Haube war hinderlich beim Telefonieren, denn sie konnten den Hörer nur außen an die Haube halten. Wer das wusste, sprach am Telefon etwas laut mit ihnen. Das Telefon in ihrer Hand, dazu meist die moderne Armbanduhr am Handgelenk bildeten zur mittelalterlichen Tracht einen seltsamen Kontrast, der ihnen aber nicht mehr bewusst war. Trotz ihres Verzichts auf Sexualität, Ehe, Familie, Kinder fand ich in ihnen überwiegend lebensfrohe Naturen, die vielleicht zufriedener mit sich und der Welt waren, als andere Menschen, die sich weniger Verzicht auferlegten – für mich ist das bis heute erstaunlich aber unverständlich und keinesfalls nachzuahmen.
Eines Tages fiel vor den Ohren einer Krankenschwester der alltägliche Satz: „Wenn ich sterbe, dann möglichst rasch, am besten im Schlaf.“ Das galt damals wie auch meist heute als oft geäußerter Wunsch. Die Schwester aber protestierte lebhaft: „Das ist Sterben wie ein Hund! Ich will mich richtig und ordentlich von der Welt verabschieden, ehe ich gehe.“ Ich war beeindruckt, wenn auch nicht überzeugt: so hatte ich das nie gesehen. Sehr bald erlebte ich das Gesagte in der Praxis. Eine tief gläubige Patientin wusste, dass sie nur noch wenige Stunden zu leben hatte. Sie empfing die Tröstungen des Hausgeistlichen und auch die besonders liebevollen Worte und Pflegemaßnahmen der Schwestern. Dann starb sie gefasst. Kommentar der Schwestern: „So kann man nur im festen Glauben an Gott sterben. Wir haben hier schon manchen Parteifunktionär sterben sehen. Sie alle verloren beim unausweichlichen Ende die Beherrschung und starben elend und in Angst“.
Mir war es damals einfach wichtig, auch diese Haltung, die von meiner eigenen doch spürbar abwich, unmittelbar kennen zu lernen. Wie ich heute weiß, wollen auch gläubige Muslime ihr Sterben bewusst gestalten. Sie versammeln ihren Familienkreis um sich und fragen: „Gibt es noch eine unbeglichene Schuld?“(6) Und von antifaschistischen Widerstandskämpfern im Zuchthaus berichtet die Literatur, sie hätten zwischen Verhören und Foltern noch ihre letzten Kenntnisse und Meinungen an die Mitgefangenen übermittelt „weil mir vielleicht dafür keine Zeit mehr bleibt“.
Chef des Hauses Hedwigshöhe und gleichzeitig Chefchirurg war ein Dr. Pochhammer, selbst natürlich gläubiger aber in diesem Punkte schweigsamer Katholik. Er war durch die Ehe mit der Tochter eines großen Pharma-Betriebsinhabers zu viel mehr Geld gekommen, als er im Beruf je verdienen konnte. Man munkelte von Millionen, was damals noch mehr als heute bedeutete. Für seinen Lebensunterhalt brauchte er sich die Belastungen des Chefchirurgen keineswegs aufzuladen. Aber er war der Meinung, dass ein Mann im besten Leistungsalter nicht faulenzen dürfe. An ihm war zweierlei zu beobachten: Sein Geld beruhigte ihn spürbar und seine aufreibende Arbeit machte ihn offenbar zufrieden.