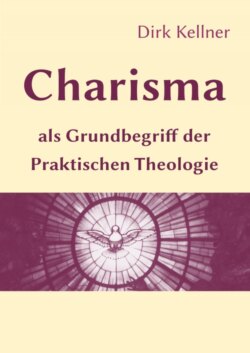Читать книгу Charisma als Grundbegriff der Praktischen Theologie - Dirk Kellner - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.3 Johann Christoph Blumhardt: Die Verheißung des Geistes und seiner Gaben
ОглавлениеJohann Christoph Blumhardt geht nicht wie Schleiermacher vom idealistisch geschauten Reichtum der wahren Kirche, sondern vom real erfahrenen Mangel der sichtbaren Kirche aus. Sein Verständnis der Charismen ist aufs Engste mit der Klage über die geistliche Armut der Kirche und mit der für ihn eigentümlichen sehnsüchtigen Erwartung einer erneuten Ausgießung des Pfingstgeistes verbunden.[177] Wenige Jahre vor dem Ende seines Lebens gibt Blumhardt in den «Blättern aus Bad Boll» über diese «Hoffnung des Heil[igen] Geistes» Rechenschaft und erinnert sich, dass er seit seiner Kindheit an der Diskrepanz zwischen dem, was in der Schrift über die Wirksamkeit des Geistes und seiner Gaben bezeugt ist, und der von ihm wahrgenommenen kirchlichen Wirklichkeit gelitten habe.[178] Stets war das «Bewußtsein von einer Armuth» mit einer «eine[r] Sehnsucht nach dem geheimnißvollen Etwas» verbunden.[179] In den Möttlinger Erfahrungen, v.a. im Kampf mit den «Banden der Finsternis», erfuhr Blumhardt «einen Anfang» von dem, was er sich für die ganze Menschheit erhofft: «eine neue Ausgießung des Heil[igen] Geistes».[180] Zwar sei «Vieles von dem ersten Feuer» inzwischen wieder zurückgetreten und ihm selbst sei aus dieser Zeit «nur von einer gewissen Gabe für Kranke […] etwas geblieben», doch blieb ihm umso mehr die «Sehnsucht nach der Rückkehr des Verlorenen»[181]. Die Erfahrungen der geistlichen und speziell der charismatischen Armut der Kirche verbindet er mit einer eigentümlichen geschichtstheologischen Konstruktion, in der das orthodoxe Verständnis der Charismen als «dona miraculosa antiquae ecclesiae» (Pfanner; → 2.1.6) nachklingt: «Durch fortwährendes ‹Betrüben des Heil. Geistes› von Seiten der Christenheit»[182] habe sich der persönlich im Glaubenden wohnende Pfingstgeist mitsamt seinen Gaben nach der Apostelzeit immer mehr zurückgezogen und sei schließlich verschwunden.
«Wo sind denn die Gaben, mit und in welchen der Heil. Geist jetzt noch fortwirkt, und als ewig wirkend sich zu erkennen gibt? Wenn die Gaben doch irgendwo wären, so müßten sie sich bemerklich machen; aber man weiß nirgends von solchen, wenn auch viel Edles da und dort zu finden ist.»[183]
Erst in einer von Blumhardt in unmittelbarer Nähe erwarteten dritten Heilszeit werde es zu einer erneuten Ausgießung des Geistes bzw. – wie Blumhardt später präzisiert – zu einer Fortsetzung der sich schon in der Apostelzeit wiederholenden Ausgießungen des Geistes kommen und damit zugleich zu einer neuen Wirksamkeit der geistlichen Gaben.[184] Blumhardt zeigt sich in diesen Anschauungen einerseits abhängig vom traditionellen Verständnis der Charismen als wunderhafte und nunmehr vergangene Größen.[185] Andererseits aber überlässt er sie nicht der Vergangenheit einer vermeintlich einzigartigen Urzeit, sondern gewinnt sie neu für die Zukunft der Kirche. Die Charismen sind Gegenstand der Verheißung Gottes und Bestandteil der sehnsuchtsvollen Erwartung, mit der sich die Kirche auf eine geistliche Erneuerung ausrichtet.
Die umfassendste Darlegung seines Charismenverständnisses bietet Blumhardt in der Abhandlung «von den geistlichen Gaben», veröffentlicht in den «Blättern aus Bad Boll» (Nr.37/1876). Er ermahnt die Glaubenden, in Geduld und Demut auf eine erneute Ausgießung des Geistes mit einer umfassenden Austeilung der geistlichen Gaben zu warten.[186] Er warnt ausdrücklich davor, sie für sich selbst als «etwas Habituelles und Bleibendes» zu erstreben, «statt demüthig um ein Durchkommen im einzelnen Fall, mit stets wiederholten Hilfsleistungen von oben» zu bitten.[187] In einem eigenmächtigen Streben nach dem Besitz von geistlichen Gaben sieht Blumhardt einen ungeistlichen Unabhängigkeitsdrang, mit dem sich der Mensch von Gott lösen, und einen Geltungsdrang, mit dem er sich über den Nächsten erheben will.
«Denn es sieht sich an, als ob man sich’s nur bequemer machen wollte, um nicht immer wieder den Heiland bitten zu müssen, wenn man’s vermöge der innwohnenden Gaben von selbst, und dann gewissermaßen sicher machen könnte. Warten wir, bis es dem Herrn gefällt, im Ganzen und Großen die Kräfte des Heiligen Geistes auszugießen; und daß diese Zeit beschleunigt werde, dürfen wir immerhin bitten […]. Soll Er etwas geben, so muß Er es von sich aus thun. Um dieses aber kann und darf ich nicht bitten, ohne vor Ihm und Andern anmaßend zu erscheinen, weil ein Gelüste darin liegt, darum hoch angesehen zu werden vor den Menschen.»[188]
Von den in Demut zu erwartenden «eigentlichen ächten geistlichen Gaben» unterscheidet Blumhardt die «natürlichen Gaben». Sie sind «angeboren, im eigenen Geiste des Menschen wurzelnd», können aber «durch Nachdenken, Studium, Fleiß, Uebung, Ausdauer […] sehr gesteigert werden».[189] Weil sie aber «nie als unmittelbar von oben gegeben» erscheinen, unterliegen sie der Gefahr des Irrtums und sind «um so gefährlicher, weil sie gerne mit einer gewissen Macht auftreten, und überwältigend für kleinere Geister werden»[190]. Trotz dieser Warnungen schreibt Blumhardt den natürlichen Gaben in einer Morgenandacht zu 1Petr 4,10 eine hohe Bedeutung für den Aufbau der Gemeinde zu:[191] Im Vergleich zu den Gaben der Apostelzeit sind die heutigen zwar «nicht mehr dieselben», aber dennoch «ist ihrer Vielen Vieles gegeben». Durch den gegenseitigen Dienst, «durch Belehren, durch Ermahnen und Warnen, durch Besuche, durch tröstliche Aufrichtung, durch Hilfeleistungen mit Rath und That»[192], soll nicht nur der Gesamtheit der Glaubenden geholfen werden, vielmehr «hängt das Leben der Gemeinden, ja der ganzen Kirche [daran], dass man viel nach allen Richtungen einander dienen lerne».[193] Die gegenwärtige kirchliche Wirklichkeit sieht Blumhardt allerdings auch bei der Praktizierung der natürlichen Gaben in einem Widerspruch zur biblischen Weisung. Die Mehrheit der Gläubigen «lassen Alles liegen und überlassen Alles nur dem Amt»[194]. Dadurch liege nicht nur «die geistliche Pflege der Einzelnen durch Einzelne […] ganz darnieder»[195], auch das Amt könne nicht viel ausrichten, wenn ihm die Gaben der Gemeinde nicht dienend zur Seite stehen. So bleibt Blumhardt auch im Blick auf die natürlichen Gaben nur die sehnsüchtig bittende Hoffnung auf ein Wirken des heiligen Geistes: «Hoffen wir auf solche Gnadenzeit, welche die Christen auch wieder regsamer für einander machte!»[196]
Blumhardt ist einer der ersten Theologen, der den Mangel an Charismen als Anzeichen einer geistlichen Armut der Kirche versteht und sich durch die biblische Verheißung zu einer erneuerten «Erwartung des Geistes und seiner Gaben und Kräfte»[197] führen lässt. So problematisch die geschichtstheologische These vom Verschwinden des Geistes und die skeptische Geringschätzung der vorhanden Charismen ist, so bedeutsam ist doch die Wiedergewinnung des promissionalen Charakters der Charismen und ihrer Bedeutung für eine geistliche Erneuerung der Kirche. Mit diesen Ansichten ist Blumhardt seiner Zeit weit voraus und findet bei seinen Zeitgenossen nur wenig Verständnis – am wenigsten bei seinen Amtskollegen und den Theologen.