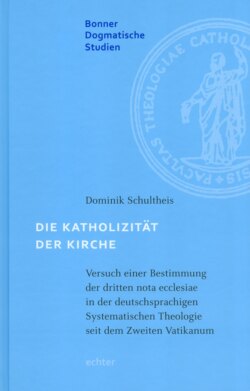Читать книгу Die Katholizität der Kirche - Dominik Schultheis - Страница 45
1.5Die Verwendung in UR
ОглавлениеEin weiteres am 21.11.1964 verabschiedetes Dekret ist dasjenige über den Ökumenismus, welches – wie Edmund Schlink mit Verweis auf die Relatio zur Vorlage der zweiten Fassung konstatiert – von „Lumen Gentium“ her zu lesen ist290. Das Dekret verwendet von allen Konzilsdokumenten am häufigsten, nämlich neunundvierzigmal, das Adjektiv bzw. Substantiv „catholicus“/„catholicitas“ (vgl. UR 1; 3,1.2.4.5; 4,1.3.4.5.6.7.8.10.11; 8,2.3; 9; 10,2.; 11,1.2.3; 13,3; 14,4; 15,4; 17,2; 18; 19,1.3; 20; 21,3; 23,3; 24,1.2).
Das erst in der letzten Fassung ergänzte Vorwort des Dekrets benennt die unmittelbare Förderung und langfristige Wiederherstellung der Einheit der Christen als wesentliche Hauptziele des Konzils (vgl. UR 1,1), deren innerer Motor in der von Christus gewollten Einheit und Einzigkeit des Christentums liegt.291 Die ökumenische Bewegung wird im zweiten Absatz als Werk des Hl. Geistes qualifiziert und als solche ausdrücklich gewürdigt als das vielfältige Bemühen vieler Christen um die „eine[…] und sichtbare[…] Kirche Gottes“ (UR 1,2). In UR 1,3 drücken die Konzilsväter ihre Freude über die ökumenische Bewegung aus; sie geben ihre Ausführungen „allen Katholiken“ („Catholicis omnibus“) – „catholici“ wird hier im Sinne der Denominationsbezeichnung „römisch-katholisch“ verwendet292 – als „Hilfen, Wege und Weisen“ (UR 1,3) an die Hand, damit diese sich ihrer Berufung zur Einheit hin bewusst werden und ihr öffnen.
Die folgende Überschrift des ersten Kapitels des Dekrets: „Die katholischen Grundsätze des Ökumenismsus“ („De catholicis oecumenismi principiis“) beinhaltet ebenfalls das Adjektiv „catholicus“; auch hier wird „katholisch“ im Sinne der Konfession „(römisch-)katholisch“ verwendet. Betrachtet man die lange Genese293 des Dekrets, fällt auf, dass im ersten Schema „De Oecumenismo“ vom 23.4.1963 gegenüber dem zweiten Schema vom 24.4.1964 und dem endgültigen Text die Überschrift des ersten Kapitels noch anders lautete, nämlich: „Die Grundsätze des katholischen Ökumenismus“ („De Oecumenismi catholici principiis“)294. Mag die formale Änderung auch marginal wirken, so ist mit ihr doch dasjenige untermauert, was inhaltlich bereits im Prooemium zum Ausdruck gebracht wird, dass nämlich das Konzil keinen „(römisch-)katholischen Alleingang“ in der Ökumene beschreitet, sondern die außerhalb ihrer selbst initiierte Ökumenische Bewegung, auch ohne Mitglied im Weltkirchenrat (ÖRK) zu sein, anerkennt und ausdrücklich begrüßt.295
In UR 2 ist nicht expressis verbis von der (römisch-)katholischen Kirche die Rede; zumindest sucht man in diesem Artikel das Adjektiv „catholicus“ vergeblich. Und doch ist davon auszugehen, dass die Konzilsväter die Auffassung vertreten, dass die hier beschriebene Kirche Jesu Christi in der (römisch-)katholischen Kirche subsistiert (vgl. LG 8). Im Zusammenhang mit der vom Schreiben der Glaubenskongregation: „Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten“ (2007) wieder angestoßenen Diskussion um das „subsistit in“296 ist mit Feiner zu sagen:
„Da aber der Text deutlich sagt, dass die Kirche in der von Christus gewollten, insbesondere auch durch die Nachfolger Petri gewährleisteten Einheit durch die Zeiten schreite, lässt er auch keinen Zweifel, dass nach katholischem Glaube die Kirche Christi eben in der katholischen Kirche verwirklicht ist, die auch die erwähnten sichtbaren Elemente der Einheit aufweist. Trotzdem ist es für die folgende Darlegung entscheidend, dass hier Kirche Christi und katholische Kirche nicht einfach identifiziert werden und dass anstatt ‚Kirche Christi’ nicht einfach ‚katholische Kirche’ gesagt wird. Damit bleibt die Frage offen (die im folgenden Text beantwortet wird), ob die Kirche Christi nicht auch in anderen christlichen Glaubensgemeinschaften auf irgendeine Weise gegenwärtig sei. Wenn die Kirche, wie es in diesem Artikel geschieht, als Communio gesehen wird, d.h. als komplexe Gemeinschaftswirklichkeit, deren Einheit durch zahlreiche und verschiedenartige Faktoren bewirkt wird, so bleibt die Möglichkeit offen, dass sich auch in christlichen Glaubensgemeinschaften außerhalb der katholischen Kirche kirchenbildende Elemente vorfinden, die diesen Gemeinschaften kirchlichen Charakter verleihen. Die eine Kirche Christi kann also auch außerhalb der katholischen Kirche gegenwärtig sein, und sie wird insoweit präsent sein – und zwar auch sichtbar –, als einheit- und damit kircheschaffende Faktoren und Elemente wirksam sind. Würde die Kirche nur vom juristischen Begriff der Societas (perfecta) her beschrieben, […] so würde die Kirche an den Grenzen der katholischen Glaubensgemeinschaft aufhören und außerhalb deren gäbe es nur ‚Nichtkirche’. Wird die Kirche hingegen als Communio gesehen, zu deren Einheit verschiedene Faktoren zusammenwirken, so kann auch von dem, der die volle (wenn auch unvollkommene) Verwirklichung der Kirche Christi in der katholischen Kirche im Glauben festhält, die kirchliche Wirklichkeit außerhalb der katholischen Kirche erfasst werden. Diese Sicht entspricht dem ‚subsistit’ in der Kirchenkonstitution, das an die Stelle des früheren ‚est’ gesetzt wurde […]. Diese Formulierung der Kirchenkonstitution, die eine schlechthinnige Identifizierung von Kirche Christi und katholischer Kirche vermeidet, ermöglicht die Anerkennung des kirchlichen Charakters der nichtkatholischen christlichen Glaubensgemeinschaften.“297
UR 2 formuliert also, ohne ausdrücklich von der katholischen Kirche als sichtbarer Konkretion der wahren Kirche Jesu Christi zu sprechen, die Sichtweise der (römisch-)katholischen Kirche von der Kircheneinheit auf der Basis des von in LG 8 grundgelegten Selbstverständnisses und benennt diejenigen Faktoren, die aus ihrer Sicht zur kirchlichen Einheit notwendig sind. Von dieser so gelegten auf LG fußenden Grundlage her wird in den folgenden Artikeln sowohl das Verhältnis der getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften zur (römisch-)katholischen Kirche umrissen (Artikel 3) als auch die ökumenische Bewegung näher erläutert, und es werden Verhaltens- und Handlungsanweisungen an die (römisch-)katholischen Gläubigen gegeben (Artikel 4).
Artikel 3 verwendet insgesamt acht Mal das Adjektiv „catholicus“. Fünf Mal ist in UR 3,1 von der „katholischen Kirche“ („Ecclesia catholica“) die Rede und je einmal in UR 3,2 sowie UR 3,4; hier wird „catholicus“ jeweils im konfessionellen Sinne gebraucht.
UR 3,5 bringt mit der um „Christus“ erweiterten und in der Wortstellung veränderten Formulierung „die katholische Kirche Christi“ („catholicam Christi Ecclesiam“) sodann die Bezeichnung „katholisch“ im Sinne der qualitativen Katholizität ins Spiel. Dürfte diese Bezeichnung hier zwar synonym für die (römisch-)katholische Kirche verwendet sein, so wird doch deutlich, dass sich die (römisch-)katholische Kirche als die sakramentale Konkretion der Kirche Jesu Christi versteht, wodurch sie – in sakramentaler Weise – qualifiziert ist, „allgemeine Hilfe zum Heil“ („generale auxilium salutis“) zu sein, da man durch sie und in ihr „die ganze Fülle („omnis salutarium mediorum plenitudo“) der Heilsmittel erlangen“ (UR 3,5) kann. Für unsere Untersuchung scheint bezeichnend zu sein, dass sich die (römisch-)katholische Kirche hier weniger von ihrer rein quantitativen Weite und Ausgedehntheit her versteht, auch wenn diese Sichtweise in der in UR 3,2 explizierten und in UR 3,5 wieder aufgegriffenen Rede von den „Elementen“ bzw. „Gütern“ („omnia bona“) noch anklingen mag; im Vordergrund steht vielmehr ihre sakramental vermittelte qualitative Fülle, die „von Christus herkommt und zu Ihm hinführt“ (UR 3,2). Diese innere, sakramental vermittelte Gnadenwirklichkeit der (römisch-)katholischen Kirche begründet ihre qualitative Katholizität, die am Ende von UR 3,5 eschatologisch geweitet wird: „Obwohl dieses Volk [i.e. die (römisch-)katholische Kirche], solange seine irdische Pilgerschaft andauert, in seinen Gliedern der Sünde verhaftet bleibt, wächst es in Christus und wird von Gott nach seinen verborgenen Ratschlüssen sanft geführt, bis es freudig zur ganzen Fülle der ewigen Herrlichkeit im himmlischen Jerusalem gelangt.“ (UR 3,5). Es ist von der qualitativen Katholizität die Rede, die der (rö-misch-)katholischen Kirche als reale Größe zugesprochen wird, wenn der Dekrettext „konstitutive […] Lebensvollzüge als Ausdruck der inneren Gnadenwirklichkeit betrachtet. Dies geschieht schon in Lumen gentium nicht in einem additiven [quantitativen] Verfahren, sondern in einer ganzheitlichen [qualitativen] Sicht. […] Quantifizierendes Aufrechnen passt nicht zu einem organischen, qualitativen Verständnis von ‚Fülle der Katholizität’.“298
In Artikel 4 lässt sich acht Mal das Adjektiv „catholicus“ (UR 4,1.3.4.5.6), zwei Mal das Substantiv „catholici“ (UR 4,6.8) sowie drei Mal das Substantiv „catholicitas“ (UR 4,7.10) finden. Die Verwendung des Adjektivs „catholicus“ erfolgt zumeist im konfessionellen Sinne, wenn von den katholischen Gläubigen („fideles catholicos“, UR 4,1.5.11), der katholischen Kirche („Ecclesiae catholicae“, UR 4,3.6) oder der katholischen Familie („Familia catholica“, UR 4,5) die Rede ist.
Sicher meinen die Konzilsväter mit der „Ecclesia catholica“ in UR 4,3 die (römisch-)katholische Kirche im Sinne der Denominationsbezeichnung, verwenden das Adjektiv „catholica“ also auch hier vorzugsweise im konfessionellen Sinne. Im Kontext aber wird deutlich, dass dem „catholica“ hier neben seiner konfessionellen Bedeutung zugleich die qualitative Bedeutung von Katholizität im Sinne von „Fülle“ inhärent ist, wie wir es in ähnlicher Weise bereits für UR 3,5 angenommen hatten. UR 4,3 sagt in Form einer Glaubensaussage („credimus“) der Einheit („unitatem“) das in analoger Weise zu, was LG 8 bereits von der Kirche ausgesagt hatte, dass nämlich in der (römisch-)katholische Kirchen die Einheit der Kirche des Glaubensbekenntnisses auf sakramentale Weise unverlierbar („inamissibilem“) subsistiert („subsistere“). Die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, so die Überzeugung der Konzilsväter, streben in der Ökumenischen Bewegung zwar gemeinsam die vollkommene kirchliche Gemeinschaft („perfectam communionem ecclesiasticam“) noch an, die in der einen gemeinsamen eucharistischen Mahlgemeinschaft („in una Eucharistiae celebratione“) ihren Ausdruck findet. Dennoch ist die von Christus geschenkte Einheit bereits unverlierbar, d.h. auch sichtbar in der (römisch-)katholischen Kirche verwirklicht, ohne dass diese aber der Fülle nach identisch ist mit der Einheit der einen und einzigen Kirche Jesu Christi. Vielmehr untersteht die der (römisch-)katholischen Kirche eigene Einheit dem eschatologischen Vorbehalt und muss selbst noch wachsen („crescere“).299
Unter der Voraussetzung, dass die Kirche Jesu Christi in der (römisch-)katholischen Kirche subsistiert, ohne mit ihr absolut identisch zu sein, und in der Annahme dessen, dass der (römisch-)katholischen Kirche daher ein Höchstmaß an Katholizität zukommt, ohne mit derjenigen der Kirche Jesu Christi identisch zu sein, könnte man das Adjektiv „catholica“ in UR 4,4, wo von der „vollen“ katholischen Gemeinschaft („plenam communionem catholicam“) die Rede ist, wieder in einem doppelten Sinne lesen, nämlich sowohl in einem rein konfessionellen Sinne als auch in einem die qualitative Katholizität anzeigenden Sinne. Aus dem Kontext heraus aber dürfte zu schließen sein, dass das Adjektiv „catholica“ hier wohl mehr die Konfession „(römisch-)katholisch“ anzeigt, in die Christen aufgenommen werden, wenn sie aus einer nichtkatholischen Konfession zu dieser übertreten. Wohl aber schwingt das qualitative bzw. quantitative Verständnis von Katholizität immer schon mit und weitet in gewisser Weise den Blick auf die anderen Konfessionen, denn die Rede von der „subsistierenden“ Einheit in UR 4,4 suggeriert, dass in anderen christlichen Konfessionen auch die katholische Gemeinschaft im Sinne von Fülle und Weite (Katholizität) gegeben ist, aber in nicht voller (absoluter, „plenam“), sondern eben in unvollkommener Weise.300
In UR 4,7 sprechen die Konzilsväter expressiv verbis von der Katholizität („catholicitatem“). Anders als in der Gegenreformation wird hier nicht ein rein quantitatives Verständnis der Katholizität im Sinne einer geographischen, universalen Ausbreitung der (römisch-)katholischen Kirche bemüht. Sondern die Konzilsväter stellen das altkirchlichliche, ursprünglich vor allem qualitative Verständnis der Katholizität der Kirche und die damit gegebene Frage nach einer rechten Verhältnisbestimmung von kirchlicher Einheit und Vielfalt in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass spätestens mit dem Ausbilden und Erstarken eines zunehmend absolutistisch verstandenen Petrusdienstes ein hierarchisches Einheitsdenken in der (römisch-)katholischen Kirche Raum gewann, das eine zur Katholizität notwendig immer mitzudenkende Vielfalt und legitime Verschiedenheit immer mehr eingrenzte:
„Die der Kirche wesentliche Einheit wurde weithin mit Einförmigkeit, die Unitas mit Uniformitas gleichgesetzt. Das Ideal war die Durchsetzung der einen und gleichen römisch-lateinischen Liturgie und des einen und selben römischen kanonischen Rechtes in der ganzen katholischen Kirche und die möglichst weitgehende Beaufsichtigung und Leitung aller Gebiete des kirchlichen Lebens durch die römischen Zentralbehörden. […] Dass durch eine derartige uniformistische und zentralistische Praxis die echte qualitative Katholizität der Kirche beeinträchtigt wurde, wurde […][lange] nicht bewusst […]. Auf dem II. Vaticanum brach jedoch dieses Bewusstsein machtvoll durch. Die Reaktion gegen die bisherige Praxis geschah im Namen einer volleren Aktualisierung der Katholizität der Kirche, aus der Überzeugung, dass die praktische und nicht nur theoretische Anerkennung der aus der Schöpfung und aus der Gnadenfülle Christi stammenden Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit unter den Völkern, Menschengruppen und Einzelmenschen keine Beeinträchtigung der echten Einheit der Kirche, sondern die Realisierung der ihr geschenkten Fülle bedeutet. Die häufige Feier nichtrömischer Liturgien während des Konzils durch Bischöfe der unierten Ostkirchen und das Eintreten dieser Konzilsväter für die Eigenart ihrer Kirchen trugen zweifellos nicht wenig zur Weckung eines katholischeren Bewusstseins bei.“301
Nicht nur für die Ökumene, bei der die Einheit der christlichen Kirchen nicht als Aufhebung aller berechtigten und historisch gewachsenen Eigenheiten der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen missverstanden und deren Vielfalt im Sinne einer Rückkehr-Ökumene von einer falsch gedeuteten Uniformität der (römisch-)katholischen Kirche aufgesogen werden darf, sondern auch für das innerkatholische Verhältnis von Universal- und Ortskirche spielt das qualitative Verständnis von Katholizität und die mit diesem einhergehende Spannung zwischen notwendiger Einheit und größtmöglicher Vielfalt eine nicht zu unterschätzende Rolle. UR 4,7 betont als bleibendes katholisches Prinzip die Notwendigkeit der Einheit („in necessariis unitatem“), die unbedingt zu wahren sei („custodientes“), betont zugleich aber – quasi als zweiten Brennpunkt ein und derselben Ellipse – die gebührende Freiheit („debitam libertatem“)302, die „alle in der Kirche gemäß der einem jeden gegebenen Aufgabe sowohl in den vielfältigen Formen des geistlichen Lebens und der Lebensweise als auch in der Verschiedenheit der liturgischen Riten, ja sogar in der theologischen Ausarbeitung der geoffenbarten Wahrheit […] wahren“ (UR 4,7) sollen. Die Konzilsväter erkennen – in dieser Deutlichkeit wohl den Vertretern der katholischen Ostkirchen geschuldet – in der Vielfalt des geistlichen Lebens, der liturgischen Riten und des theologischen Fragens keinen Gegensatz zur unaufgebbaren Einheit der Kirche, sondern vielmehr ein ihr komplementäres, „angemessenes Verständnis von Katholizität im Sinne eines qualitativen Reichtums innerhalb wie außerhalb der römisch-katholischen Kirche“303, welches zu einem tieferen Verständnis des eigentlichen „wahren“ Wesens von Kirche beitragen kann, das vor allem im Zuge der Gegenreformation verstellt worden war und mit der konziliaren Wiederbelebung ihres sakramentalen Verständnisses wieder erhellt wurde. Dass ein solches, weniger rein monistisches, sondern zugleich plurales Kirchenverständis Auswirkungen hat nicht nur auf innerkirchliche Strukturen, sondern auch auf den interkonfessionellen und interreligiösen Dialog, drücken die Konzilsväter dadurch aus, dass – wie UR 4,7 betont – eine wieder qualitativ verstandene Katholizität zugleich deren Apostolizität voller kundtue („simul et apostolicitatem Ecclesiae […] manifestabunt“):
„Wenn die Gläubigen so die Katholizität der Kirche ‚vollständiger manifestieren’, so wird eo ipso auch die Apostolizität der Kirche voller realisiert […]. Der Grundsatz des ‚Apostelkonzils’, ‚keine Lasten aufzulegen als das Notwendige’ (Apg 15,28), die Anerkennung der vielfältigen Charismen, die Bereitschaft des Apostels Paulus, den Juden ein Jude und den Gesetzesfreien ein Gesetzesfreier zu werden (1 Kor 9,20f), sind charakteristisch für die Haltung der apostolischen Kirche. Uniformität und Zentralismus sind gewiss nicht geeignet, die Identität der heutigen Kirche mit der apostolischen deutlich zu machen.“304
Dass der Kirche hiermit – sowohl nach innen als auch nach außen – eine bleibende Aufgabe gesetzt ist, muss nicht eigens erwähnt werden. Wie schwierig allerdings das Ringen um ein angemessenes Verhältnis von notwendiger Einheit und größtmöglicher Vielfalt ist, zeigen nicht nur die innerkatholischen Spannungen um ein rechtes Verständnis der „Communio“-Ekklesiologie und deren Auswirkungen auf das Verhältnis von Universal- und Ortskirche, sondern auch der im Zuge von „Dominus Iesus“ und des Papieres der Glaubenskongregation zu Aspekten der Lehre der Kirche in letzter Zeit zunehmend ins Stocken geratene ökumenische Dialog zwischen den aus der Reformation hervorgegangenen kirchlichen Gemeinschaften und der (römisch-)katholischen Kirche. Die inner- wie zwischenkirchlichen Spannungen und divergierenden Auffassungen dürfen nicht zum Stillstand des Dialoges innerhalb der (römisch-)katholischen Kirche und zwischen den christlichen Kirchen führen, auch nicht zu einem Erstarken zentralistischer Tendenzen des Lehramtes. Vielmehr sollte das vom Zweiten Vatikanum wieder neu ins ekklesiale Bewusstsein gehobene qualitative Verständnis der Katholizität dazu dienen, in der ekklesialen Vielfalt die tiefere Qualität ihrer Fülle zu erkennen, die ihr von Christus her zukommt, ohne ihre Einheit zu gefährden.
UR 4,10 spricht zweimal expressis verbis von dieser notwendigen qualitativen Fülle der Katholizität („plenitudinem catholicitatis“), räumt aber zugleich ein, dass diese sowohl bei den von der (römisch-)katholischen Kirche getrennten Mitchristen als auch in der (römisch-)katholischen Kirche selbst nicht zur voll Entfaltung kommt, solange die Spaltung der christlichen Kirchen aufrecht erhalten bleibt:
„Solange die Spaltungen der Kirche andauern, [kann es] nicht zu einer vollen Aktualisierung der Katholizität der Kirche kommen […], und zwar von zwei Seiten her. Einmal ist dies deshalb nicht möglich, weil die Trennung verhindert, dass alle für die Kirche Christi konstitutiven institutionellen Heilsmittel, die als ‚salutarium mediorum plenitudo’ der katholischen Kirche geschenkt sind (vgl. Artikel 3), bei den getrennten Christen, die doch durch die Taufe auf diese Fülle hingeordnet sind, wirksam werden können. Diese Aussage ergibt sich ohne weiteres aus dem früher Gesagten. Eine Wende gegenüber dem früheren katholischen Denken hingegen zeigt die zweite Aussage an, dass es nämlich infolge der Spaltungen auch der katholischen Kirche selbst kaum möglich sei, alle Aspekte der Katholizität der Kirche in ihrem Leben zu aktualisieren. Sie anerkennt zwar jetzt grundsätzlich, dass zur echten Katholizität eine Vielfalt christlicher Lebensformen, der christlichen Spiritualität, der liturgischen Formen, der kirchlichen Disziplin, des theologischen Denkens und der Lehrweisen gehören, und zweifellos wird sich in Zukunft in der katholischen Kirche in mancher Hinsicht eine größere Mannigfaltigkeit entwickeln. Aber solange große Teile der Christenheit mit ihrer ausgeprägten Eigenart von der katholischen Kirche getrennt sind, werden sich innerhalb des katholischen Raumes kaum alle jene berechtigten Ausprägungen des Christlichen und jene Kirchentypen (im Sinne von Einzelkirchen) voll ausformen können, die erst die volle Katholizität der Kirche ‚in der Wirklichkeit des Lebens’ zur Erscheinung brächten.“305
Feiner stellt hier unmissverständlich heraus, dass zur Verwirklichung der qualitativen Fülle der der Kirche gegebenen Katholizität die ekklesiale Einheit nicht nur nach innen, sondern auch und vor allem nach außen, sprich die kirchliche Einheit aller christlichen Konfessionen zwingend erforderlich ist. Damit ist und bleibt der interkonfessionelle Dialog sowie der ökumenische Prozess – der in UR 4,11 allen katholischen Gläubigen („fidelium catholicorum“, „katholisch“ hier konfessionell gebraucht) und Bischöfen überall auf der Erde ausdrücklich empfohlen wird („episcopis ubique terrarum commendat“) – von innen her notwendige, ihrem Wesen entsprechende Aufgabe von Kirche. Von hier aus drängt sich auch das in LG 8 bemühte „subsistit in“ gleichsam notwendig auf, da die (römisch-)katholische Kirche aus „katholischer“ Sicht, d.h. aus dem Blickwinkel ihrer zuteil werdenden Katholizität, niemals ganz identisch mit der Kirche Jesu Christi sein kann (im Sinne von „est“), da die zu dieser absoluten Identität notwendig erforderliche vollkommene Fülle der qualitativen Katholizität der Kirche solange nicht voll in ihr verwirklicht sein wird und sein kann, wie die christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften nicht dauerhaft geeint sind.
In UR 8 verwenden die Konzilsväter dreimal das Substantiv „catholici“ (UR 8,2) zur konfessionellen Bezeichnung der Katholiken.
In UR 9 findet man – jeweils im konfessionellen Gebrauch – einmal das Substantiv „catholici“ (UR 9,1) sowie einmal das Adjektiv „catholicus“ (UR 9,1) zur Bezeichnung der „Lage“ oder „Situation“ („condicio“) – gemeint sein könnte damit die „Lehre“306 und noch mehr der „innere[…] Zustand, […][die] Beschaffenheit und gesamte Verfasstheit“307 – der (römisch-)katholischen Kirche.
UR 10 weist wiederum einmal das Adjektiv „catholicus“ (UR 10,2) sowie einmal das Substantiv „catholici“ (UR 10,4) auf, die beide Male konfessionell verwendet werden.
In UR 11 zählt man fünfmal das Adjektiv „catholicus“ (zweimal in UR 11,1; einmal in UR 11,2; zweimal in UR 11,3), das ausschließlich zur Bezeichnung des (römisch-)katholischen Glaubens, seiner Lehren sowie seiner Theologen, also im Sinne der Denominationsbezeichnung „katholisch“, fungiert.
UR 13 verwendet das Adjektiv „catholicus“ (UR 13,3) zur Bezeichnung der „katholischen Überlieferungen“ („structurae catholicae“), die in den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in unterschiedlicher Weise erhalten geblieben seien. Den nachfolgenden Ausführungen zufolge, den diese einleitenden Ausführungen ankündigen, und gemäß der Überschrift des durch diesen Artikel eröffneten dritten Kapitels des Ökumenedekretes („De Ecclesiis et de Communitatibus ecclesialibus a Sede Apostolica Romana seiunctis“ – „Die vom Römischen Apostolischen Stuhl getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften“) wird das Adjektiv „catholicus“ im Sinne von (römisch-)katholisch, also im Sinne der Denominationsbezeichnung „katholisch“, gebraucht.
In UR 14 wird man einmal fündig, und zwar in UR 14,4, wo von der „katholischen Kirche“ („Ecclesiam catholicam“) im Unterschied zu den östlichen (i.e. orthodoxen) Kirchen („Ecclesias orientales“) die Rede ist und „catholicus“ somit im konfessionellen Sinne Verwendung findet.
Gleichermaßen wird in UR 15 das Substantiv „catholici“ (UR 15,4) gebraucht, ebenfalls im konfessionellen Sinne.
In UR 17, wo in UR 17,2 zunächst von der katholischen Kirche („Ecclesiae catholicae“) im Sinne der Konfession „römisch-katholisch“ die Rede ist, wird im gleichen Abschnitt auf die qualitative „volle Katholizität“ („plenam catholicitatem“) und Apostolizität der Kirche Jesu Christi verwiesen, die sich im vielfältigen geistlichen, liturgischen, disziplinären und theologischen Erbe der Kirche in ihren je konfessionell verschiedenen (und legitimen) Überlieferungen konkretisieren. UR 17 wiederholt die Auffassung, die schon in UR 4 zum Ausdruck kam, dass nicht in einer gesuchten Uniformität die Fülle der qualitativen Katholizität der Kirche gesucht werden kann, sondern in der Anerkennung und Bejahung einer legitimen Vielfalt und konfessionellen Verschiedenheit. Diese droht nicht die kirchliche Einheit aufzusprengen, sondern ermöglicht erst, das Wesen von Kirche und damit das ihrer qualitativen Katholizität voll und ganz zur Entfaltung zu bringen.308 Damit ist der durchgängigen Überzeugung von UR Gewicht verliehen, dass „die Erkenntnis des ‚Göttlichen’ bzw. des ‚geoffenbarten Mysteriums’ nicht uniform sein kann“309 und „bestimmte Gesichtspunkte des geoffenbarten Mysteriums bisweilen von dem einen [i.e. Konfession im hier behandelten Gegenüber von Orthodoxen und Katholiken] angemessener erfasst und in ein besseres Licht gestellt werden als vom anderen, so dass man dann sagen muss, dass jene vielfältigen theologischen Formulierungen sich nicht selten eher untereinander ergänzen, als dass sie einander entgegensetzt sind.“ (UR 17,1):
„Die Integration des ganzen geistlichen und liturgischen, disziplinären und theologischen Erbes der orientalischen Kirchen mit seinen verschiedenen Traditionen für die Katholizität und Apostolizität der Kirche [ist] wesentlich […]. Es geht also nicht um die Zulassung einiger exotischer Randerscheinungen, sondern um die Realisierung einer volleren Katholizität und Apostolizität der Kirche: Die katholische Kirche muss katholischer und apostolischer werden.“310
Bleibende Aufgabe von Kirche muss es also auch heute sein, die Vielfalt kirchlichen Lebens und Seins als Realisierung ihrer vollen qualitativen Katholizität zu erkennen und sowohl im Innen- als auch im Außenverhältnis anzuerkennen und zu fördern.
In UR 18, einer Art Conclusio der vorangehenden Betrachtung des ökumenischen Miteinanders zwischen orthodoxen und katholischen Christen, findet man das Adjektiv „catholica“ zur Bezeichnung der (römisch-)katholischen Kirche („Ecclesiae catholicae“), das hier im konfessionellen Sinne Verwendung findet. Diese macht sich in diesem „Schlussartikel“311 die Bestimmung des Apostelkonzils und darin den ökumenischen Grundsatz zueigen, „keine weitere Last aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge“ (Apg 15,28), wenngleich offen bleibt – und bis heute offen und umstritten ist –, was diese „notwendigen Dinge“ sind, die für eine kirchliche Einheit erforderlich sind. Die Hirten und Gläubigen der (römisch-)katholischen Kirche werden aufgerufen, den ökumenischen Prozess weiter voranzubringen, dies nicht nur im gemeinsamen Gebet und im theologisch-wissenschaftlichen Diskurs, sondern auch und vor allem im Hinblick auf die „drängenderen Bedürfnisse […] der pastoralen Aufgabe unserer Zeit“ (UR 18). Besonders legen die Bischöfe das Augenmerk auf die in den Westen emigrierten orthodoxen Christen, die nicht einem Proselytismus anheim fallen und von der katholischen Kirche abgeworden werden sollen: ein wunder Punkt in den ökumenischen Beziehungen bis heute.312
Beginnend mit Artikel 19, der drei Mal das Adjektiv „catholica“ zur konfessionellen Bezeichnung der (römisch-)katholischen Kirche verwendet („Ecclesia catholica“ einmal in UR 19,1 und zweimal in UR 19,3), richten die Konzilsväter den Blick auf das ökumenische Verhältnis zwischen (römisch-)katholischer Kirche und den von ihr getrennten westlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften (vgl. UR 19–23). Dieser seit dem Konzil üblichen Unterscheidung zwischen „Kirchen“ und „kirchlichen Gemeinschaften“ sei an dieser Stelle kurz nachgegangen, da sie auf dem Konzil selbst und spätestens seit „Dominus Iesus“ und dem Schreiben der Glaubenskongregation zu Aspekten bezüglich der Lehre über die Kirche auch in unserer Zeit erheblich für Diskussion gesorgt hat und insoweit den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit tangiert, als nämlich die Frage erhoben werden kann, ob denn ein qualitatives Verständnis der Katholizität diese terminologische Unterscheidung überhaupt rechtfertigt.
Bereits UR 3 hatte die für das Ökumenismusdekret typische Sichtweise deutlich gemacht, dass „in dieser einen und einzigen Kirche Gottes […] schon manche Spaltungen aufgekommen […][und] in den späteren Jahrhunderten […] ausgedehntere Meinungsverschiedenheiten entstanden [seien], […][weshalb] sich nicht unbedeutende Gemeinschaften von der vollen Gemeinschaft der katholischen Kirche“ getrennt hätten (UR 3,1). Das Dekret macht auf der Grundlage der in Lumen Gentium dargelegten Lehre deutlich, dass nicht von einem Auseinanderfallen der einen Kirche Jesu Christi in mehrere Einzelkirchen zu sprechen sei, was zur logischen Konsequenz das Ende der einen Existenzform der Kirche Jesu Christi hätte, sondern dass sich vielmehr große christliche Gemeinschaften von der (römisch-)katholischen Kirche abgespaltet hätten, in der – nach ihrem eigenen Verständnis – einzig und bleibend die eine Kirche Jesu Christi voll verwirklicht sei („subsisti in“, vgl. LG 8), d.h. in der die eine Kirche Jesu Christi trotz der Abspaltungen ihre volle, eine konkrete Existenzform habe. Das Dekret qualifiziert nun, ausgehend von der Vollständigkeit bzw. Unvollständigkeit vorhandener kirchlicher „Elemente“313 (vgl. LG 8,2; 15; UR 3,2), die von der (römisch-)katholischen Kirche getrennten Christen als „Kirchen“ („Ecclesiae“, hierunter fällt etwa die Altkatholische oder die Anglikanische Kirche) oder „kirchliche Gemeinschaften“ („Communitates ecclesiales“, hierunter sind die aus der Reformation hervorgegangenen Protestanten zu zählen). Schon die Kirchenkonstitution verwendet diese, ein gewisses qualitatives Gefälle suggerierende Doppelbezeichnung, wenngleich Lumen Gentium statt von „Communitates ecclesiales “ (wie etwa in der Überschrift von UR 19 oder in UR 19,1) von „Communitates ecclesiasticae“ (LG 15) spricht.314 Die von Kardinal König315 in die Konzilsberatungen eingebrachte Doppelbezeichnung entfachte unter den Konzilsvätern heftige Diskussionen.316 Während einzelne Kardinäle versuchten, die Bezeichnung „Ecclesia“ nur für die Ostkirchen oder gar einzig für die (römisch-)katholische Kirche geltend zu machen („una est Ecclesia, i.e. Catholica“) – diese Modi wurden vom Einheitssekretariat deutlich zurückgewiesen317 – erhoben andere Kardinäle den Einwand, die Terminologie sei, weil sachgemäße, lehrmäßige Definitionen fehlten, zu unpräzise. Andere hielten den Terminus „Gemeinschaft“ für zu profan, und wieder eine Gruppe von Bischöfen insistierte, ob denn nicht alle von Rom getrennten christlichen Glaubensgemeinschaften gleichermaßen als „Ecclesiae“ etwa im Sinne von Partikular-, Teil- oder Schwesterkirchen bezeichnet werden könnten oder als „Kirchen eines anderen Typs“318. Darüber, ob der Terminus „Ecclesia“ theologisch korrekt auch dann angewandt werden könne, wenn die apostolische Sukzession des Bischofsamtes nicht oder nicht sicher gegeben sei und nur einige der Sakramente gültig erhalten seien, gingen – so Feiner – indes die Meinungen auseinander.319
Das Einheitssekretariat lehnte alle Modi ab und blieb bei der terminologischen Unterscheidung. Als Begründung verwies es auf die Ausführungen zur Terminologie in der Relatio zum ersten Schema.320 Hier aber – und darauf sei besonders auch im Rahmen dieser Untersuchung hingewiesen – sprach das Sekretariat den kirchlichen Gemeinschaften keineswegs ihren ekklesialen Charakter ab, sondern betonte diesen vielmehr, wenn es nämlich unter Berufung auf die Relatio in Erinnerung rief, dass in den kirchlichen Gemeinschaften die Kirche Jesu Christi quasi wie in Teilkirchen anwesend und durch vermittelnde ekklesiale Elemente auf irgendeine Weise wirksam sei:
„In his Coetibus unica Christi Ecclesia, quasi tamquam in Ecclesiis particularibus, quamvis imperfecte, praesens et mediantibus elementis ecclesiasticis aliquo modo actuosa est.“321
Diese Begründung, die das „subsistit in“ in LG 8 vor jeder falschen, verabsolutieren wollenden Interpretation im Sinne eines „est“ bewahrt, erscheint auch aus dem Blickwinkel unserer Untersuchung insoweit als schlüssig, als dass alle christlichen Gemeinschaften – seien sie explizit „Kirche“ genannt oder als „kirchliche Gemeinschaft“ bezeichnet – grundsätzlich den Glanz der Kirche Jesu Christus, wenn auch in gebrochener Weise, widerspiegeln und folglich die von Christus herkommende Fülle in sich tragen. In diesem Kontext muss freilich darauf hingewiesen werden, dass, unabhängig von der der (römisch-)katholischen Kirche eigenen Terminologie, manche aus der Reformation hervorgegangenen christlichen Gemeinschaften gar nicht wünschen, dass man sie als „Kirche“ im (römisch-)katholischen Sinne bezeichnet.322