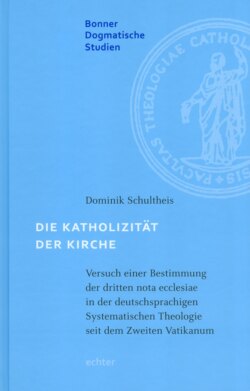Читать книгу Die Katholizität der Kirche - Dominik Schultheis - Страница 59
1. Der trinitarische Rahmen konziliarer Ekklesiologie
ОглавлениеBereits der erste Satz der Kirchenkonstitution macht deutlich, dass das Konzil einen Kirchenbegriff zugrunde legt, der einen rein auf das empirisch Sichtbare von Kirche beschränkten Begriff übersteigt. Das Konzil betrachtet die Kirche vielmehr von Christus her:
„Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten“ (LG 1).
Das Licht, das Christus ist, ist auch das Licht der Kirche („lumen ecclesiae“), und in Christus ist die Kirche das Licht der Völker („lumen gentium“).384 In diesem programmatischen Leitwort, das Johannes XXIII. wiederholt verwandte, um die Idee des Konzils zusammenzufassen385, strahlt ein Motiv der Vätertheologie auf: Hier sprach man gern von der Kirche als dem „mysterium lunae“. Damit wollte man ausdrücken, dass die Kirche – wie der Mond – nicht vom eigenen Licht her strahlt, sondern Christus widerspiegelt, der ihre Sonne ist.386 Damit ist ein erstes Vorzeichen gegeben, von dem aus sich die ekklesiologischen Aussagen des Konzils erschließen: Dessen „Ekklesiologie erscheint abhängig von der Christologie, ihr zugehörig.“387
Ein Zweites ergibt sich notwendig aus dem Ersten: Jede Rede von Christus, dem Sohn, sagt zugleich – will sie nicht enggeführt sein – den Vater aus und damit die Beziehung zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. Das Konzil ordnet demgemäß seinen christologischen Ansatz in den Gesamtrahmen der Trinitätstheologie ein (vgl. LG 2–4) und versteht die Kirche als „Ikone der Trinität“388, als Widerschein der göttlichen Communio. „Die christologische Sicht der Kirche [weitet sich] notwendig in eine trinitarische Ekklesiologie aus“389. Auf der Folie des vom Konzil zugrunde gelegten trinitarischen Gottesverständnisses entfaltet es eine, von innen her eucharistisch bestimmte Communio-Ekklesiologie, nach welcher sich die innertrinitarische Dialektik von Einheit und Vielheit in der Kirche als „Sakrament“ (LG 1, 9, 48, 59) der göttlichen Einheit – sowohl in ihrer eigenen Verfasstheit (intensive Katholizität) wie auch in ihrem Dienst an der universalen Versöhnung der gesamten Schöpfung (extensive Katholizität) – widerspiegelt: „So erscheint die ganze Kirche als ‚das von der Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk’“ (LG 4). Diese sakramentale Sicht ermöglicht, die untrennbare Einheit und gleichzeitige unvermischte Verschiedenheit zwischen der Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus und der Kirche auszudrücken: Kirche „ist […] zuerst Setzung von oben. Sie verwirklicht sich dennoch in Welt und Geschichte“390. In schöpfungstheologischer sowie eschatologischer Perspektive erweist sich die Kirche als „allumfassende[…][s] Heilssakrament“ (LG 48), als „das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi“ (LG 3), als „Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden“ (LG 5), das „an dem universalen Heilsgeschenk Gottes [partizipiert] […][und] selbst zu einem universal anwesenden Zeichen der Liebe Gottes in der Welt“391 wird. Als Sakrament des Heils steht die Kirche selbst im Spannungsverhältnis zwischen Schon und Noch-Nicht, in der Dialektik zwischen der antizipativen Gegenwart und der Ausständigkeit des Reiches Gottes.
Im Folgenden sei das Verständnis der Kirche als „Volk Gottes“ betrachtet, dem das zweite Kapitel der Kirchenkonstitution gewidmet ist.