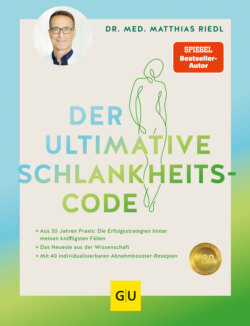Читать книгу Der ultimative Schlankheitscode - Dr. med. Matthias Riedl - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Mensch – das essende soziale Wesen
»Essen hält Leib und Seele zusammen.« – »Liebe geht durch den Magen.« – »Jemandem ordentlich die Suppe versalzen.« Ein kurzer Blick auf den Schatz der Redewendungen genügt, um zu erkennen: Wenn wir etwas zu uns nehmen, bedeutet das sehr viel mehr, als unseren Körper mit Nahrung zu versorgen. Es geht um mehr als Verdauungs- und Stoffwechselprozesse. Obwohl diese Tatsache so offensichtlich ist, beschäftigen sich nur die allerwenigsten mit der Frage, wie soziale Faktoren unser Essverhalten und unsere Figur beeinflussen. Dabei kann niemand, der ernährungsmedizinische Empfehlungen isoliert betrachtet, nachhaltig abnehmen. Denn dafür braucht es auch ein tiefes Verständnis davon, dass Essen einen essenziellen Bestandteil unserer menschlichen Kultur darstellt. Nur wer über die vielfältigen Funktionen von Lebensmitteln, Gerichten und Mahlzeiten Bescheid weiß und erkennt, wie sie unser individuelles Essverhalten steuern, kann Letzteres auf genussvolle Weise und damit dauerhaft in Richtung »gesund« und »schlank« drehen.
Genau diese Voraussetzung schaffen Sie mit der Lektüre der nächsten Seiten.
MAHLZEIT! SOZIALE FUNKTIONEN DES ESSENS
Ob Nudeln mit Tomatensauce oder Salat mit Ofenlachs: Egal wie eine Mahlzeit auch aussieht – immer ist sie für uns Menschen ein intensives Erlebnis, bei dem Genuss, Gefühle und soziale Rituale eine wichtige Rolle spielen. Mit jeweils ganz verschiedenen Funktionen.
Nahrung als Genussgarant
»Essen ist der Sex des Alters«: Diesen Spruch höre ich in meiner Praxis regelmäßig, vor allem von Männern in den 70ern. Sie wollen mir damit augenzwinkernd zu verstehen geben, warum sie ein paar Pfund zugelegt haben und dieses Übergewicht kaum loswerden. Natürlich muss ich dann schmunzeln. Zum einen, weil ich als Ernährungsmediziner genau weiß, dass eine angepasste Ernährung und der Abbau von Übergewicht wieder zu mehr Spaß im Bett führen können – und zwar durchaus auch bei Männern über 70. Und zum anderen, weil dieser Spruch etwas extrem Wichtiges illustriert, das den meisten, die ihn zitieren, nicht bewusst ist: Kochen und Essen sind tatsächlich zutiefst sinnliche Erlebnisse. Ein Beispiel: Wir kneten den Brotteig, sehen, wie der Laib im Ofen seine verführerische Kruste bekommt. Wir riechen diesen unvergleichlichen Duft, während das Brot abkühlt. Wir hören das verführerische Knistern, wenn wir es brechen. Wir nehmen die jedes Mal wieder so betörende Aromenvielfalt wahr, wenn wir den ersten Bissen kauen – und die Geschmacksrezeptoren mit den Duftrezeptoren Tango tanzen. Kurz: Lebensmittel, die wir mögen, sind das sprichwörtliche Fest für die Sinne!
Damit gehört Essen zu den Genussgaranten schlechthin – wie ein Entspannungsbad, eine Folge der Lieblingsserie, ein gutes Buch, ein edler Whiskey oder (ab und an) eine Zigarre. Werden uns diese Genussgaranten geraubt, etwa weil Schokolade während einer Diät auf der Verbotsliste steht, halten wir diesen Zustand eine kurze Weile durch, nie aber auf Dauer.
Nahrung als Kitt der Gemeinschaft
»Du bist, was du isst«: Auch an diesem Satz ist viel Wahres dran. Allerdings geht es dabei nicht allein um die Frage, inwieweit uns Lebensmittel ausreichend mit Nährstoffen versorgen. Vielmehr verdeutlicht dieser Spruch Folgendes: Nahrung und Mahlzeiten setzen den Einzelnen in Bezug zu anderen. Und machen damit aus einem Individuum das Mitglied einer Gemeinschaft – kurz: einen Menschen. Da jeder von uns essen muss, meist mehrfach am Tag, bilden kulinarische Routinen die stabilsten Rituale, die wir haben. Und damit zugleich jene, die uns am stärksten prägen. Mahlzeiten beeinflussen also unsere Identität in umfassender Weise mit, indem sie gruppenbildend wirken – von der sehr kleinen bis zur ziemlich großen Gemeinschaft.
Die Familie
Kommt ein Kind auf die Welt, sind die Eltern Bezugspunkt Nummer eins: Was auch immer sie den Jüngsten voressen, möchte und wird auch der Nachwuchs irgendwann zu sich nehmen. In der ursprünglichen Natur wirkte dieses Verhalten lebenserhaltend: Das Kind lernte dadurch, was essbar war – und was möglicherweise tödlich.
Entsprechend bildet bis heute jeder Mensch während seiner Kindheit Vorlieben aus, die vermeintlich individuell sind, in Wahrheit aber nichts anderes als eine Folge der elterlichen kulinarischen Erziehung und damit der Prägung! Während es in der Kernfamilie des einen Kindes etwa morgens Käsebrötchen gibt, mittags Milchreis und abends Wurstbrot, verzehrt man in einer anderen zum Frühstück Müsli, zum Mittag Bratkartoffeln und abends Salat. Indem der Nachwuchs an diesen Ritualen teilnimmt, macht er die Gewohnheiten zu seinen eigenen. Knüpft enge innerfamiliäre Bande – und stärkt diese mit jeder Mahlzeit.
Wie wichtig solche kulinarischen Traditionen sind, zeigt die Tatsache, dass jede Familie ihre eigenen hat. Häufig zeigen sich diese bei festlichen Anlässen, etwa an Geburtstagen: Die eine Familie begeht das Jubiläum mit einem Besuch des immer gleichen Restaurants, für die andere ist eine Kaffeetafel mit Kaltem Hund obligatorisch und für die dritte macht erst das Spanferkelgrillen den Start ins neue Lebensjahr perfekt.
Essen und Trinken – nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern auch Heimatgefühl.
Die Region und das Land
Mit der Zeit weitet sich der Bezugsrahmen, in dem ein junger Mensch seine kulinarische Prägung erfährt: Das Kind lernt bald auch die Eigenarten der weiteren Verwandtschaft kennen – und schließlich, etwa im Kindergarten, der Schule und bei lokalen Festen, die Rituale der Bewohner einer Region. Indem es auch diese Traditionen übernimmt, wird es zum Mitglied dieser größeren Gruppe.
Ein Beispiel: Stammt ein Mensch aus Ostfriesland, gehört die Begeisterung für Schwarztee mit Sahne sowie Grünkohl mit Kasseler aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso zu seiner kulturellen Identität wie die Liebe zum flachen Land. Ein Mensch aus Bayern dagegen würde sich eher bei Brezel und Weißwurst sowie der Vorstellung eines Bergpanoramas »zu Hause« fühlen.
Die Nation
Im ganz großen Maßstab schließlich machen uns kulinarische Traditionen zu Angehörigen eines Landes. Über Jahrtausende hinweg haben sich in allen Regionen dieser Erde typische Gerichte ausgebildet – basierend auf den Lebensmitteln, die dort aufgrund der vorherrschenden geografischen und klimatischen Bedingungen verfügbar waren. Während sich in Deutschland beispielsweise infolge des Getreideanbaus eine derart große Vielfalt an Brotsorten entwickelte, dass diese Backkunst inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, entstand in Indien, dem Reich der 1000 Gewürze, eine bunte Palette würziger Currys.
Kurz: Gemeinsam ein Essen zu teilen ist ein extrem wichtiges soziokulturelles Ereignis, das uns zu dem macht, der wir sind. Und uns immer wieder zeigt: Du bist nicht allein! Wie wichtig diese Funktion des Essens für die allermeisten von uns ist, hat jeder schon einmal erfahren, der für eine gewisse Zeit im Ausland war. Egal, wie schön es in der Ferne auch sein mag: Irgendwann fehlt uns beispielsweise das Vollkornbrot. Und wenn dann auch noch, etwa während eines Auslandssemesters in Rom, persönliche Traditionen wie der Käsekuchen zum Geburtstag wegfallen, weil es in Italien keinen Quark gibt, dann spüren wir eine gewisse Wehmut, wenn nicht gar einen kurzen Stich im Herzen – ganz egal, wie gut die Pizza schmeckt, die Freund Antonio zum Feieranlass gebacken hat. Weil wir in solchen Momenten eben genau nicht das sind, was wir essen.
»EINE GUTE KÜCHE
IST DAS FUNDAMENT
ALLEN GLÜCKS.«
AUGUSTE ESCOFFIER