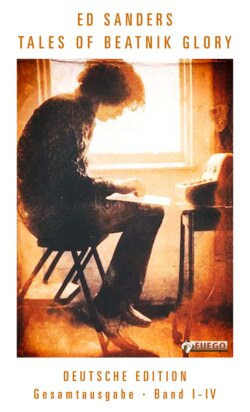Читать книгу Tales of Beatnik Glory, Band I-IV (Deutsche Edition) - Ed Sanders - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X
ОглавлениеDer Lärmpegel schwankte im Bereich eines gedämpften Brausens. Mittlerweile hatten sich alle Sprecher auf ihren Plätzen eingefunden. Vor jedem Sitz befand sich ein gefülltes Wasserglas und ein Notizblock. Zum letzten Mal brummelte der Hausmeister seine Zahlen in die Mikrophone, um sie zu überprüfen. Der ganze Saal schien erfüllt von dem Bewusstsein der steinernen Stufen, die zum Tempel der Wahrheit führen. Endlich ging es los: Warner Cleftine, Chefherausgeber vom Foment-Magazin schnaufte sein erstes »Hmmmpfpft« ins Mikrofon und klingelte zur Eröffnung mit seinem Uhrarmband gegen den Wasserkrug. Allmählich flaute der gedämpfte Lärm ab. Neunhundert schnatternde Zuschauer wandten sich erwartungsvoll der Bühne, dem Tisch und den gesetzten Herrschaften dahinter zu.
Cleftine war der erste Sprecher. »Wir haben uns hier versammelt, um eine der neueren Erscheinungsformen der Literatur zu analysieren, in der Hoffnung, unser Verständnis in diesem Bereich vertiefen zu können. Dieses Phänomen wird zwar in vielen Magazinen und Zeitungen ausführlichst besprochen, hat aber um so weniger Eingang in die kulturelle Auseinandersetzung gefunden.« Als er mit seinem Statement so weit gekommen war, sprang John Farraday plötzlich von seinem Stuhl und fing an, hinter dem Tisch in länglichen Ellipsen auf und ab zu marschieren. Glücklicherweise standen die Mikrofone zu weit weg, sonst hätte man im ganzen Saal sein unterdrücktes Gefluche gehört. Offenbar hatte Farraday vorgehabt, von der Bühne zu springen und so schnell wie möglich abzuhauen. Aber irgendetwas schien ihn festzuhalten — jedenfalls brachte es er es nicht fertig, einfach zu verschwinden. Während des gesamten Symposiums zog er auf der Bühne seine Kreise oder hockte sich an der Seite in die Kulissen und teilte sich eine Flasche Tequila mit dem Hausmeister. Der erzählte ihm später, der einzige Grund, warum er überhaupt noch da sei, wäre die entsprechende Vorschrift der Gewerkschaft.
»Balzac! Balzac! Balzac!« grunzte Farraday im Gehen vor sich hin. Zehn bis fünfzehn junge, professionelle Romanschreiber saßen im Publikum verteilt — professionell in dem Sinne, dass sie es mit ihrer Schreiberei nicht so hielten wie diese Poeten, die ihre Kreativität immer dann auf Prosa umschalten, wenn die Zeiten es erfordern: wegen der Kohle, aus Feigheit, mit totem Gewissen. Diese Typen hier, die sich cool und stetig nach oben arbeiteten und heimlich danach lechzten, endlich einen Hit in der schwarz eingerahmten Bestsellerliste in der Sonntagsbeilage der New York Times zu landen, die grinsten jetzt hämisch: Nun guckt euch doch bloß diesen Krüppel von Farraday an da oben! Schaut her! Ich bin nicht da oben! Ich! Ich! Ich! Ich!
Und dann gab es noch eine Gruppe im Publikum, der das Ganze ungeheuer peinlich war: Farradays Verleger und Förderer, die Maxwell Perkinses seiner Karriere, die einmal geglaubt hatten, man könnte so was wie eine schillernde Eintagslibelle der Literaturszene aus ihm machen. Sie lehnten es grundsätzlich ab, seine Manuskripte in der Reihenfolge ihres Entstehens zu publizieren: Dickens’ Ära ist vorbei, junger Mann! Statt dessen brachten sie ihn dazu, in aller Eile ein Buch über das Leben der dahinvegetierenden Künstler in New York zusammenzuschmieren. »Deine Erfahrungen, junger Mann, schreib sie auf, aber mit Logik, Syntax, normaler Zeichensetzung und glaubwürdigen Charakteren! Dann bist du im Handumdrehen ein gemachter Mann, glaub’s mir, mein Sohn! Und du kannst in jedem Teil der Welt abtreten, wo du willst ... brauchst bloß der Sonne zu folgen!«
Nach den ersten Bemerkungen von Warner Cleftine ging der Tanz erst richtig los. Die gelehrten Kommentare der Redner zeichneten sich durch bemerkenswerte Kompliziertheit aus und der rote Faden, um den sich alles drehte, war die Feststellung, dass der Trauerzug zu Ehren einer literarischen Strömung grundsätzlich ein herzzerreißender Anblick ist, egal ob es um die Relikte des Futurismus, Vortizismus, Imagismus oder der Beat-Generation geht, die man da jeweils zu Grabe trägt. Und für das Publikum wurden auch die Beats noch mal schnell als »Leitstier« einer Strömung gegen die »kulturelle Verkalkung« und »schleichende Paralyse und seichte Konformität« gefeiert.
Dann kam Cheevy Samuelson an die Reihe. Er rückte mit einer ungewöhnlichen Analyse der B.G. heraus. Er verglich sie nämlich mit den Dadaisten, die zwischen 1916 und 1920 in Zürich und Paris ihr Unwesen getrieben hatten. Als er anfing zu sprechen, konnte man beobachten, wie ein prominenter Zeitungsreporter in der ersten Reihe spöttische Notizen in sein gelbes Ringbuch kritzelte; beispielsweise ließ er sich in seinem Bericht am nächsten Tag über Cheevys »kubanischen Bart« aus, »der mittlerweile, so scheint’s, wirklich von jedem kopiert wird, der Dr. Castro bewundert.«
»Wie die Dadaisten«, erläuterte Cheevy langsam, »haben auch die Beats ein paar sehr beeindruckende Bücher geschrieben — und nebenbei ein paar andere beeinflusst —, haben ein gutes Dutzend akzeptabler Artikel inspiriert, Skandale und Tratsch herauf beschworen und ihren Spaß gehabt. Sie haben weiterhin das Publikum beschimpft und beleidigt, und möglicherweise brauchte unsere selbstzufriedene res publica das sogar. Aber mehr haben sie nicht vollbracht. Von den Dadaisten unterscheidet sich die Beat-Generation vor allem auf der metaphysischen Ebene ...« Bei dem Wort metaphysisch breitete sich auf den Gesichtern von zwei anderen Diskussionsteilnehmern ein mitleidiges Lächeln aus — der gute alte Cheevy und sein Mystizismus, ja, ja.
»... insofern sie nicht länger über eine Tradition verfügten, die ihnen vertraut war und Halt hätte geben können. Mit der hebräisch-christlichen Tradition hatten sie radikal und endgültig gebrochen. Die Beat-Generation war visionär, sie war das lebendige Versprechen einer neuen amerikanischen contemplatio. So Hier, so Jetzt, dass sie in Wirklichkeit kaum existierte. Auf der literarischen Ebene kann die Beat-Generation zweifellos als kulturelle Strömung interpretiert werden, die von ihren Anhängern ganz bewusst manipuliert wurde. In dem vor lauter Kunst trüben Strom von Kubisten, Futuristen, Imagisten, Expressionisten, Konstruktivisten, Dadaisten, Surrealisten und Action-Malern sollten sie einmünden und von ihm auch ihre Bestimmung ableiten. Und tatsächlich haben die Beats versucht, sich mit fremden Federn zu schmücken. Wollte Gott, es wären ihre eigenen gewesen!«
Trotz seiner leidenschaftlichen Vortragsweise bekam Mr. Samuelson einen Applaus, der mindestens so lausig war wie die Fingerschnipserei bei einer Kaffeehauslesung.
Miss Malek rief gleich anschließend dem Publikum ins Gedächtnis zurück, dass es schon seit über fünfunddreißig Jahren Menschen gab, die sich aus den Fenstern des Bel Air Hotels stürzten und dabei »Genitalien und Manuskripte flattern ließen« — kurz und gut, sie verstünde einfach nicht, was der ganze Unsinn sollte, worauf das Publikum in stürmisches Gelächter ausbrach. »Ich bin der Meinung«, fuhr sie fort, »dass es das eben alles schon einmal gegeben hat. Diese Leute haben — beziehungsweise hatten — uns nichts Neues zu bieten, rein gar nichts!« Ohne mit der Wimper zu zucken, gestand sie, ihr persönlich sei es einfach unmöglich, aus reinem Vergnügen zu lesen. Sie klopfte stattdessen jeden Text, den sie zwischen die Finger kriegte — jedenfalls konnte man so was raushören — nur nach Möglichkeiten ab, neue Ideen, Techniken, Handlungen oder Charaktere zu klauen.
»Ich lese aus beruflichen Gründen, und glauben Sie mir, in diesen Büchern ist einfach nichts zu holen, nicht mal in denen von Jack Kerouac!«
In diesem Moment erhob sich im Publikum eine ungewöhnliche Erscheinung, ein Mann, dessen langes verfilztes Haar wie bei Hasidicus in verhedderten Strähnen in sämtlichen Himmelsrichtungen vom Kopf abstand und der in der Hand die letzte Ausgabe vom Trans-Quake Quarterly schwenkte. Sie enthielt, wie er erklärte, seine erst kürzlich vollendete Novellentrilogie, deren Titel uns leider entging, weil er ihn in einem Anflug von Schüchternheit oder so was ähnlichem nur im Flüsterton herausbrachte. Jedenfalls teilte er den Zuhörern mit, dass man ihn während der Pause in der Lobby antreffen könne, falls jemand Interesse hätte, eine Nummer zu erwerben.
Dann fuhr er fort: »Nun möchte ich mich aber noch mit einer Frage an Miss Malek wenden. Sie ist zweiteilig und lautet: Erstens sind Sie nicht auch der Meinung, dass in der bedrohenden Eisenwolke, die uns während dieser Zeit der Computerzivilisation umgibt, extremer Narzissmus das Wachstum von Geist und Psyche fördern könnte? Und zweitens: Hatten Sie schon Gelegenheit, die Kurzgeschichten zu lesen, die ich Ihnen zugeschickt habe?«
Augenblicklich klopfte der Vorsitzende mit seinem Hammer auf den Tisch. »Wir sind leider gezwungen«, Cleftine beugte sich viel zu nah über das völlig ungeschützte Mikrofon, »... Fragen bis zur zweiten Hälfte des Programms, also nach der Pause, zurückzustellen. Vielen Dank.«
Wir dürfen an dieser Stelle vielleicht einmal betonen, dass die Diskussionsrunde sich einstimmig dafür ausgesprochen hatte, dass »Ungerechtigkeit ungerecht ist.«
»Jawohl, ich hasse Ungerechtigkeit«, erklärte Miss Malek abschließend, »und ich liebe das Leben!« Ein paar Zuhörer reagierten darauf mit einem kurzen höhnischen Gejohle und sogar Pfiffen, ehe der aufbrausende Beifall die Zwischenrufe erstickte.
Man sollte doch eigentlich meinen, dass Ausschreitungen bei einem solch traurigen Anlass schier unmöglich seien, und doch — als jetzt Emil Cione das Wort ergriff — versprühten selbst die Kronleuchter pure Aggressivität. Mit dem Kopf unter dem Tisch hatte er sich zuvor noch schnell zwei Benzedrinkapseln eingeworfen, um seiner Quasselei wenigstens ein Mindestmaß an Format zu geben. Einer seiner verlässlichen Studenten brachte ihm auf einen Wink ein Glas Wodka — als Wasser getarnt — mit dem er sie hinunterspülte. Die ganze Mixtur fing gerade an, sich in seinem Magen auszubreiten, als er vom Vorsitzenden aufgerufen wurde. So hatte er schon etwas Schlagseite, als er halb vom Tisch aufstand, so als wollte er sich zu seinem Katheder begeben. Zum Glück bemerkte er dann aber gerade noch rechtzeitig, dass hier eisern gesessen wurde. Noch leicht benebelt nickte er dem einführenden Applaus entgegen, obwohl er sich mit aller Macht zusammenriss.
Cione hatte sein Statement gründlich vorbereitet. Das gehörte zu den Regeln, gegen die er niemals verstieß — denn schließlich konnte man vorher nie wissen, wann man vielleicht zu besoffen war oder eine Überdosis Speed erwischt hatte. Und er wollte hier beileibe nicht den Eindruck erwecken, als phantasiere er aus dem Orakel von Delphi. Er hatte die feste Absicht, weder aggressiv zu werden noch dummes Zeug zu faseln. Aber trotzdem, auf einmal machte es Klick in seinem Kopf, und er flippte aus.
Nur ein kleiner Teil des Publikums schien seine schrille Stimme überhaupt zu bemerken, die übrigens sehr verdächtig an einen Prediger erinnerte. Dafür explodierten diese Heinis fast von den ganzen »Jawolls!«, die sie losließen und den kurzen Applaussalven dazu. Es war, als ob man einen Haufen blauhaariger, aufgetakelter Schnepfen — dieses ältere Kaliber, das immer bei Mordprozessen herumlungert — vor sich habe, wie sie aufgeregt und zittrig auf ihren Stühlen hin- und herrutschen, wenn die Jury reinmarschiert kommt und bekannt gibt, dass sie sich mal wieder für die Todesstrafe entschieden hat.
»Unsere Zivilisation, freiheitlich und demokratisch, wie sie im Moment nun mal ist, gab den Beats Gelegenheit zu sagen, was sie zu sagen hatten, widmete ihnen weiß Gott wie viele Schlagzeilen und Stories — und zur Antwort stotterten sie nur dummes Zeug, grunzten dämlich und machten sich aus dem Staub. Ich habe versucht, diese sogenannten Bücher zu lesen«, blubberte Cione weiter, »keiner dieser Typen hat irgendetwas Interessantes zu sagen. Tip tip tip machen sie, eingeschlossen in ihren verlausten Hobolöchern — und was kommt am Ende dabei heraus? Tipata-tipata-tipata! Ein echter Byronscher Ersatzalbtraum: mieser Sex, miese Logik, mieser Atem, mieser Stil! Für diese kleinen ›personifizierten Wahnsinnspoeten‹, um Jack Kerouac zu zitieren, aus dem vielleicht sogar ein guter Schriftsteller geworden wäre, wenn er nur geschrieben hätte ...« — Ciones Fraktion gackerte pflichtschuldigst.
»Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass diese totgeschlagenen Beats mit der Bastonade der Disziplinlosigkeit auf ihre geschlagenen Füße geschlagen sind!« — Pause; dieser Satz musste erst einmal sacken, kein Mucks, kein Lacher war zu hören. »Und außerdem« — der Gipfel aller perversen Unverschämtheiten — »außerdem sind sie stupide!« Und dabei zog er das »i« in die Länge, als ob er einen molossischen Dimeter vor sich hätte.
»Buuuuh!«, blökte ein großer Teil des Publikums. Es gab nämlich auch eine ganze Menge Big-Beat-Studenten hier, denen sich schier der Magen umdrehte und die sich am liebsten in den Arsch getreten hätten, dass sie zwei Kröten gezahlt hatten, nur um bei diesem Zirkus dabei zu sein.
»Man kann ihr Chaos nicht bewundern«, tobte Cione ungerührt weiter. »Auch wenn es noch so verlockend ist, hab ich nicht recht?« Für einen Moment lang überschlug sich die Stimme. »Denn wenn sie uns erst einmal alle in ihre Spelunken und Absteigen gelockt haben, werden sie uns eiskalt fertigmachen und unsere Bewunderung mit Gewalt erzwingen!«
»Bullshit!« brüllte einer. »Halluzinationen!« der nächste. »Bravo!« ein dritter.
»Nie im Leben werde ich begreifen, warum Verleger — wohlgemerkt, wir beabsichtigen keineswegs, die verdienstvolle Bedeutung unserer Verleger zu schmälern —, aber ich kann nun mal nicht verstehen, wie sie so tief sinken und derart stupiden und viehischen Schund drucken konnten, nur um ihre jährliche Publikationsliste vollzukriegen!«
Anschließend stürzte er sich in eine endlose Litanei von Verbrechen, die die Beat-Generation begangen hatte, einschließlich ihrer »zügellosen Assoziationen aus nur halb verstandenen fremden Sprachen, ihrer pleonastischen Dichtung, die versucht, die rasenden Finger ausgeflippter Jazzmusiker nachzuäffen ...«
Während der letzten paar Sätze hatten sich Al und Ron bis ganz nach vorne durchgedrängelt. Ciones Augen schwammen irgendwo weit oben an der Decke, bei den Kronleuchtern; er fluchte und schimpfte und betete die unzähligen Beleidigungen herunter, die diese »heulenden Zen-Freaks«, »diese Parasiten im Fundament der kommunistischen Fassade« dem Rest der Menschheit angetan hatte — was übrigens bei Cheevy Samuelson eine gewisse Unbehaglichkeit auslöste.
Als nächstes ließ Cione eine ellenlange Tirade vom Stapel, die bis auf das Ende, »... neben ihren verlausten Matratzen Kerzenwachs auf die Korbflaschen mit billigem Chianti tropft«, unmöglich zu verstehen war, denn an dieser Stelle starteten Ron und Al ihr Unternehmen Kartoffelsalat.
»Eins, zwei, drei,« zählte Ron, und die zwei legten einstimmig los: »Am I Goethe?«, gefolgt von »hummmm« im Stil des Barber- Shop-Quartetts. Danach einen Ton höher: »Or am I Schiller, hummmm.« Und am Ende zielte Al zur Begleitung eines echten Beach-Boy-Falsetts »Or am I nothing?« in hohem Bogen auf Cione, der Teller löste sich und segelte fröhlich hinter dem großen Haufen Kartoffelsalat her, der sich unterwegs in ein gleichmäßiges Oval verbreiterte.
Das Komischste an der ganzen Aktion war ein würfelförmiges Stückchen Kartoffel, das aus irgendeinem Grund aus dem Haupttrupp ausgebrochen war und jetzt ungefähr fünfzehn Zentimeter vor ihm hersauste — wie ein mit Mayonnaise beschmiertes Stück Würfelzucker von Marcel Duchamp.
Cione merkte nichts. »Von ihrem Gejohle bläulich verfärbt ...«, das Kartoffelstückchen raste jetzt auf ihn zu, »... aber totenblass von ihren Lastern ...« und hielt Kurs auf die Nase des Barden — »... und faul wie Dreck!«
Wenn man sich diese Szene in einer Zeitlupenaufzeichnung ansehen könnte, würde man verfolgen können, wie eine kleine Ecke des Kartoffelstückchens tatsächlich in Ciones linkem Nasenloch landete, während der Rest weggerissen wurde, über die Backe glitschte, gegen das Augenlid prallte und schließlich in hohem Bogen über den Tisch flog. Dieser Vorgang spielte sich in Bruchteilen von Sekunden ab. Immer noch war der Haupttrupp des Salats der Vorhut unmittelbar auf den Fersen. Möglicherweise hatte Ptah seine Hand im Spiel, jedenfalls klatschte der Brei voll in Emils Gesicht, dann folgte noch der verknautschte Plastikteller — und schon pappte unserem Barden eine saubere Schicht von Zwiebel stinkendem feuchtem Schmand in der Visage!
Haha! Ha! Ha! Das Publikum lachte hämisch und vergaß für einen Augenblick die heiligen Zwecke dieser Versammlung. Sogar Ciones Doktoranden, die sich die ganze Zeit über eifrig Notizen gemacht hatten, krümmten sich vor Lachen. Schließlich war ihr Mentor mit seinen verklebten Augen im wahrsten Sinn des Wortes nicht in der Lage, ihre Schadenfreude zu bemerken.
Im selben Moment schlug der Moderator mit seinem Hammer auf den Tisch und kündigte die Pause an.