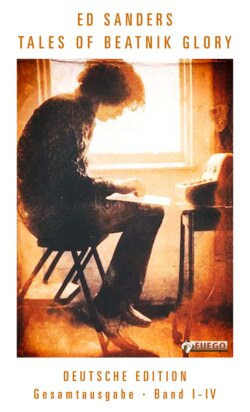Читать книгу Tales of Beatnik Glory, Band I-IV (Deutsche Edition) - Ed Sanders - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V
ОглавлениеEr war vollgefressen und glücklich — und die Angst vor einem leeren Magen war wie weggeblasen. In den Klauen des Food Hawk ist sogar ein geborener Keats nicht mehr er selbst und all seine Bösartigkeit zum Teufel. Barrett war jetzt genau in der richtigen Stimmung für eine ausgiebige Gaffersession in Rienzi’s Kaffeehaus, wo er seine müden Augen mit ein paar schönen, verrückten Ausblicken erfrischen konnte. Sandalen über straffen gebräunten Beinen, Muskeln, die unter leuchtend bunten Kleidern spielten und sich wölbten, und existenziell-glasige Blicke durchs Fenster, als er an der San Remo Bar vorbeikam. Er flanierte die Bowery entlang bis zur Bleecker Street, dann die Bleecker hoch bis zur McDougal und war überzeugt davon, dass seine ganze Umgebung von seinen neuen Bowlingschuhen und dem apollinisch-apollinairischen Jackett geblendet war, als er schließlich rechts in die McDouglas einbog und beim Rienzi’s ankam.
Er setzte sich an einen weißen Marmortisch mit eingelegtem Schachbrett direkt am Fenster. Denn was war schon eine Rienzi-Sitzung ohne den vollen Blick auf die McDougal-Street-Parade? Während all der Jahre im Village hatte Barrett Methoden des Gaffens entwickelt, die ihm fünfzehn Jahre später bestimmt enorm nützlich gewesen wären, wenn er sich dafür entschieden hätte, eine psychedelische Sekte mit sehtrainierten Jüngern aufzubauen, statt Professor / Barde für englische Literatur zu werden.
Er zündete sich eine kleine Henri Winterman an, bestellte Café Creme und hockte einfach da, trank erst Espresso, der von der Zitronenschale leicht verfärbt war, danach einen Cappuccino, dann noch einen starken Espresso und schraubte damit seine Energie bis auf den Grad von, sagen wir mal, einem Washington-Park-Haschwolken-Paranoia-Blick, mit dem er die vorbeistromernden Freaks durchbohrte. Seine mangelnde Selbstsicherheit war unter einem arroganten Gesichtsausdruck verborgen. Ab und zu beugte er sich über sein Notizbuch und versuchte, die vorbeiflitzenden Geistesblitze festzuhalten.
Er selbst hätte es nicht unbedingt Langeweile genannt, aber nach ein paar Minuten verursachte das angestrengte Starren eine innere Verwirrung, vielleicht sogar Verzweiflung, so ähnlich wie bei einem Sektenmitglied, das während einer Meditationssitzung angestrengt versucht, nicht gerade vor den Augen seines Gurus einzuschlafen. Deshalb begrüßte er jetzt freudig die Gelegenheit, sich auf das Mienenspiel von Rienzis Gästen konzentrieren zu können. Er hatte nämlich in der englischsprachigen Dichtung einen erschreckenden Mangel festgestellt, wenn es um die detaillierte Beschreibung der menschlichen Ausdrucksfähigkeit im Gesicht ging, ganz besonders in Momenten von Liebe, Leid oder geballter action. Was zum Beispiel war mit dem Mienenspiel in der Verführungsszene von Keats’ The Eve of St. Agnes los? Und forderte Ezra Pound nicht in einem Buch nach dem anderen dazu auf, »es anders zu machen!« Auf Grundlage solcher Überlegungen würde auch Barrett noch eines Tages mit einem großen Knall in die Literaturgeschichte eingehen, statt mit dem Winseln eines Hundes (widerliche Alternative!). So ließ er jetzt im Kaffeehaus seine Augen von Gesicht zu Gesicht schweifen und notierte sich jede Bewegung der Gesichtsmuskeln, die ihm auffiel. Bei einem Jungen und einem Mädchen, die am Nebentisch saßen, stoppte er und beschloss, ihr Mienenspiel in seinem Notizbuch sozusagen in Zeitlupe wiederzugeben. Vielleicht konnte er daraus mal eine Vignette für eine Kurzgeschichte machen, denn er gehörte keineswegs zu denen, die sich in die Karriere eines Dichters stürzen, ohne vorher gelernt zu haben, im Notfall auch mal schnell eine Story für irgendein Literaturmagazin zustandezubringen.
Nie konnte er eine Nummer des New Directions Annual im Buchladen an der Achten Straße aufschlagen, ohne unter den schlimmsten Gewissensqualen zu leiden, weil von ihm schon wieder keine Story dabei war. Eine Story, kein Gedicht, denn im Grunde hielt er seine Gedichte für viel zu unverständlich, abstrakt, für so total schmierig-brillant, dass nieman riskieren könnte, sie abzudrucken. Trotzdem war er von der sturen Überzeugung besessen, dass selbst die Kritiker eines Tages seine Karriere noch mal ausbeuten würden.
Das Mädchen hatte ein enges blaues Kostüm an und eine weiße Spitzenbluse, die unter dem westenartigen Oberteil des Kostüms hervorlugte. Barretts Notizbücher lassen sich leider nicht über ihre Haarfarbe aus, aber es fiel ihr glatt bis auf die Schultern und war in der Mitte gescheitelt. Die Ponyfransen reichten bis zu den Augenbrauen. Unter ihnen blickten zwei große, braune, ergebene, sinnliche Augen hervor — oder war das etwa nur die Erschöpfung vor den sommerlichen Prüfungen? Neben ihr saß Levine, ein Dichter, dem Barrett einmal auf einer Ginsberg-O’Hara-Dichterlesung im Living Theatre begegnet war.
Das Mädchen griff gerade in seine Handtasche und zog mit zitternden Händen ein Bündel sauber getippter Gedichte hervor — circa fünfzehn Seiten alles in allem. Levine nahm sie, las mindestens zehn Minuten aufmerksam eins nach dem andern und mahlte dabei zwischen seinen Kiefern eine imaginäre Prise Old-Mule-Kautabak. Einmal blätterte er zurück, und las dann mehrere Gedichte noch einmal, nickte dabei vor sich hin und summte offensichtlich zustimmend durch die Nase. Aber dann ging die Fetzerei los.
Langsam schraubte Levine seinen Füllhalter auf und beugte sich tiefer über die Blätter, während seine Augen schräg nach oben blinzelten und sich mit einem Unheil verkündenden Iwan-der-Schreckliche-Blick in die ihren versenkten. Barrett beobachtete das alles nichtsahnend. Die Kleine hatte den Kerl doch bestimmt nicht gebeten, ihre Texte zu überarbeiten oder zu verbessern.
»Du hast hoffentlich nichts dagegen ...«, war alles, was Levine noch rausbrachte, bevor er loslegte und in Windeseile Verschiedenes kappte, Phrasen und Sätze strich und sogar — Horror aller Dichterhorrors — ganze Zeilen umschrieb, kurz, ein fürchterliches Chaos veranstaltete.
Sie beobachtete ihn ruhig und mit bleichem Gesicht. »Siehst du diese Zeile?« fragte er und drehte das Blatt ein wenig, damit sie es besser lesen konnte. »Ich habe nichts kapiert«, zitierte er. »Also, statt nichts schreibe ich gewöhnlich ›null‹ oder ›zero‹, verstehst du? Weil ›nichts‹ ist so, äh, so unauffällig, aber ›null‹ ist ... klingt mehr wie, na ja, eben so, wie ein Dichter sich ausdrücken würde!«
Sie schien da gar nicht so sicher. Ihre Unterlippe kräuselte sich zitternd. Und wenn man sah, wie Levine die Blätter achtlos in der Hand zerknüllte, wusste man haargenau, dass er sie keineswegs für eine Dichterin hielt. »Ich hab null kapiert«, las er zufrieden und kritzelte die neue Version auf das Papier.
Im selben Moment, als Levine diesen Satz vorlas, beugte sich hinter ihm ein Typ mit einem abgetragenen roten Filzhut über das Gesicht seiner Begleiterin, hielt ihr eine ordinäre Glühbirne unter die Nase und rief: »Beweis mir, dass diese Glühbirne existiert. Beweis es!«
Barrett war ganz aus dem Häuschen, griff nach seinem Notizbuch und notierte hastig dieses ungewöhnliche Perlenpaar:
Ich habe null kapiert.
Beweis mir, dass diese
Glühbirne existiert.
Rienzi’s 1. 7. 1959
Ihr könnt es nachprüfen, in der Manuskriptsammlung der Brown-University-Bibliothek.
Nach dem zweiten Espresso und in der zweiten Stunde bei Rienzi musste Barrett mal. Unten bei den Toiletten, direkt neben der Treppe stand eine dicke Säule und dahinter ein Tisch, den man aber von der Treppe aus nicht sehen konnte. Als er die Stufen herunterkam, bemerkte er einen Schwarzen mit Baskenmütze und Sonnenbrille, der am Tisch saß und ein Zigarillo mit Elfenbeinhalter rauchte. Barrett grüßte nickend.
Der Mann warf einen kurzen Blick in seine Richtung, wie ein Baskettballspieler kurz vor dem Pass nach hinten, und ließ dann in typischer Dopedealer-Manier einen leise hingenuschelten Satz los: »Willste murmel murmel murmel Gras murmel murmel kaufen, Mann?«
Zuerst kapierte Barrett gar nicht, was der Typ von ihm wollte. Dann klickte es. »Vielleicht ’n Fünferpäckchen«, antwortete er und kam die letzten Stufen herunter. Es war wirklich bescheuert, auf der McDougal Street Hasch zu kaufen. Barrett wusste das. Aber irgendwie glaubte er, er müsste auf das Angebot eingehen, genau wie einer, der aus keinem Buchladen rausgehen kann, ohne wenigstens ein Buch zu kaufen, und sei es nur, um dem Mann an der Kasse einen Gefallen zu tun.
Da war zunächst einmal das Qualitätsproblem. In den meisten Village-Cafés dealten die berüchtigten linken Pusher, und es trug sicherlich nicht gerade zum guten Ruf der Beats bei, wenn spießige Hasch-Sucher von der Indiana University hier eine erbärmliche Mixtur von Katzenminze, Oregano, ein paar Stäubchen echtem Cannabis und vielleicht noch einer Prise entdoptem Vogelfutter angedreht bekamen.
»Kann ich’s mal sehen?« fragte Barrett. Ein Schimmer von Widerwillen flog über das Gesicht des Schwarzen, als er seine Hand in die Tasche steckte und Barrett ein kleines Stück Silberpapier mit einer knisternden Substanz zwischen die Finger schob. Dabei spähte er die ganze Zeit über die Schulter und die Treppe hoch, als wenn er jeden Moment die Bullen erwartete.
»Mach schon, Mann«, sagte er, »die Bullen sind überall.« Es war übrigens in Rienzis Pissoir, wo die ersten falschen Beatniks auftauchten, verkleidete Narcs mit Baskenmützen, Bärten, Sandalen, schwarzen Rollkragenpullovern und Pistolenhalftern unter der Achsel. Angeblich sollte es einen Heidenspaß machen, einen Beatnikbullen zu beobachten, wie er alle fünf Minuten aufs Klo wetzte, um jemand auf frischer Tat zu ertappen.
Barrett faltete das Papierchen an einer Ecke auseinander, warf einen Blick auf das grüne Kraut und schnüffelte. Komischerweise war das Gras beinah genauso giftgrün wie ein Billardtisch und es roch wie der Gewürzstreuer drüben in der Pizzeria.
Barrett ließ sich nie eine Gelegenheit entgehen, mit vollem Recht den Empörten zu spielen. Und das hier war die Gelegenheit. Seine gesamte weltliche Habe bestand im Moment aus zwölf Dollar. Wenn er fünf davon für diesen Schund opferte, warf ihn das auf ein Existenzminimum von sieben Dollar zurück, mit denen er eine ganze Woche auskommen musste. Spaghetti, altes Brot und was er sonst noch umsonst oder in der Sonne verfaulend auf dem Fulton Fish Market abstauben konnte. Außerdem konnte er sich dann auch nicht das Buch über die Techniken des japanischen No-Dramas abholen, das er sich vor ein paar Tagen in dem berühmten Orientalia Book Store bestellt hatte — übrigens auch eines von den wissenschaftlichen Gebieten, auf das ihn die gerissene Schreibe von Ezra Pound gestoßen hatte.
Aus diesen Gründen war Barrett eigentlich erleichtert und das No-Buch schon so gut wie bezahlt, als der Geruch des Grases andeutete, dass es keinen Pfifferling wert war. »Wieso versuchst du, mir Scheiße anzudrehen, Mann?« wollte er gefährlich laut flüsternd wissen. »Fuck, ich brauch bloß rüber auf die andere Straßenseite zu gehen und kann mir so ’n Mist umsonst aus dem Pizzastreuer holen!« Damit schmiss er das Papier auf den Tisch, stieg aufrecht die Treppe hinauf, ging zu seinem Tisch, bezahlte den viel zu teuren Beatsville-Kaffee und steuerte nach draußen, in die blendende Hitze der McDougal Street, einer so schmalen und hohen Straße, dass man meinen konnte, man ginge von einem Zimmer ins andere.
Barrett lief die McDougal Street hoch Richtung Washington Park. Plötzlich überholte ihn der Schwarze und streifte ihn mit der Schulter. Seine Worte zischten nur so an Barrett vorbei. »Wag ja nicht irgendwem zu erzählen, dass du auch nur glaubst, ich hätte versucht, dich zu linken, sonst haben wir zwei aber ein dickes Hühnchen zu rupfen!«
»Lass mich bloß in Ruhe, du Ganove.« Barrett stöhnte fast, als er antwortete. Der Pusher verschwand an der Dritten Straße West nach links um die Ecke, Richtung Sixth Avenue, blieb tänzelnd einer Meute Touristen auf der Spur und wurde schließlich in ihrer Mitte aufgesogen.