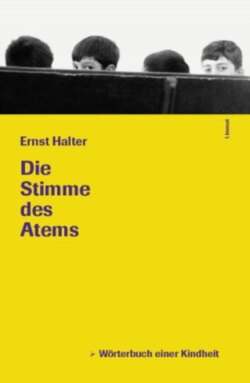Читать книгу Die Stimme des Atems - Ernst Halter - Страница 40
Intermezzo: Waschtag
ОглавлениеDer ersehnteste Wochenbeginn fällt auf jeden vierten Montag, wenn Frau Ess aus Wikon im Lozäärner um sieben Uhr ihr Rad das Strässchen heraufschiebt. Eine schwere Person, auf allen Seiten gleichmässig rund und kräftig, ohne Taille. Die grosse Wäsche wird angerichtet.
Unter dem Wasserschaff und dem Siedekessel mit dem mächtigen Deckel saust das Feuer. Frau Ess, Mama und Vroni arbeiten einander in die Hände. Zerknüllte Bettlaken füllen als erste Ladung den Vorwaschtrog aus galvanisiertem Weissblech, der rechts vom Spültrog an einer Wand der Waschküche verankert ist. Er erhält aus einem festen Hahn kaltes und aus einem Schwenkarm jetzt zischend heisses Wasser aus dem Schaff. Frau Ess ergreift den Stössel oder Stungger, eine Blechglocke mit Löcherkranz, am armlangen Holzstiel, taucht ihn ein, drückt ihn mit ihrem ganzen Gewicht in die eingeweichte Wäsche und zieht ihn wieder heraus. Er schmatzt und gurgelt, denn im Innern der mit einem Sieb verschlossenen Glocke wird ein in Längsrichtung verschieblicher Blechkolben mit jedem Stoss in die Tiefe gepresst und mit jedem Zug nach aussen gesogen. Drum schlürft und speit der Stössel, sein Durst scheint nicht zu stillen. Frau Ess hat die schwarze Gummischürze vorgebunden, ihre mächtigen Arme arbeiten wie Pleuelstangen. Sie ist das Herz der Einrichtung aus Kessel, Trögen, Zentrifuge und der Badewanne, welche die Waschküche ausfüllt.
Ich laufe durch die offenstehende Tür auf die mit Granitplatten belegte Terrasse und zur Regenwassertonne an der Hausecke, die von einer Kreisscheibe aus Drahtgeflecht überdeckt und gesichert wird. Im Wasser spiegeln sich körperlos die Maschen und meine eingekrallten Finger; unter ihnen erscheint mein Gesicht, fern und luftig, die Haare fallen in die Stirn. Und in unendlicher Tiefe von traurigem Indigoblau, taucht ein Föhnfisch auf, treibt durch die gespiegelten Maschen, tritt in meinen Kopf ein, fährt aus der rechten Schläfe hervor, mir sind zwei Flügel gewachsen. Um das Bild zu bewahren, folge ich mit dem Kopf der Wolke nach, die linke Hand greift über die rechte. Auf einmal ist unter mir der Rand des Betonrohrs; ich richte mich auf, von weither kommend, mir ist angenehm schwindlig.
Dampf und Dunkel füllen die Waschküche, ein warmer dichter Körper. Es brodelt, glunscht und gutscht, zischt aus Ritzen und schäumt die Hände der Wäscherinnen ein. Damit ihre Schuhe nicht aufquellen, stehen sie auf Holzpritschen, die vom Genässt- und Gescheuertwerden weiss sind. Die erste Vorwäsche wird aus dem Trog gefischt und triefend in den Siedekessel geschletzt, mit dem Stössel einige Male tief in die Seifenlauge hinuntergetunkt und zugedeckelt. Die Wäsche ist «unterwegs».
Frau Ess ist eine harte Arbeiterin, die einsilbig und nur zur Sache redet, zur Wäsche also. Ihre Zufriedenheit nährt sich aus deren Sauberkeit. Je fleckenloser, vom Vorwaschen über den Hauptwaschgang bis zum Nachspülen und Zentrifugieren, die Wäsche wird, desto besserer Dinge ist Frau Ess. Doch im Hinblick auf den brachialen Reinigungsvorgang liebt sie die schmutzige Wäsche. Frau Ess zeigt mir, wie beglückend eine Arbeit sein kann, wenn das Produkt nach zwei Stunden an der Leine in der Sonne blendet. Am Abend weiss und spürt Frau Ess, was sie gearbeitet hat. Sie blickt zurück auf Laken, Kissenbezüge, Unterhosen, Hemden und Socken, sieht sie im Frühlingswindchen leicht und kühl flattern, dreht sich auf die Seite und schläft mit einem schnarchenden Seufzer ein. Denn schnarchen tut sie, sonst hätte sie keinen Schnurrbart. Auch einen Mann hat sie, einen kleinen schwitzenden Wicht, den sie irgendwo in ihrem mächtigen Busen mit sich trägt.
Ich versuche nun, mich in der Waschküche nützlich zu machen, reiche den Stössel hierhin und das Waschbrett, weil Frau Ess die Taschentücher vornehmen will, dorthin. Das gewellte Blech schlurrt unter den auf- und abfahrenden Händen von Frau Ess. Ich stehe da und sehe zu; eine der Frauen nimmt mich sanft am Hinterkopf und führt mich einige Schritt beiseite. Ich ziehe mich zwischen die Badewanne und die Wäschezentrifuge zurück. Eine unheimliche Maschine, innen ausgekleidet mit einem Lochzylinder aus Chromstahl, der bis an den Grund gnadenlos sauber blitzt. Wer die Hand hineinhält, sagt die Mutter, dem wird sie abgerissen. Doch noch steht die Zentrifuge still und leer. So halte ich eine Weile den Arm hinein und trotze der Angst, die Maschine könnte sich, meinen Vorwitz zu bestrafen, von selbst zu drehen beginnen. Dann trete ich unter die offene Tür in den abziehenden Dampf.
Einer der ersten schönen Frühlingsmontage; die Wäscheleinen sind bereits quer über das Rasenparterre gespannt. Ich laufe die paar Treppenstufen hinunter und rüttle an einer der Tragstangen aus Leichtmetall. Vroni hat sie fest und sicher ins versenkte Eisenrohr gesteckt; der kleine Deckel, der verhindert, dass das Rohr sich mit Schlamm füllt, ist am Scharnier hochgeklappt. Über mir hängt die Wäscheleinenhaspel schief und unzufrieden und streckt die hölzernen, gegeneinander versetzten und drehbaren Aussengriffe in die Luft. Ich gehe über den Plattenweg, der um den Rasen herumführt, auf jede der bläulichgrauen Granitplatten einen Fuss setzend, was mich zu verschieden grossen Schritten und einigen Sprüngen zwingt. Ich habe die Blumenrabatten zu meiner Linken – kein gutes Gefühl. So bleibe ich auf dem Sitzplatz hinter der Scheinzypresse stehen, schliesse die Augen und drehe mich mit einem Schwung auf einem Absatz zweimal um mich selbst. Augen auf! Nun liegen die Rabatten auf der guten Seite. Die Primeln blühen; kostbar sind mir die weinroten, violetten, sonnenblumengelben, und die eine dunkelblaue. Ich erinnere mich, dass sie am Fuss der Trockenmauer vor der Hausterrasse blüht, und hüpfe zurück.
Durch die Waschküchentür über mir die Stimmen der Frauen, ruhig, sachlich, hie und da, um ein Zischen oder Klatschen zu übertönen, leicht angehoben, verständlich fast nur die alltäglichen Wendungen: Die Socken dort drüben. – Nochmals. – So, die sind sauber. Die Wäschezentrifuge wummert. Klatsch liegt weder meiner Mutter noch der Wäscherin. Wenn über andrer Leute Wäsche gesprochen wird, dann objektiv. Auch so hatʼs Löcher drin. Ein deutlich hörbares Müdewerden der Stimme meiner Mutter, ein Erlöschen ihres Interesses nähme jedermann die Lust, sich hinter vorgehaltener Hand im übertragenen Sinn weiterzuverbreiten. Sie ist der Meinung, man müsse zu dem, was man gesagt hat, auch vor denen stehen können, die es betrifft.
Meine Nase steckt tief im dunkelrostbraunen Kelch einer «General de Wet»; den seifigen Mief der hellgelben Tulpen mag ich nicht, dagegen lockt mich der bittere Schokoladenduft der dunklen Arten. Vronis helle Stimme ruft mich, in einer Viertelstunde sei das Znüüni auf dem Tisch; ich richte mich auf, das Mädchen winkt aus der Waschküchentür. Als ich eintrete, ist Vroni mit der Wäscherin allein; die Mutter bereitet oben den Imbiss zu. Frau Ess, die Ärmel ihres Überkleids aus ausgebleichtem blauem Leinen hinter die Ellenbogen gerollt, steht in der schwarzen Gummischürze vor dem Siedekessel. Mit einem letzten Schnorcheln zieht sie den Stössel heraus und versenkt ihn linker Hand im Vorwaschtrog, wo die zweite, längst eingeweichte Portion bis obenauf schwimmt. Sie ergreift einen fasrigen schneeweissen Holzstab, sticht damit in die dampfende Tiefe des Kessels und hebt mit einem Stöhnen der Anstrengung die erste Wäscheladung, alles Bettlaken, aus dem Sutt. Sie dreht, lässt abtriefen, dreht; die Leintücher winden sich zu einem dicken Wulst um das Stangenende. Nun flutscht sie den dampfenden Knäuel in weitem Bogen in den Spültrog. Vroni dreht bis zum Anschlag an den Flügeln des Kaltwasserhahns, das Wasser spritzt. Genug! Mit dem Stössel vertreibt Frau Ess die Laugereste aus der gesottenen Wäsche. Inzwischen schöpft Vroni mit dem Goon, einer langstieligen, etliche Liter fassenden Blechkelle, das verbrauchte Wasser aus dem Siedekessel und giesst es in den kleinen Betonkännel am Fuss der Waschküchenwand; milchig trüb rinnt es dahin. Zuletzt ergreift Frau Ess den Siedekessel an beiden Messinghenkeln, hebt ihn heraus und schüttet den Rest der Lauge durch die Dole hinter der Türschwelle. Vroni wartet am Schwenkhahn; der Kessel wird wieder eingesetzt, Heisswasser für den zweiten Sud läuft ein. Mit beiden Händen hebt Frau Ess die Ladung – Frottierzeug, Kissenbezüge, Servietten – aus dem Vorwaschtrog, lässt sie abtriefen und klatscht sie in den Siedekessel, dann zerrt sie an einem Bändel und zieht sich die schwarze Gummischürze wie eine enge Haut vom massigen Leib. Wieder steht sie in verwaschen blauem Leinen da. Vroni hat Holz nachgelegt; Frau Ess dreht den Heisswasserhahn am Schwenkarm zu und stülpt den Deckel über den zweiten Sutt. Wir treten erst in den Kellervorraum, dann in den gefliesten Korridor hinter der Haustür, steigen die Kunststeintreppe hoch in den Flur und lassen dort die trotz der Holzpritschen durchnässten Schuhe neben der Schwelle der verglasten Esszimmertür stehen.
Drei Frauen und ein Bub versammeln sich am Tisch mit den gerundeten Schmalseiten; ich bin stolz, als ob auch ich schwer gearbeitet und die Zwischenmahlzeit verdient hätte. Sie sitzen auf den Stühlen mit blaugrünen Samtpolstern, mir haben sie mein Rosshaarkissen an den Platz des Vaters auf der Eckbank gelegt, wo die östliche und die südliche Fensterfront zusammentreffen. Frau Ess, welcher dieser Ehrenplatz gebührte, hätte Mühe, sich zwischen Tisch und Bank durchzuzwängen. Schwarzbrot, Butter, Käse, dazu Schwarztee in preussischblauen Steinguttassen. Frau Ess behandelt sie mit Ehrfurcht, obwohl sie wie Spielzeug in ihren fleischrosigen Wäscherinnenhänden liegen.
Draussen blinken die jungen Blätter in der Sonne. Wieder mal Glück gehabt, sagt Frau Ess. Gestern, als es nicht aufhören wollte zu regnen, bin ich mir nicht sicher gewesen, ob wir heut die Wäsche draussen würden trocknen können. – Ja, der Föhn, antwortet meine Mutter. Wir werden nach dem Zvieri die Leintücher abnehmen, nicht wahr, Vroni? Vroni nickt. Um diese Zeit allerdings wird Frau Ess sich verabschiedet haben. Noch eine Tasse, Frau Ess? – Wenn ich so frei sein darf. – Und bedienen Sie sich mit Butter und Käse. – Sehr gerne, ein herrlicher Greyerzer. – Vroni, sei so lieb und hol den Kuchen. Vroni geht hinaus, kommt zurück. Die Frauen reden halblaut, eigentlich nur über das, was vor den Augen oder unter den Händen ist. Ihr Gespräch entfernt sich allmählich, wird zum murmelnden Hintergrund, und die Vormittagssonne hüllt mich und meine halb wachträumenden Gedanken in einen warmgoldenen Kokon.
Geborgen im Schutz der drei Frauen, blicke ich von der einen zur andern. Vronis andächtiges Gesicht scheint darauf zu warten, dass man ihm etwas vorschwindelt. Ich wandere mit den Augen weiter, sehe durch die Ostfenster zu den Kirschbäumen hinüber, die bereits abgeblüht haben, mache einen Sprung in die Tiefe des Bilds, wo die hellgrünen Buchenmassive des Waldrands den Osthorizont schliessen. Ich schwimme jetzt in einem körperwarmen, leicht zu atmenden Element, mir kann nichts geschehen, ich bin zu Hause, dies sind drei Frauen, die eine Pause in der grossen Wäsche eingelegt haben, sie gehören ein bisschen mir, wie auch ich ein bisschen ihnen gehöre, im Flur hinter der verglasten Tür ist der Spielzeugschrank, und ich sitze am Platz des Vaters. Alles ist am richtigen Ort und leicht erreichbar, die Sonne macht die Worte der Frauen hell und wärmt mich; wenn ich die Augen schliesse und sie mir durch die Lider scheinen lasse, tauche ich durchs Rote Meer und weiss: Nie kann es anders werden.
→Apfelstrudel →Dampfdreirad →Langweil →Das Teeservice →Vroni B.