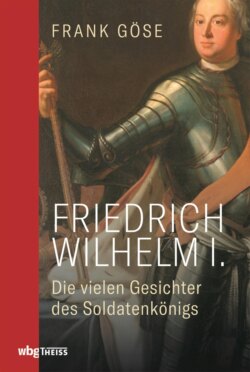Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 24
Vor einem Neuanfang? Die Spitzenbehörden
ОглавлениеEs ist gezeigt worden, dass Friedrich Wilhelm bereits während seiner Zeit als Kronprinz in viele politische Materien eingeführt wurde – jedenfalls intensiver, als das bei den Thronfolgern in anderen Dynastien bzw. im Hause Brandenburg sonst erfolgte. Dies betraf nicht zuletzt seine Mitarbeit in der damaligen höchsten Regierungsbehörde, dem Geheimen Rat, oder wie er offiziell tituliert wurde: dem Wirklichen Geheimen Staatsrat.1 An dessen Sitzungen nahm der Kronprinz nachweislich der Protokolle seit 1705 sehr häufig teil, im Jahre 1711 war er zum Beispiel bei 30 der insgesamt 36 Sitzungen dieses Gremiums zugegen.2 Durchschnittlich einmal pro Woche (in den Sommermonaten konnten die Abstände größer sein) versammelte sich der Geheime Rat im Berliner Stadtschloss, in Potsdam, Charlottenburg oder vereinzelt auch in jenen Lust- und Jagdschlössern des Berliner Umlandes, die der alte König für kurze Aufenthalte aufsuchte. Auf den Sitzungen wurde ein mitunter anspruchsvolles Pensum abgearbeitet; das Programm konnte gerade während der letzten Regierungsjahre Friedrichs I. bis zu 60 Tagesordnungspunkte umfassen. Friedrich Wilhelm war also schon in relativ jungen Jahren mit nahezu allen Feldern der Politik vertraut gemacht worden, wurde im Geheimen Rat doch eine breite Palette von Angelegenheiten behandelt. Lehnsangelegenheiten und steuerpolitische Fragen gehörten ebenso dazu wie territoriale Streitigkeiten an den Landesgrenzen, Beschwerden einzelner regionaler Amtsträger bis hin zu den diffizilen außenpolitischen Themen. Gerade die Mischung von Materien größter staatspolitischer Wichtigkeit einerseits mit Bagatellangelegenheiten andererseits, die zu den zeitlich sich mitunter sehr lange hinziehenden Sitzungen geführt hatte, mochte ein gewisses Unbehagen beim Kronprinzen hervorgerufen haben. Die Tatsache, dass einige der Angehörigen dieses Gremiums, wie etwa der Generalkriegskommissar und der Präsident der Geheimen Hofkammer, qua Amt im Geheimen Rat saßen, wurde in der älteren Forschung so interpretiert, dass der Geheime Rat so etwas wie die »große Zentralkanzlei des Staates bildete, in der die formelle Verteilung der Geschäfte und die Erledigung schon entschiedener Aufträge stattfand, während die tatsächlichen Vorgänge des Verwaltungslebens sich in den Behörden abspielten«.3 Auch die sich daraus erklärenden Doppelungen und Redundanzen mochten den Kronprinzen bewogen haben, im Sinne einer Effektivierung schon bald nach dem Thronwechsel von 1713 auf Änderungen zu drängen.
Zwar blieb dieses Gremium formell weiter bestehen, wurde aber zunehmend zu einem »caput mortuum«, einem Rahmen, »außerhalb dessen sich die Minister normalerweise bewegten, um nur in Abständen in ihn zurückzutreten. Im behördlichen Alltag existierte er bald nur noch als ein Departement für Justiz-, Kirchen- und Schulsachen«, also jene Themenfelder, die es »noch nicht zu Sonderbehörden gebracht« hatten.4 Gemessen an den Ratssitzungen vor 1713 umfasste das Programm im Durchschnitt nur noch 15 Tagesordnungspunkte. Die behandelten Themen reichten von Eingaben bezüglich der Neubesetzung bzw. Besoldung von Stellen in regionalen Verwaltungsbehörden oder in Kirchen über außenpolitische Materien bis hin zur Behandlung von Angelegenheiten der Universität Frankfurt (Oder) und Vorkehrungen gegen das Viehsterben. Dieses Spektrum engte sich in den nächsten Jahren ein: Nachweislich der Protokolle des Geheimen Rates der 1730er Jahre standen dort vorrangig Themen auf der Tagesordnung, die sich mit Rechtsangelegenheiten befassten – Zuständigkeit der verschiedenen Berufungsinstanzen, Revisionssachen, Beschleunigung von Prozessen, grenzübergreifende Rechtskonflikte.5 Vorrangig wurden hier zwar Einzelfälle behandelt, allerdings sind auf den Beratungen auch Entscheidungen gefällt worden, die auf direkt vom König erteilten Anordnungen beruhten.
Jean-Baptiste Broebes: »Prospect der Palläste und Lust-Schlösser Seiner Koniglichen Mayestätt …«: das Potsdamer Stadtschloss (1733).
Schloss Charlottenburg. Kupferstich, nach 1701.
Die eigentliche Verwaltungsarbeit verlagerte sich mehr und mehr in die Spezialbehörden. Der König förderte diese Entwicklung und forcierte die damit in Verbindung stehende veränderte Arbeitsweise. Angesichts der mit Vehemenz betriebenen Reformen war es schon aufgrund des Zeitbudgets kaum mehr möglich, dass die Räte, die ja zumeist wichtige Ämter in anderen Behörden bekleideten, an den mitunter ausufernden Sitzungen des Geheimen Rates teilnehmen konnten.6 Zwar gehörten die wichtigsten Amtsträger der preußischen Zentralverwaltung nominell weiterhin dem Geheimen Rat an, doch wohnten etwa die Präsidenten des Generalkriegskommissariats und des Generalfinanzdirektoriums, v. Blaspiel und v. Kameke, sowie Friedrich Wilhelm von Grumbkow nicht jeder der nun generell nur noch einmal pro Woche stattfindenden Sitzungen dieses Gremiums bei.7
Auch in anderen Verwaltungsbereichen wurden wichtige Veränderungen vorgenommen. Bereits einen Tag nach dem Thronwechsel war das sogenannte »Kabinettsconseil« gebildet worden, das künftig für die Bearbeitung der »Staats- und ausländischen Affairen« zuständig sein sollte.8 Ebenso fällt der schon einen Monat nach dem Thronwechsel erfolgte Zusammenschluss des Generaldirektoriums und der Geheimen Hofkammer zum Generalfinanzdirektorium ins Auge, das im Berliner Schloss seinen Sitz hatte.9 Damit lagen die Domänen- und Schatullgüterverwaltung in einer Hand, ebenso wie die Post-, Forst-, Berg- und Hüttensachen sowie die Salzadministration von hier verwaltet wurden.10 Dieser Behörde unterstand die Generalfinanzkasse, in die die sogenannten nichtsteuerförmigen Einnahmen, also die Domänenerträge, Zölle und Regalien flossen. Neu war auch die Charge des Generalkontrolleurs der Finanzen, die der König an den bei ihm in großem Vertrauen stehenden und eine rasche und steile Karriere machenden Ehrenreich Bogislaw (von) Creutz verlieh.
Hingegen stehen auf der anderen Seite die institutionellen und personellen Kontinuitäten. An der Spitze des Generalfinanzdirektoriums blieb der Präsident der Vorgängerbehörde, Ernst Bogislav von Kameke. Das Generalkriegskommissariat, also jene Behörde, die wie keine zweite den besonderen Charakter der brandenburgisch-preußischen Verwaltung auszumachen schien, wurde bis zu der im Umfeld der »Klement-Affäre« erfolgenden Ablösung durch Johann Moritz von Blaspiel geleitet. Die Kommissariatsverwaltung ist in den 1650er Jahren vornehmlich zur Finanzierung des seit der damaligen Zeit immer weiter ausgebauten Heeres geschaffen worden. Die im Generalkriegskommissariat verankerte Generalkriegskasse verwaltete die Akzise- und Kontributionseinnahmen. Das bekannte Diktum von Otto Hintze vom »Krieg als Schwungrad an der Staatsmaschine« fand gerade in diesem Behördenzweig seine fast schon ideal zu nennende Entsprechung.11 Mit dem Anwachsen des stehenden Heeres nahm der Einfluss des Generalkriegskommissariats innerhalb des Verwaltungssystems zu. Mehr und mehr traten neben den Zuständigkeiten der Kommissariate bei der Heeresversorgung und -finanzierung (Steuerverwaltung) auch Kompetenzen im Bereich der Wirtschafts- und Siedlungspolitik hinzu. Und es gehört zu den mitunter unterschätzten Tatsachen, dass das Generalkriegskommissariat während der langen Kriegsjahre schon unter dem ersten preußischen König einen beträchtlichen Bedeutungs- und Reputationszuwachs erlebt hatte. Noch am Ende der Regierungszeit Friedrichs I., am 7. März 1712, war eine Reorganisation des Generalkriegskommissariats veranlasst worden, die zu einer stärker institutionalisierten und kollegialischen Arbeitsweise geführt und dabei schon in gewisser Weise jene Reformen antizipiert hatte, die der neue Monarch zu Beginn der 1720er in Gang setzen sollte.12 Nicht unwesentlich erscheint es dabei, dass kein geringerer als der beim Kronprinzen und nach dem Regierungswechsel beim König in hohem Ansehen stehende Friedrich Wilhelm von Grumbkow eine wichtige Rolle bei der Neuorganisation des Generalkriegskommissariates gespielt hatte.13 Allerdings gilt es, die Augen nicht davor zu verschließen, dass die in der Kommissariatsverwaltung tätigen Amtsträger keine ausschließlichen »Werkzeuge des monarchischen Willens« verkörperten und sich vornehmlich als »Hauptinstrument zur Zertrümmerung des alten ständischen Staates« gebrauchen ließen.14 Auch sie bewahrten eine gewisse Eigenständigkeit und konnten durchaus Gestaltungsspielräume nutzen. Dies unterschied sie kaum von den Amtskollegen in anderen Behördenzweigen. Der Eindruck der größeren Rigidität und Professionalität der Kommissariate dürfte vielmehr dadurch entstanden sein, dass sich durch ihre Kompetenzen in der Militärverwaltung und die ständige Zusammenarbeit mit Offizieren gewisse Mentalitäten und Arbeitsabläufe entwickelten, die eine besondere Affinität zum militärischen Milieu aufwiesen.