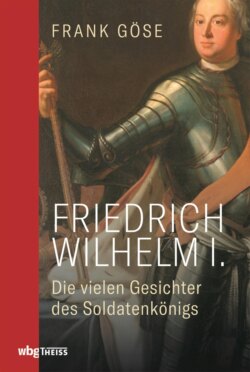Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 26
Zwischen Anspruch und Realität. Der Regierungsalltag
ОглавлениеDoch wäre natürlich das Unterfangen verfehlt, den sich in Instruktionen und Ordnungen widerspiegelnden institutionellen Aufbau des Verwaltungsapparates als alleinige Grundlage für die Erklärung des Regierungshandelns heranzuziehen. Die vom König in teils markigen Worten verfassten Resolutionen und Kabinettsordren können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es selbst in dem scheinbar so auf Effizienz getrimmten Räderwerk der preußischen Verwaltung zu Reibungsverlusten, Redundanzen und all den anderen Symptomen frühneuzeitlicher Herrschaftspraxis kommen konnte. Es handelte sich dabei um jene strukturellen Rahmenbedingungen, die schon seit Langem zu einer zurückhaltenden Beurteilung der administrativen Effizienz Veranlassung gegeben hatten. Die ständige Wiederholung der häufig gar nicht regelmäßig und flächendeckend versandten Edikte und Verordnungen deutet die Grenzen der Wirkungsmächtigkeit solcher landesherrlichen Gesetzgebungspraxis an. Diese Verordnungen würden, so eine zeitgenössische Einschätzung, »abgefasset, publiciret, nur selten aber befolget«.37 So hatte, um hier nur zwei konkrete Beispiele anzuführen, der König im Juni 1728 erfahren müssen, dass in der in Stettin ansässigen Hinterpommerschen Kriegs- und Domänenkammer »daselbst viele Sachen nicht ordentlich vorgetragen und collegialiter tractiret … werden, ohne daß der Wirkl. Geh. Etats Rath und Präsident von Massow davon weiß«. Deshalb erging der Befehl an das Generaldirektorium, für eine Abstellung dieses Mangels zu sorgen.38 Und in der Umgebung von Marienwerder hatte die Verwaltung im Umfeld der Einrichtung des Kantonsystems 1733 sogar vergessen, vier Dörfer in die »Designation« der Feuerstellen aufzunehmen.39
Vor diesem Hintergrund stellt sich die grundsätzliche Frage, auf welcher Grundlage der Monarch überhaupt seine reglementierenden Vorstellungen umsetzen konnte. Letztlich war er ja auf Informationen angewiesen. Angesichts der großen Zahl an Städten, Domänenämtern und Gutsherrschaften konnte zwangsläufig nur ein Teil dessen zu seiner Kenntnis gelangen, was in seinen flächenmäßig zu den größeren europäischen Staatswesen gehörenden Ländern passierte. Dass frühneuzeitliche Herrschaft vor allem als ein hochkommunikativer Prozess aufzufassen ist und der Grad der administrativen Durchdringung eines Territoriums letztlich von den infrastrukturellen und personellen Rahmenbedingungen – und nicht zuletzt dem Wetter – abhängig war, hat eine intensive kommunikationsgeschichtliche Forschung in den letzten Jahrzehnten an vielen empirischen Fallbeispielen vorführen können. Auch mit Blick auf die Verhältnisse im Preußen des 18. Jahrhunderts wird man sich keinen übertriebenen Vorstellungen hingeben dürfen – trotz einiger Innovationen.40
Mochte der königliche Zugriff auf die mittlere Ebene der Verwaltung, also auf die Behörden in den Provinzen des Gesamtstaates, noch halbwegs gewährleistet sein, sah dies auf der unteren Ebene, also in den Kreisen, Städten und Dörfern, schon etwas anders aus. Hier geraten nun die Landräte ins Spiel – eine Amtsträgercharge, die sich in einem längeren verwaltungsgeschichtlichen Prozess aus verschiedenen Wurzeln herausgebildet hatte und in ihrer Bedeutung kaum zu überschätzen ist.41 Deshalb nahm Friedrich Wilhelm I. auch auf die Besetzung dieser Chargen Einfluss. Die Beweggründe für seine Personalentscheidungen lassen sich indes nicht immer genau rekonstruieren. Zum Teil kannte er die Anwärter persönlich aus anderen Zusammenhängen und traute sich ein – manchmal recht vorschnell und apodiktisch ausfallendes – Urteil zu. In der Regel näherten sich die Positionen zwischen dem König und den Kreisständen an. Beispielsweise sagte er dem Capitain v. Werthern zu, es werde dabei bleiben, dass »Ihr den LandRath Dienst in der Neumarck haben sollet«.42 Ansonsten war er auf Empfehlungen anderer Amtsträger und Offiziere angewiesen. So folgte der König im Januar 1740 der Vorstellung des Obristen v. Massow und beschloss, dass »dessen Schwager die vacant gewordene Landraths-Stelle im Zauchischen Creyse haben soll«.43
Die Landräte mussten mit den verschiedenen, zuweilen miteinander in Konflikt geratenden Loyalitäten zurechtkommen. Denn zum einen galten sie als eine Art verlängerter Arm der Landesherrschaft, unterstanden also den für sie als vorgesetzte Provinzialbehörde fungierenden Kriegs- und Domänenkammern. Zum anderen aber erwarteten die kreisangesessenen, vornehmlich adligen Rittergutsbesitzer, aus deren Mitte der Landrat in der Regel gewählt wurde, von jenem eine Berücksichtigung ihrer Interessenlagen. Aus dieser Konstellation erwuchs das immer wieder gern zitierte Diktum, dass die Reichweite der Landesherrschaft, also damit des damaligen »Staates«, nicht über die Kreisebene hinausreichte; mit anderen Worten, »daß das Landratsamt die Grenze war, über die der monarchische Einfluß nicht wesentlich hinausgelangt ist«.44 Überdies gilt es zu bedenken, dass auch für diese in der älteren Sicht ob ihres Prestiges und ihrer Effizienz gerühmte Amtsträgergruppe jene Einschränkungen galten, die generell dem frühneuzeitlichen Verwaltungshandeln eigen waren. Zum Alltag ihres Amtes gehörte, dass ihnen nur ein kleiner, meist aus zwei bis drei Personen bestehender »Stab« von Gehilfen zur Verfügung stand. Die Amtsgeschäfte führten sie in der Regel von ihrem Rittersitz aus. Der noch sehr altertümlich anmutenden, aber damals durchaus üblichen Arbeitsweise konnte Friedrich Wilhelm I. aus pekuniären Erwägungen etwas abgewinnen. Als es im Jahre 1720 im Zusammenhang mit der Zahlung von Diäten an die Landräte für ihre Aufgaben bei der Organisation der Durchmärsche und Einquartierungen der Truppen zu Diskussionen kam, unterstellte ihnen der König, dass sie »Ihre Arbeit ohne Noht mercklich extendiren, nur damit sie desto mehrer Diäten und Reisen Kosten zu fordern haben mögen«. Einige Arbeiten könne ein Landrat deshalb wie gewohnt »zu Hause und in seiner Stube verrichten«.45
Auch auf der Ebene der Dorfgemeinden hatten die Landräte einen wichtigen Part zu spielen. Der König verfügte im Jahre 1717, dass diese Amtsträger die Weiterleitung der königlichen Verordnungen und Edikte zu verantworten hatten. Jeder adlige Rittergutsbesitzer erhielt demnach eine und jedes Dorf zwei Ausführungen der Edikte.46 Trotz der Neuregelungen erwies sich der landesherrliche Zugriff hier aber als wesentlich geringer. Mit der »Policey«-Gewalt, der Patrimonialgerichtsbarkeit und dem Patronatsrecht verfügten die adligen Gutsherren über entscheidende Privilegien und wurden vor allem in den ostelbischen Provinzen als die Obrigkeiten wahrgenommen und – vor dem Hintergrund einer paternalistischen Herrschaftspraxis – auch akzeptiert. Für die Dorfbewohner war der »Staat« daher allenfalls auf dem Gebiet des Militärwesens im Rahmen der Rekrutierungspraxis unmittelbar fühlbar.
Es handelte sich also allenfalls um eine »gestufte Staatsunmittelbarkeit«.47 Friedrich Wilhelm I. war dies fraglos bewusst, doch empfand er den tradierten Instanzenzug über mehrere Ebenen zuweilen durchaus als Mangel. Deshalb war seine Regierungspraxis auch immer wieder von dem Bemühen geprägt, einen direkten Zugriff auf die Amtsträger in Stadt und Land zu erhalten, denn nur so schien ihm eine halbwegs realitätskonforme Informationsbeschaffung und eine möglichst direkte Umsetzung seiner Anweisungen möglich. Viele seiner Kabinettsordren richteten sich deshalb direkt an die Landräte, also unter Umgehung der Mittelbehörden: Am 23. Mai 1729 sandte er zum Beispiel eine Verfügung an die uckermärkischen Landräte, die »die nöthige Mannschaft zu dem dortigen Fortifications Bau gegen Bezahlung herbeizuschaffen« hätten.48 1735 brachte der König in Erfahrung, dass im hinterpommerschen Kreis Greifenberg »ein junger Edelmann nahmens von Lettow befindlich, von welchem Ich will, daß Er Mir unter dem Corps Cadets alhier dienen« solle. Deshalb befahl er dem zuständigen Landrat v. Manteuffel, »daß Ihr sofort nach erhaltung dieser ordre demselben anhero schicken und an das Corps Cadetts abliefern lassen sollet«.49 Auch in scheinbar nebensächlich anmutenden Angelegenheiten wandte sich Friedrich Wilhelm I. auf direktem Wege an den zuständigen Landrat. Im Juni 1729 erging ein Befehl an den Landrat des Teltower Kreises, v. Otterstedt, dem Major v. Einsiedel für den Transport seiner Möbel 25 Wagen zur Verfügung zu stellen.50
Doch auch auf der obersten Ebene hielt er sich nicht immer an das vorgegebene Prozedere und setzte sich mitunter über Ressortverantwortlichkeiten hinweg. »Wenn ihn etwas stark bewegte, benutzte er den nächsten Rat, der ihm gerade zur Hand war, um das Geschäft nach seinen Befehlen abzuwickeln.«51 Des Weiteren wurde das in Ansätzen schon vorgegebene System einer für damalige Verhältnisse vergleichsweise effizienten Kontrolle und Überwachung der Amtsträger weiter perfektioniert. Dazu zählten regelmäßig eingeforderte Berichte, die etwa in Gestalt der jährlich einzusendenden Vasallentabellen einen Überblick über die personelle Struktur des Adels und den Wert seiner Rittergüter in den Provinzen vermitteln sollten – eine Praxis, die aufgrund ihres Neuwertes zunächst auf große Ressentiments innerhalb der Ritterschaft stieß. Die »Historischen Tabellen« dienten mit ihren Angaben über die Gewerbestruktur und das Steueraufkommen in den Städten wiederum als statistische Grundlage für wirtschaftspolitische Maßnahmen. Und die nach dem entsprechenden Vorbild im Heer geführten »Conduitenlisten« sollten Auskünfte über die Qualitäten und Defizite seiner Amtsträger geben. Ebenso diente ein ausgeklügeltes System von »Spionen« diesem Zweck – eine Einrichtung, die der König später auch dem Generaldirektorium zur Kontrolle der Kriegs- und Domänenkammern empfahl.52 Von daher war die an das Generaldirektorium im Oktober 1732 gerichtete Bemerkung Friedrich Wilhelms, er wisse »von guter Hand«, dass »sehr viel Beamte und Pächter mit Abtragung ihrer Pachtgelder noch weit zurück seind«, als Drohung zu verstehen, ihn nicht mit angeblich schöngefärbten Berichten zu behelligen.53 Allerdings sollten nicht nur Amtsträger auf der mittleren und unteren Ebene auf jene Weise kontrolliert werden, sogar die Minister blieben davon nicht verschont. In einem geheimen Erlass wurde der Minister v. Katsch, seines Zeichens Vizepräsident im Generaldirektorium, beauftragt, seine Kollegen in dieser Zentralbehörde zu überwachen, besonders dann, »woferne in kollegio nit fleißig gearbeit[et] wirdt und anzügl[iche] Reden gebrauchet« werden, und »da unter die Ministris Intrigen Passieren sollten soll er mir geleich davon Pardt gehben«.54
Der König beließ es indes nicht nur bei solchen eingeforderten Berichten über die Amtsführung. Auch wenn das Informationssystem noch so ausgeklügelt sein mochte, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass dem Monarchen ein gefiltertes Bild über die tatsächlichen Zustände in den Provinzen vermittelt wurde. Doch stand eine Reihe von Alternativen zu dem behördenmäßigen Geschäftsgang zu Gebote, die zwar keine Neuerung während der Regierungszeit des zweiten preußischen Königs darstellten, wohl aber eine Intensivierung und größere Regelhaftigkeit erfuhren. Vor diesem Hintergrund sind solche Anweisungen zu erklären wie die im Dezember 1735 an das Generaldirektorium ergangene Kabinettsordre, in der er die Minister zu einer strikten Informationspflicht selbst außerhalb ihrer offiziellen Amtstätigkeit anhielt. Sie sollten, auch »wenn Sie in denen Provinzien, … nur in ihren privat Angelegenheiten verreisen …, die bemerckte Unrichtigkeiten dem Collegio anzeigen«.55 In einer seiner letzten Kabinettsordren kurz vor seinem Tode ermahnte er den Präsidenten der Kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer, von der Osten, »sich so wenig auf die Berichte derer Beamten … allein [zu] verlassen, sondern [er sollte] alles selbsten gründlich und genau einsehen und examinieren«.56 Auch von seinen Ministern und Kammerpräsidenten erwartete Friedrich Wilhelm I. ein ebensolches Misstrauen gegenüber ihren subalternen Amtsträgern, wie er es an den Tag legte.57