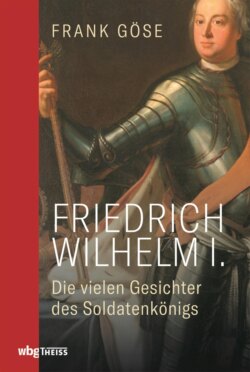Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 35
Schuldenabbau und Sanierung des Haushaltes
ОглавлениеDie nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms I. eingeleiteten umfangreichen Maßnahmen zur Sanierung des Haushaltes, so ist gezeigt worden, hatten ihren Ursprung schon während seiner Zeit als Kronprinz. Spätestens nach dem Sturz Wartenbergs war sein Einfluss nicht nur auf die Führung der allgemeinen Staatsgeschäfte gestiegen, sondern Friedrich Wilhelm hat gerade auf dem Gebiet der Militär- und Finanzverwaltung unmittelbar in die Entscheidungsfindung eingegriffen und sich speziell in die Materien des Generalkriegskommissariats eingearbeitet.3 Im Rahmen unserer Erörterungen über die gleich nach seinem Regierungsantritt vorgenommenen radikalen Kürzungen im Hofstaat ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich auch diese Entscheidungen schon in den Jahren zuvor angedeutet hatten. Es kann nur vermutet werden, ob die von Ilgen für die anderen Geheimen Räte im Namen des Königs aufgesetzte Denkschrift vom 29. Dezember 1710 auf die Initiative des Kronprinzen zurückging, in seinem Sinne war sie aber allemal. Zur Abstellung der »entstandenen Confusiones« wurde gefordert, dass »die sich findende Schulden von Unser HoffCammer nach und nach abgeführet …, die unnötige Bediente abgeschaffet« und »die Taaffeln bey Unserm Hofe aufgezeichnet« werden.4 In jener Zeit liegt auch der Beginn der engen, wenngleich nicht konfliktfreien Beziehung zu Friedrich Wilhelm von Grumbkow. Zunächst nahm der junge König einen »Kassensturz« vor und ließ sich die Etats der einzelnen Kassen vorlegen. Über die Reduktionen im Etat des Hofstaates und die daraus folgenden Veränderungen ist bereits berichtet worden. Darüber hinaus forcierte Friedrich Wilhelm I. aber auch eine gewisse Vereinheitlichung jener Institutionen, die für die Akquirierung der Finanzmittel verantwortlich waren. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang noch einmal auf den Zusammenschluss des Generaldirektoriums und der Geheimen Hofkammer zum Generalfinanzdirektorium, das im Berliner Schloss seinen Sitz hatte, schon einen Monat nach dem Thronwechsel.5
Auch im Zuge der 1722/23 erfolgten Bildung des General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen-Direktoriums kam es zu Synergieeffekten, da dabei die bislang getrennten Kassen der beiden Behörden zusammengelegt wurden. Als besonders scharfer Schnitt dürfte sich aber die Auflösung der Schatullverwaltung erwiesen haben. Bislang galt die Schatulle als Hauptquelle für die während der Regierungszeit Friedrichs I. immer stärker in die Kritik geratene Finanzierung des königlichen Hofes. Die »Schatullgüter«, aus deren Bewirtschaftung ein großer Teil der Gelder für diesen Etat flossen, wurden in den nächsten Jahren mit den Domänen vereinigt, und es wurde in ihrer Verwaltung kein Unterschied mehr gemacht.6 Hier galten fortan dieselben Grundsätze der Bewirtschaftung und Rechnungslegung wie bei den Domänengütern. Im »Schatullamt Potsdam«, um nur ein Beispiel anzuführen, stand den Einnahmen im Haushaltsjahr 1716/17 in Höhe von 12.875 Talern die Summe von 6.278 Talern als Ausgabe gegenüber. Der erwirtschaftete Überschuss von 6.597 Talern fiel vergleichsweise gering aus, wurde aber mit fallenden Kornpreisen und Mehrausgaben wegen höherer Baukosten begründet: »… weil die Gelder bereits guten theils verbauet sind«.7
Diese Veränderungen bedeuteten jedoch nicht, dass nunmehr asketische Verhältnisse im Hause Hohenzollern eingezogen wären, auch wenn das verschiedentlich suggeriert wurde. Es ist ja bereits erwähnt worden, dass selbst nach 1713 ein höfisches Leben in der preußischen Residenz existierte und für diese Anforderungen sehr wohl ein, obzwar nunmehr bescheidener, ostentativer Aufwand betrieben wurde. Für die Bedürfnisse des Königs, der königlichen Familie und des verbliebenen Hofstaates waren auch jetzt genügend finanzielle Quellen vorhanden. Die die Einkünfte aus den Domänen verwaltende Domänenkasse hatte an den König ein jährliches »Handgeld« von 52.000 Talern für persönliche Ausgaben zu überweisen.8 Doch zeigt ein Blick auf die für mehrere Jahre überlieferten Akten der Hofstaatsverwaltung, dass es nicht bei jener Summe blieb. Erinnert sei an dieser Stelle noch einmal an die teilweise enormen Mittel, die der König für Ankäufe von Silberschmiedekunst für die Ausstattung des Berliner und Potsdamer Stadtschlosses einsetzte. Beispielsweise allein im dritten Quartal 1734 überwies die Domänenkasse an die Hofstaatskasse Beträge in Höhe von 52.214 Talern.9 Man wird hier also keine allzu starren finanziellen Transaktionen zwischen den einzelnen Kassen anzunehmen haben, vielmehr hat der König mitunter ad hoc entschieden. Zudem entspräche eine allzu strenge Unterscheidung zwischen den »privaten« Ausgaben des Monarchen und den im höfischen Alltag anfallenden »repräsentativen« Kosten nicht den zeitgenössischen Vorstellungen.
Diese auch im Ausland mit Überraschung und Verwunderung zur Kenntnis genommenen Veränderungen dienten aus der Sicht Friedrich Wilhelms I. einem mehrfachen Zweck: der Sanierung der aus dem Ruder gelaufenen Staatsfinanzen und der Akquirierung jener Mittel, die für den Heeresausbau benötigt wurden. Denn in der Tat rief es immer wieder Erstaunen hervor, dass »ein Land, welches keine Bergwerke für Edelmetalle besaß und eine Bevölkerung von kaum 2 ¼ Millionen Seelen barg, die Kosten eines so großen Kriegsstaates und noch obendrein Ueberschüsse aufzubringen vermochte«, die für die Schuldenabtragung, zum Ankauf von Domänen und für Investitionen in Festungs- und Zivilbauten ausgegeben werden konnten.10 Demzufolge wurde die rasche und – dies war dem König genauso wichtig – kontinuierliche Erhöhung der Einnahmen zu einem Hauptanliegen der Regierungsarbeit und von Friedrich Wilhelm I. auf eine sehr intensive Weise verinnerlicht. Schließlich handelte es sich noch um eine Zeit, in der bei den Verantwortlichen ein fast als haptisch zu bezeichnendes Verhältnis zum Staatsschatz existierte. Der König selbst ist wohl des Öfteren in die Kellergewölbe des Berliner Stadtschlosses hinabgestiegen und hat seinen Schatz persönlich in Augenschein genommen. Jedenfalls kannte er sich über die Standorte der in vielen Fässern eingelagerten Münzen gut aus, wie aus einigen detaillierten Anweisungen hervorging: So informierte er im Oktober 1733 seine Minister v. Borcke, v. Podewils und v. Thulemeier über seinen Willen, eine für karitative Zwecke vorgesehene Geldsumme »in das jenige Gewölbe zu setzen, welches hinter der Albrechtschen Casse auf dem Berlinschen Schlosse ist und darin man durch bemelter Casse gehet … und die Schlüßel zu diesem Gewölbe in meinen engelschen Spinde liegen«.11
Als Hauptquelle zur Steigerung der Staatseinnahmen diente dem König die Erweiterung des Domänenbesitzes, den er als die »sicherste Stütze seines Thrones«12 ansah – eine nicht ganz konfliktfrei verlaufende Strategie, waren hierbei doch zuweilen adlige Besitzinteressen berührt.13 In den ersten 20 Regierungsjahren gelang es, für etwa fünf Millionen Taler neue Domänen zu erwerben und zugleich die Einnahmen aus den Ämtern erheblich zu steigern.14 Seine Bemühungen richteten sich auch darauf, diese Erwerbungen vor künftigen Veräußerungen abzusichern. So erließ er im Februar 1737 anlässlich der Übertragung von Rheinsberg an den Kronprinzen eine Deklaration, »kraft welcher die Güter, welche des Cron-Printzen Königliche Hoheit anjetzo haben … zur Crone denen Königlichen Domainen auf ewig incorporirt werden«.15 Auch bei den klassischen Fiskaleinnahmen, also Kontribution, Akzise und Zöllen, konnten Zuwächse erzielt werden. Im letzteren Fall scheute Friedrich Wilhelm I. nicht vor diplomatischen Konflikten zurück, wenn man etwa die handelspolitischen Auseinandersetzungen mit Kursachsen im Blick hat.16 Dieser – nach den Worten Hugo Rachels – »offene Handelskrieg« wurde mit harten Bandagen geführt, was eben neben dem Einfuhrverbot auch eine hohe Besteuerung fremder Waren einschloss.17 Die Priorität, die der König auf die Vergrößerung seines Heeres gesetzt hatte, beeinflusste zwangsläufig auch die Ausgabenpolitik. Um die stetig steigenden Heereskosten – diese beliefen sich am Ende seiner Regierungszeit auf etwa 70 Prozent der Gesamtausgaben – aufzubringen, gleichzeitig aber die Aufnahme der von ihm seinerzeit kritisch beurteilten Subsidien von anderen Staaten zu verhindern, reformierte er jene Einnahmequellen, auf denen die Heeresfinanzierung basierte. Dies betraf vor allem die bereits erwähnte Kontributionssteuer und die in den Städten als kombinierte Gewerbe- und Konsumtionssteuer eingezogene Akzise. Erst während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. kam jener unter dem Großen Kurfürsten eingeleitete Prozess zum Abschluss, der eine genaue Unterteilung der zur Akziseeintreibung verpflichteten Orte vornahm. Damit erhielt der König zugleich auf jene kleinen Kommunen einen größeren Zugriff, deren Bürgerschaften zuvörderst ihren adligen Stadtherrn als Obrigkeit betrachteten.18 Wenn auch nicht als generelle Neuerung, so dürfen die Festsetzung von jährlichen Haushaltsetats und eine regelmäßige Rechnungskontrolle doch als nachhaltigste Veränderungen der Finanzpolitik unter seiner Ägide angesehen werden.19