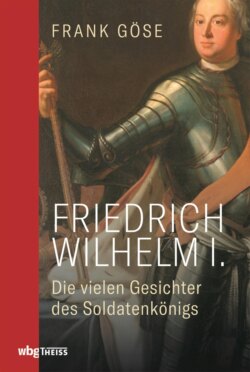Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 31
Ein »allgegenwärtiger« König168?
ОглавлениеEs ist durchaus zutreffend und wird durch die quellenmäßige Überlieferung bestätigt, dass Friedrich Wilhelm I. einen direkten persönlichen Anteil am Verwaltungshandeln nahm und sowohl auf wichtige Veränderungen als auch auf die alltägliche Praxis Einfluss ausübte, jedenfalls in wesentlich höherem Maße als alle seine Vorgänger. Jedoch darf das durchaus außerordentlich große Engagement nicht den Blick dafür verschließen, dass die preußische Verwaltung nicht von jenen mitunter eine kontraproduktive Wirkung entfaltenden Entwicklungen verschont wurde, die allenthalben der frühmodernen Bürokratie eigen waren. Auch die preußische Verwaltung der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war schließlich durch jene Merkmale charakterisiert, die typisch waren für das Ancien Régime. Dabei geht es nicht darum, die kaum zu bestreitende Arbeitsleistung des Königs auf diesem Feld zu schmälern, sondern deutlich zu machen, wie weit überhaupt der politische Spielraum eines Herrschers im 18. Jahrhundert bemessen war. Wird nämlich die Frage aufgeworfen, warum viele der Vorstellungen Friedrich Wilhelms I. nur halbherzig oder gar nicht umgesetzt werden konnten, stößt man bald auf ein Amalgam aus strukturellen und individuellen Grenzen, auf die seine Vorhaben treffen mussten.
Zunächst gilt es, sich vor Augen zu halten, dass die Veränderungen in der Verwaltung mit jenen Amtsträgern durchgeführt werden mussten, die zumeist schon lange in den Behörden tätig waren. Außerdem brachten die Reformen natürlich nicht sofort Beamte neuen Typs, gleichsam als »deus ex machina«, hervor. Der König wusste um diese Unzulänglichkeiten, auch wenn er seine mitunter idealisierten Vorstellungen einer Amtsführung nach seinem Gusto einforderte. Die Eigenverantwortung blieb groß; schon bei der internen Organisation der Kriegs- und Domänenkammern hatten die Räte die Departementeinteilung selbst vorzunehmen und diese Entwürfe dem König vorzulegen. Die Rücksichtnahmen auf die Interessen der aus den beiden bislang häufig konkurrierenden Behörden stammenden Räte hatten Friedrich Wilhelm I. offenbar dazu bewogen, die bisherigen Chefs der Kammer- und Kommissariatsverwaltungen in den meisten Provinzen zu gleichberechtigten Präsidenten in den neuen Kriegs- und Domänenkammern zu berufen – eine Konstruktion, die indes bald wieder abgeschafft wurde.169
Durch das nun immer stärker zur Geltung kommende »Kollegialitätsprinzip« wurde zum einen die gegenseitige Kontrolle der für das jeweilige Ressort gemeinsam zuständigen Räte bzw. Minister erreicht, zum anderen wurde damit die Stellung des Monarchen gestärkt, »denn es machte es für einzelne Beamte schwer, ein Ressort selbständig zu beherrschen«.170 Auch dem König scheint dieses Organisationsprinzip mehr gelegen zu haben. Dennoch konnte es durchaus vorkommen, dass in einigen Behörden einzelne Minister eine dominierende Stellung einnahmen, auch wenn ihnen formal andere Kollegen beigeordnet waren. Über die dominierende Rolle v. Ilgens im »Kabinetts-Ministerium« wie die zeitweilig herausgehobene Position v. Grumbkows ist schon berichtet worden. Zudem war dem König aus arbeitsökonomischen Erwägungen daran gelegen, dass einer der Minister ihm Vortrag hielt, als Ansprechpartner für seine Wünsche und Anordnungen galt und zur Gegenzeichnung der königlichen Erlasse zur Verfügung stand.171
Ein in den Augen des Königs weiter bestehendes Ärgernis wollte diese Reform nach Möglichkeit beseitigen oder zumindest minimieren: Das von den Ständen immer wieder eingeforderte Indigenat sollte bei der Besetzung von Ämtern in den Provinzen außer Kraft gesetzt werden.172 Gerade in den erst später in den Gesamtstaat integrierten Landesteilen hatte es oftmals enge Verbindungen zwischen der ständischen und der Kommissariatsverwaltung gegeben.173 Nunmehr sollten im Zuge der Reform Rücksichtnahmen auf die Interessen der regionalen Eliten möglichst eingeschränkt werden – ein Vorhaben, das zumindest zum Teil umgesetzt werden konnte. Geplant war, dass zum Beispiel die in den Kriegs- und Domänenkammern angestellten Räte alle drei Jahre in eine andere Provinz versetzt werden sollten.174 Dies ist jedoch nur teilweise verwirklicht worden. Letztlich hatte die Besetzung der Chargen »mit optimal qualifizierten Beamten … gegenüber dem abstrakten Motiv einer überregionalen Durchmischung der Beamtenschaft deutlich den Vorrang«.175
Trotz der nach wie vor von Sparsamkeitsgrundsätzen geprägten Finanzpolitik wuchs die Zahl der Amtsträger während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. weiter an. Auch er konnte sich nicht der Eigendynamik des Ausbaus von Verwaltungsapparaten entziehen. Um eine höhere Effizienz zu erreichen und mehr Einnahmen zu erzielen, wurde wiederum eine Ausweitung des Verwaltungsapparates nötig. Dieses aus historisch-soziologischer Perspektive beschriebene Gesetz vom »Wachstum der Staatsgewalt« konnte mitunter recht fühlbar werden. So war schon nach zehnjähriger Wirksamkeit des Generaldirektoriums »der Raum zu den Acta bereits ziemlich enge«, so dass sich Erweiterungen erforderlich machten.176 Die Anstöße dazu kamen nicht selten von den Amtsträgern selbst bzw. wurden in einer Art »Aushandlungsprozess« zwischen den Behörden auf den verschiedenen Verwaltungsebenen und dem König entwickelt. Hierfür nur ein anschauliches Beispiel: Da Friedrich Wilhelm I. stets danach trachtete, genaue personelle Verantwortlichkeiten in den Behörden festzumachen, also »wer, wann bey einem oder andern Ambt … daran schuldig, und welcher hingegen in allen Stücken seiner Pflicht ein Genügen thue«, lag es für die Betroffenen nahe, diesen Anspruch auch selbst in den internen Verwaltungsabläufen umzusetzen. So gab die Mindische Kriegs- und Domänenkammer in ihrem Bericht vom 11. August 1723 zu bedenken, dass das bisherige Reglement »gar zu general eingerichtet« war. Man wünsche, dass »selbiges zu Obtinirung guter Ordnung … etwas specieller verfaßet, mithin einem jedem membro sein besonders departement angewiesen werden müße«.177 Dem wurde Folge geleistet, so dass innerhalb der nächsten beiden Jahre ein Prozedere entwickelt wurde, nach dem jedem Rat ein bestimmtes Fachressort zugeordnet wurde.
Ein für die preußische Geschichte außerordentlich wichtiges Strukturmerkmal hat auch die Verwaltungspraxis während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. ganz entscheidend beeinflusst, worauf verschiedentlich schon hingewiesen worden ist: Immer wieder wurde der König mit den regionalen Eigenheiten seiner Lande konfrontiert. Während seiner Regierungszeit konnte es nicht um eine rigide Nivellierung der regionalen Traditionen, nicht um »eine schematische Gleichmacherei« gehen, vielmehr bildete auch in dieser Phase des preußischen Staatsbildungsprozesses »das Bemühen um einen Ausgleich zwischen den allgemeinen Staatsnotwendigkeiten und der Schonung der speziellen Eigentümlichkeiten« den Grundzug der Entwicklung.178 Die immer wieder gern zitierten und sehr differenzierten Einschätzungen über die Effizienz der einzelnen Provinzverwaltungen und ihrer Amtsträger erscheinen ja nicht nur als unterhaltsame Lektüre über die sehr eigenwillige Art der königlichen Menschenführung, sondern sie können auch gelesen werden als Beleg für den großen Einfluss regionaler Traditionen und Identitäten auf das Verwaltungshandeln. Die Amtsträger in Ostpreußen (»sein so viel schelm und diebe«179) und Kleve-Mark kamen dabei in der Regel schlecht weg.180 Des Königs abfällige Meinung zu der zuletzt genannten Provinz kam pointiert auch in einer Antwort an den Minister v. Görne zum Ausdruck: Er beschied ihm anlässlich der Besetzung einer Charge: »… ist es ein Dumer Deuffel sollen Ihn in die klevische Regi[erung zum] Raht machen Dazu ist er guht genug«.181 Solchen Äußerungen liegen zumeist konkrete Einzelerfahrungen zugrunde, die der König im Verwaltungsalltag gesammelt hatte. Nicht so sehr die variierende Professionalität der Amtsträger in den Landschaften, sondern vor allem der Grad der Resistenz der adligen Ständerepräsentanten gegen die von ihm gewollten Reformen bildete den Hintergrund für die unterschiedlich ausfallenden Einschätzungen. Dass die altmärkischen, magdeburgischen und halberstädtischen Landesteile mit besonders viel Kritik bedacht wurden und er ihnen das permanente »Ressoniren« sehr übel auslegte, war auf die unmittelbar vor der Abfassung der Instruktion an seinen Nachfolger geführten Auseinandersetzungen um die Lehnsallodifikation zurückzuführen.182
Dieses Bewusstsein für die Interessenlagen der landschaftlichen Führungsgruppen spiegelte sich auch in der bereits beschriebenen Struktur der 1722/23 neu geschaffenen Zentralbehörde, des Generaldirektoriums, wider, bei der regionale und fachliche Zuständigkeiten der einzelnen Ressorts nebeneinanderstanden. Zur Ambivalenz der im Zuge dieser Reform beabsichtigten Verbindung der Domänenverwaltung mit den Kommissariatsbehörden gehört natürlich auch, dass damit die den Kommissariaten vermeintlich inhärente Effizienz und Rigidität verblasste. Denn wie gezeigt wurde, kam es nun zu einer recht ausgewogenen Verbindung beider Behördenzweige, und die Amtsträger brachten jeweils ihre eigenen Traditionen und Mentalitäten in die neu geschaffenen Institutionen auf der zentralen und mittleren Ebene ein. Zudem waren im »Vergleich zu den Kommissariaten … die Kammern etabliertere Behörden und im Unterschied zu den ursprünglich wohl auch als Usurpation empfundenen Steuererhebungen entsprach ihre Funktion selbstverständlichem Herkommen«.183
Mit Blick auf die vom König mit so viel persönlicher Verve angegangene Reform der Kammerverwaltung mischte sich am Ende seiner Regierungszeit eine gewisse Resignation: In einer Ordre vom 28. August 1738 zog der König eine ernüchternde Bilanz über die seit 25 Jahren betriebenen Reformen in der Verwaltung. Dem Generaldirektorium machte er darin Vorhaltungen, dass es seine Kontrollfunktion gegenüber den Mittelbehörden – den Kriegs- und Domänenkammern – vernachlässigen und ihm Missstände verheimlichen würde.184
Jene Reibungsverluste, die durch die Zusammenlegung der Kommissariats- und Domänenverwaltung eigentlich eliminiert werden sollten, traten weiterhin auf, wenn auch nicht mehr in der Intensität und Häufigkeit wie vordem. Die Auseinandersetzung um die Zuständigkeiten bei der Organisation von Truppendurchmärschen bringt die noch nach über 20-jähriger Regierungszeit bestehenden Unklarheiten zum Ausdruck, zeigt aber auch einen gewissen Pragmatismus des Königs. Diesmal war es die Konkurrenz zwischen den Kriegs- und Domänenkammern und den Regierungen, die Klärungsbedarf erheischte. Bei den Durchzügen von Truppen auswärtiger Fürsten – in diesen Fällen marschierten Einheiten des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel durch halberstädtisches Territorium bzw. dänische Truppen durch das Fürstentum Minden – galten die Regierungen als die ersten Ansprechpartner. Ansonsten hatten aber die Kriegs- und Domänenkammern, in die ja die Kommissariate eingegangen waren, die »Marsch-Sachen« zu verantworten. Der Monarch reagierte auf eine Vorstellung des Problems ziemlich barsch: »Die Kriegs- und Domainen-Cammer soll es thun, die Regierung soll die Nase darin nicht stecken, oder sie wird sich sehr verbrennen.«185 Nun hatten aber seine mit den auswärtigen Angelegenheiten betrauten Kabinettsminister den König dezent darauf verwiesen, dass die bisherige Praxis schon einen tieferen Sinn habe. Schließlich sei es jeweils die Regierung, »welche S.K.M. höchste Persohn in den Provintzien repraesentiren«, und deshalb sei sie der vornehmliche Kontakt für andere Monarchen oder Fürsten. Friedrich Wilhelm I. zeigte sich halbwegs einsichtig und man einigte sich darauf, dass für die »Regulirung der Durch-Marche« zuvörderst die Kriegs- und Domänenkammern zuständig seien. Im Falle von Anfragen auswärtiger Fürsten bleibe es aber bei der bisherigen Praxis, wonach diese von den Regierungen entgegengenommen und an den König bzw. das Kabinettsministerium weitergeleitet werden müssten.186