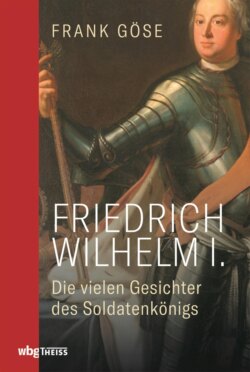Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Prompte Justiz«
ОглавлениеEine zusätzliche Chance zur Informationsbeschaffung bot des Weiteren die Möglichkeit der Untertanen, sich über Suppliken und Bittschriften direkt an den König zu wenden, um ihn zur Ausübung seines Gnadenrechts in ihrem Sinne zu bewegen. Diese Gesuche bieten einerseits für die Nachlebenden »Einblicke in die Lebensumstände und sozialen Nöte« der Supplikanten und stellten andererseits »für den Herrscher eine wichtige Informationsquelle dar«.58 Obgleich bislang im Gegensatz zur friderizianischen Zeit keine genau quantifizierenden Erhebungen über die Suppliken während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. vorgenommen worden sind, kann davon ausgegangen werden, dass Bittschriften einen beträchtlichen Teil des Verwaltungshandelns ausmachten und letztlich auch viele der bereits besprochenen Randverfügungen und Kabinettsordren Friedrich Wilhelms I. auslösten.
Die Kehrseite des Supplikenwesens bestand aber darin, dass damit Entscheidung und Urteil jener Institutionen, gegen die suppliziert wurde, im Erfolgsfalle revidiert und damit die Autorität dieser Behörden gemindert wurde. Deshalb richteten sich mehrere Edikte Friedrich Wilhelms I. wie schon seines Vorgängers »gegen das übermäßige Supplizieren«. Suppliken sollten also »erst nach Ausschöpfung der gerichtlichen Instanzen den Zentralbehörden respektive dem Monarchen übermittelt werden« dürfen.59 Dahinter stand das generelle Unbehagen des Monarchen über die in seinen Augen ohnehin viel zu schwerfällig arbeitenden Gerichte, die durch die Beschäftigung mit den Suppliken noch weiter von der ihnen zugedachten Aufgabe einer »prompten Justiz« abgehalten werden würden. So wurden beispielsweise in der Kabinettsordre vom 7. Februar 1731 die Etatminister angehalten, dafür zu sorgen, dass die Kriminalprozesse möglichst schleunig beendet würden. Da »die Collegia mit Membris überflüssig besetzet«, halte es der König »nicht nöthig, noch mehr anzunehmen«. Sollte eine zeitweilige Aufstockung des Kriminalkollegiums nötig sein, solle man Leute vom Kammergericht hinzuziehen.60 Zuvor war das Thema im Geheimen Rat diskutiert worden, und der mit dieser Materie befasste Rat v. Viebahn hatte schon in der Sitzung vom 22. Januar 1731 das Kriminalkollegium ermahnt, »ohne weiteren Verzug« die anstehenden Fälle zu behandeln und, »so offt es nöthig, sich extraordinaire zusammen zu thun, umb alles fertig machen und einsenden zu können«.61 Schon an diesem kleinen Ausschnitt des Gerichtswesens zeigt sich, dass die Justiz zu jenen Bereichen der Herrschaftspraxis mit einer vergleichsweise immer noch zu geringen Effizienz zählte.62 Dabei hat sich der König nach zeitgenössischem Urteil schon gleich nach seinem Regierungsantritt in besonderer Weise dieser Materie zugewandt: »Sonst sind S. K. Maj. bei Dero Regierung sehr fleissig und dictiren unzählbare Supplicata mit eigener Hand. Sie eifern absonderlich über schleunige und richtige Verwaltung der Gerechtigkeit und haben schon einen Anfang gemacht, die Processordnung am Kammergericht zu reformiren, wodurch die Rechtssachen merklich verkürzt werden sollen.«63 Doch die erhofften Resultate scheinen sich nicht in der vom König gewünschten Weise eingestellt zu haben. Zwar hatte Friedrich Wilhelm I. in einer Vielzahl seiner Verlautbarungen seinem Unmut darüber Ausdruck verliehen, dass »die schlimme Justiz zum Himmel schreit«, aber es ist nicht in dem von ihm erhofften Maß zu nachhaltigen Veränderungen gekommen. Daran war er allerdings selbst nicht ganz unschuldig. Eine Eingabe der für das Justizwesen verantwortlichen Minister machte im Jahre 1737, also in seinem 25. Regierungsjahr, auf erhebliche Mängel aufmerksam: Neben unqualifiziertem Personal wurden vor allem die »Überhäufung der wenigen tüchtigen Räte mit Arbeit …, [die] ganz unzureichenden Besoldungen und [das] Fehlen jeglicher Leistungsförderung« moniert.64
Über Ad-hoc-Entscheidungen versuchte der König bei den vielen ihm vorgelegten Einzelfällen die von ihm verfolgten Grundsätze zu verwirklichen und damit Vorbilder für die alltägliche Gerichtspraxis zu geben. Zwar mussten ihm alle auf »peinliche Strafen« lautenden Urteile vorgelegt werden, die er kraft seines oberstrichterlichen Amtes bestätigen oder abändern konnte. Jedoch mischte er sich nicht in die laufende Prozessführung ein und beschäftigte sich erst gar nicht mit den juristischen Details, die ihm ohnehin als ermüdende Quisquilien erschienen. Bei den ihm angezeigten Schwerverbrechen, wie im Falle eines Mörders, forderte er vom Präsidenten des Kammergerichts, dass »den Rechten nach wider ihn procediret« werde.65 Verbrechen an Leib und Leben wurden mit der Todesstrafe geahndet, hier hat Friedrich Wilhelm I. keine Abstriche gemacht: Wenn »einer Bluht vergißet es wieder vergoßen werden« müsse, lautete sein Credo.66 Auch Ansätze einer Humanisierung des Strafrechts, wie die Abmilderung des »Säckens« gegen Kindsmörderinnen, fehlten. Aber über die bereits angesprochenen Suppliken konnten Untertanen das Interesse des Königs für einen sie betreffenden Rechtsstreit auf dem Gebiet des Zivilrechts anregen.67 Daraus konnten dann Verfügungen des Königs folgen, die letztlich einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Justizwesen ausübten. So forderte er des Öfteren, dass Entscheidungen getroffen werden sollten, die den Prozessparteien »von Rechts wegen zukommen möchten«.68 Besonderen Wert – auch das spiegeln viele einzelne Entscheidungen wider – legte Friedrich Wilhelm I. auf eine Beschleunigung der Gerichtsverfahren, und er hasste Weitläufigkeiten. Die Gerichte sollten dazu angehalten werden, dass »alle Processe oder wenigstens alle Instantien in einem Jahre geendiget werden können« – ein aus verschiedenen Gründen äußerst ambitioniertes Ziel.69 So wies er das Berliner Kammergericht 1731 an, einem Barbier angesichts der »klaren Sprache« des Urteils »keine Appellation wider diese Sententz zuzulassen«.70 Und in der Angelegenheit des Kammerrates Schönholtz forderte er »prompte und unpartheiische Justitz zu administriren und nicht zu verstatten, daß die sache unverantwortlicher weise herum gezogen und aufgehalten werde«.71 Mit Samuel von Cocceji, der 1722 als Präsident des Kammergerichts eingesetzt worden war und 1737 zum »Ministre Chef de Justice« ernannt wurde, verfügte der König zudem über einen überaus fähigen und durchsetzungsstarken Juristen, der wenigstens versuchte, seine Vorstellungen in der Justiz umzusetzen.72 Auf der für den 27. Juni 1721 im ostpreußischen Königsberg anberaumten und im Beisein des Königs stattgefundenen Sitzung des Geheimen Rates hatte Cocceji eine ganze Reihe von Vorschlägen unterbreitet, mit denen man die von Friedrich Wilhelm I. monierten Mängel mittelfristig abzustellen hoffte. Dazu zählten neben Anregungen, die auf eine Effektivierung der Aktenversendung bei Instanzenzug hinausliefen, auch solche bei den Beteiligten kaum Begeisterung hervorrufende Empfehlungen wie die Einschränkung der Ferien bei den Gerichten oder dass die Gebühren an die Advokaten erst nach Beendigung der Prozesse ausgezahlt werden sollten.73 In der Tat wäre bei einer Umsetzung dieser Vorschläge nach einem Bericht des Herausgebers der »Berlinischen privilegirten Zeitung«, J.A. Rüdiger, das »lamentiren der Advocaten und Procuratoren … entsetzlich, indem die mehresten befürchten, umb ihr Brot zu kommen«.74
Erste Erfolge waren zur Freude des Königs durchaus bald zu gewärtigen: So seien am Ende des Jahres 1723 am Berliner Kammergericht nur noch 68 Prozesse mit einer Dauer von über einem Jahr anhängig gewesen, während dies im Vorjahr noch 171 gewesen seien.75 Dennoch schien der Weg der Reformen, wie die den König immer wieder erreichenden Informationen nahelegten, noch sehr lang zu sein, so dass er noch zu Beginn der 1720er Jahre glaubte, das Rechtswesen als in seinen Augen unerfüllte Agenda seinem Nachfolger als Vermächtnis hinterlassen zu müssen: »Was die Justiz in meinem Lande anlanget, habe alles angewendet, daß sie gerecht und kurz gefaßt sein sollte, aber leider habe nicht reussieret.«76 Am Ende der 1730er Jahre nahm jedoch die vor allem durch Samuel von Cocceji verantwortete Justizreform neue Fahrt auf und wurde mit einer bis dahin kaum gekannten Umsicht und Energie vorangetrieben. Im Sommer 1738 unternahm er ausgedehnte Visitationen der Gerichte und bereiste dazu die meisten Provinzen. Des Weiteren wurden die Präsidenten der Justizkollegien aufgefordert, nach dem Vorbild der schon seit Langem praktizierten Beurteilung der Offiziere jährliche »Conduitenlisten von den Räthen und Subalternen einzusenden«.77
In den von ihm unterbreiteten Vorschlägen mahnte Cocceji beim König aber auch ein größeres Vertrauen gegenüber seinen Ministern an – ein aufgrund des permanenten Argwohns Friedrich Wilhelms I. fast aussichtsloses Unterfangen.78 Zudem vermochte er zuweilen auch eigene Positionen gegen den König durchzusetzen79, insbesondere in Personalentscheidungen.80 Jedoch blieb die beabsichtigte Vereinheitlichung der Gerichtsverwaltungen und erst recht der verschiedenen Prozessordnungen in den Provinzen vorerst in Ansätzen stecken.81