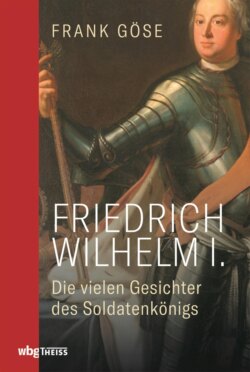Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 29
Vom Räsonieren und Gehorchen.
Der König und die Amtsträgerschaft
ОглавлениеSolche Äußerungen haben im populären Bewusstsein das Bild eines sich rigide und detailversessen in nahezu alle Angelegenheiten einmischenden und permanent über das Walten seiner Amtsträger unzufriedenen Königs entstehen und sich verfestigen lassen. Mit einer Mischung aus wohligem Erstaunen und Schaudern, mitunter verbunden mit dem auf das Treiben der langatmig arbeitenden Bürokratie heutiger Tage weisenden Zeigefinger, sind zumeist in den Publikationen populären Zuschnitts die Verlautbarungen des Monarchen zur Kenntnis genommen worden und ist genüsslich aus den vielen überlieferten Marginalien zitiert worden. Diese scheinen auf den ersten Blick durchaus die vom König geforderte Promptheit und Sachbezogenheit der Verwaltung zu bestätigen. Immer wieder begegnen darin Ablehnungen von finanziellen Zuschüssen (»ich hab kein geldt«91), Ermahnungen, nicht zu »räsonieren«, oder sein Anspruch, über die Besetzung von Ämtern – auch der subalternen – entscheiden zu wollen: »Keine Bedienung soll vergeben werden als die ich selber vergebe.«92 Dennoch gilt es dabei zu bedenken, dass diese Urteile keinesfalls einen repräsentativen Querschnitt bieten. Denn zumeist sind bislang jene Marginalien publiziert worden, die eine besonders derbe Diktion aufweisen und den »absoluten« Herrscher in seinem Element zeigen.93
Allerdings sind die vielen Quellen, in denen einerseits Unzuverlässigkeit und Trägheit kritisiert wurden und andererseits von den Behörden eine prompte Erfüllung der Aufgaben verlangt wurde, auch ein Spiegelbild dafür, dass eine bedenkliche Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffte. So kritisierte der König im Januar 1735 die des Öfteren fehlerhaften bzw. mit zeitlichem Verzug erfolgten Zahlungseingänge der Magdeburgischen Kriegs- und Domänenkammer an die General-Domänen-Kasse scharf und forderte den zuständigen Kammerpräsidenten v. Katte auf, künftig für prompte Zahlungen zu sorgen. Drohend ließ er sich vernehmen, dass den magdeburgischen Räten »zu erinnern [sei], daß in Magdeburg noch eine Citadelle vor ohnfleißige Bedienten sey«.94 Zudem war in seinen Augen die professionelle Amtsführung höchst verbesserungswürdig. Ebenfalls 1735 ließ er seinem Missfallen über das Policey-Wesen in den Städten der Mindener Provinz freien Lauf. Die Verantwortung sah er vornehmlich bei den Steuerräten, welche »ignorante oder betrügliche Leuthe seyn müssen«. Diese sollten deshalb »cassiret und tüchtige RegimentsQuartiermeister an deren Stelle vorgeschlagen werden«.95
Aus solchen Erfahrungen erklärt sich im Übrigen der gallige Ton seiner Instruktionen und manche verletzende Attitüde in seinen Randverfügungen. Hier ist immer wieder von »Narren«, »Kanallien«, »dummen deuffeln«, »Erzfickfackern« etc. die Rede, wenn er schlecht arbeitende Amtsträger bedachte. Seine Kreativität war unerschöpflich, nicht selten bediente er sich bei seinen Titulierungen an Vorbildern aus dem Tierreich. Der Verwaltungsalltag war indes weniger spektakulär, als dies so manche verkürzte Wiedergabe der in derbem Ton gehaltenen Marginalien suggerieren mag. Sicher ist es zutreffend, dass sich dieser König in weitaus umfangreicherem Maße in die verschiedenen Materien der Regierungspraxis eingearbeitet und demzufolge auch auf das Verwaltungshandeln Einfluss genommen hat. Über die verschiedenen Instrumente, die ihm zur Kontrolle der Behörden und ihrer Amtsträger zur Verfügung standen, ist bereits gehandelt worden. Das bedeutet jedoch nicht, dass er aus seiner fraglos anerkannten Spitzenstellung heraus allein schaltete und waltete, ungeachtet der daraus erwachsenden Folgen für Staat und Gesellschaft. Eine nähere Beschäftigung mit dem Verwaltungsalltag zeigt uns vielmehr einen sich zwar ständig um Informationen bemühenden, aber durchaus nicht beratungsresistenten und manchmal sogar recht geduldigen Landesherrn.
Sicher sind einige Neuansätze in der Besetzungspraxis der Ämterchargen zu beobachten, wie zum Beispiel ein vergleichsweise höherer Anteil an bürgerlichen Amtsträgern. Vor allem im engsten Machtzirkel, dem Kabinett, war die Favorisierung Bürgerlicher auffällig. Die Kabinettssekretäre Ehrenreich Bogislaw Creutz und Samuel Marschall96 sowie in späteren Regierungsjahren August Friedrich Boden, Elias Schumacher und August Friedrich Eichel stellen die prominentesten Beispiele dar.97 Auch wenn einige von ihnen in späteren Jahren geadelt wurden, bleibt die Bevorzugung Bürgerlicher als signifikantes Faktum bestehen. Für die besondere Vertrauensstellung dieser Amtsträgergruppe spricht zugleich, dass sie zuweilen für andere Aufgaben hinzugezogen wurden und offiziell auch andere Ämter ausfüllten. So wurde Creutz schon 1714 zum Generalkontrolleur aller königlichen Kassen, zum »referendair générale«, erhoben, und der Kabinettssekretär Boden amtierte zugleich als Geheimer Finanzrat im Generaldirektorium.98 Mitunter verhehlte der König indes nicht seine Vorbehalte gegenüber bürgerlichen Amtsträgern. Kraut sei zum Beispiel besonders auf seinen materiellen Vorteil bedacht, sei »wie der deuffell listig nach den gelde«. Deshalb empfahl er seinem Nachfolger, er müsse »das Auge aufhaben, das er euch nicht bedrige«.99
Hinter der Favorisierung von bürgerlichen Kandidaten wird man auch die – zumeist eher indirekt vom König artikulierte – Erwartung vermuten dürfen, dass die Amtsträger mehr der Ehre halber als wegen der Besoldung zu dienen hätten.100 Eine solche Haltung wurde auch dadurch befördert, dass es noch keine festen Besoldungsverhältnisse gab. Vielmehr war es üblich, dass ein Amtsträger während der ersten Jahre seiner Karriere »auf Exspektanz« diente, also unentgeltlich arbeitete. Dies war sicher vornehmlich auf die rigide Sparpolitik des Königs zurückzuführen, resultierte aber auch aus der lange üblichen Praxis, das Gehalt der Amtsträger in Naturalien auszuzahlen.101 Fast unisono klang es in den königlichen Anweisungen anlässlich der Bestallung von Amtsträgern an den für die Auszahlung der Gehälter zuständigen Geheimen Etatrat v. Creutz: »aber noch keine Besoldung« (1720 zur Bestallung des Geheimen Rates v. Rochow im Generalfinanzdirektorium) oder »Besoldung erst später« (1722 zur Berufung des Geheimen Finanzrats v. Börstel).102 Damit verbunden war auch eine uns in den persönlichen Entscheidungen des Königs begegnende Gefühllosigkeit und fehlende Empathie: So hatte ein Akzisebeamter einige höhere Offiziere des Unterschleifs bezichtigt, konnte seinen Vorwurf aber nicht ausreichend beweisen und wurde daraufhin entlassen. Ein anderthalb Jahre später an den Monarchen gerichtetes Gesuch, ihm wieder eine Anstellung zu verschaffen, wurde brüsk mit der eigenhändigen Resolution »Geh zum Teufel« abgewiesen. Der mittlerweile völlig verarmte Mann sah daraufhin keinen anderen Ausweg und erschoss sich. Der über den Vorfall berichtende v. Manteuffel kommentierte den Vorgang mit sarkastischen Worten: »Cela s’appelle, être exact à exécuter les ordres de son maitre.«103
Auch die eher an die vergangene Zeit erinnernde Praxis des Ämterkaufes erfreute sich nach 1713 erheblicher Beliebtheit. Diese vornehmlich auf fiskalischen Gewinn orientierte Personalpolitik – man denke hier vor allem an die »Rekrutenkasse« – hielt die Frage offen, ob der fachlich kompetenteste oder der zahlungskräftigste Kandidat das avisierte Amt bekam.104 Es solle derjenige die Stelle haben, »wer das meiste giebet«, hieß es so manches Mal.105 Zahlungen von ganzen Jahresgehältern in diese Kasse waren keine Seltenheit.106 Aus vielen Amtsträgerbiographien ist bekannt, wie lange und teuer eine Ausbildung sein konnte, insbesondere wenn sie ein Studium einschloss. Selbst wenn im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildungsphase ein Subalternposten in der Verwaltung erlangt werden konnte, bedeutete das nicht von vornherein, mit einem sicheren Einkommen rechnen zu dürfen. Vielmehr war davon auszugehen, eine geraume Zeit ohne Besoldung arbeiten zu müssen. Der spätere Justizminister Levin Friedrich II. von Bismarck (1703–1774) erhielt nach eigener Aussage erst elf Jahre nach dem Beginn seiner Amtsträgerlaufbahn eine Besoldung als neumärkischer Vizekanzler.107 Die Gehälter selbst waren dann auch eher kärglich bemessen, so dass nicht selten die Familie des jungen Amtsträgers noch etwas zuschießen musste.108 Klagen über zu geringe Besoldungen begegnen uns über die gesamte Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. Schon im ersten Regierungsjahr machte das Hinterpommersche Oberkommissariat darauf aufmerksam, dass mit der zur Verfügung stehenden Geldsumme nicht noch eine weitere Charge in dieser Behörde geschaffen werden könne, weil den bereits dort tätigen Amtsträgern »am Gehalt nicht wohl etwas abgezogen und einem neuen Subjecto beigeleget werden kann, wo sie nicht crepiren sollten«.109
Es ist bereits darauf aufmerksam gemacht worden, dass Friedrich Wilhelm I. gleich zu Beginn seiner Regierungszeit erhebliche Kürzungen in den Besoldungen vornahm. Über die Klagen darüber berichtete der kaiserliche Gesandte, v. Schönborn-Buchheim, recht ausführlich nach Wien. Dies mutete den Diplomaten deshalb mitteilenswert an, weil von den zum Teil drastischen Gehaltsreduktionen auch eine Reihe von Ministern und anderen hohen Amtsträgern betroffen war, so dass es »ohnmöglich ist, darbey subsistiren zu können«. Selbst mit dem Fürsten von Anhalt sei das geschehen, »worüber auch dieser sehr mißvergnügt seyn solle«.110 Aus dieser Unzufriedenheit könnten sich Spannungen innerhalb der politischen Führungsgruppe in der preußischen Residenz entwickeln, die sukzessive Gefahr liefen, zu einer instabilen Situation zu führen. Zugleich schienen die finanziell knapp gehaltenen Minister und Räte damit empfänglicher für mögliche Offerten der europäischen Mächte zu werden.
Die Neigung Friedrich Wilhelms I., die Gehälter für die Amtsträger einzufrieren, »nahm mit den Jahren zu«.111 Bittgesuche auf Gehaltszulagen oder eine Versorgung mit Ämtern fanden ohnehin nur selten Gehör. Allzu nachdrücklich auf eine Erhöhung der Besoldungen drängende Supplikanten sahen sich zudem der Gefahr königlicher Ungnade ausgesetzt. Wer »von Neue tractamenten spricht den halte ich vor ein hundspfot«, ließ der König auf ein solches Gesuch antworten.112 Friedrich Wilhelm konnte auch deshalb die Besoldungen auf einem niedrigen Niveau halten, weil er angesichts vieler Gesuche um eine Anstellung in subalternen Chargen davon ausging, dass es genügend Bewerber gab. So gewinnt die zynisch klingende Kabinettsordre des Monarchen anlässlich einer Anfrage des Generaldirektoriums eine gewisse Schlüssigkeit: Wer »nicht zufrieden seyn will, was er bekömt, seine Dimmission bekommen kann, maßen Sie 200 andere Subjecta davor wiederbekommen können, wenn Sie es verlangten«.113 Jedoch konnte eine allzu drastische Sparpolitik dazu führen, dass sich das Reservoir fähiger Kandidaten für eine Charge verringerte. Dies gestand sich Friedrich Wilhelm I. zuweilen auch selbst ein, als er etwa das Generaldirektorium 1730 aufforderte, sich angesichts der Überalterung und der Invalidität etlicher Minister »um geschickte Köpfe umzuthun, wodurch der bisherige Abgang mit capablen Leuten … wieder ersetzt werde«.114 Doch mit zunehmendem Alter traten solche Bedenken gegenüber den fiskalischen Erwägungen bei Friedrich Wilhelm I. offenbar zurück. Als der König im Herbst 1737 von den Ministern des Generaldirektoriums im Zuge der Schaffung der Stelle eines Justizministers Personalvorschläge verlangte, gab Friedrich Wilhelm von Grumbkow zu bedenken, dass »ein Mann, der den Character als Minister führte, an einem so teuren Ort wie Berlin, wenigstens 6000 Rtlr. haben müsse, wenn er ein wenig figuriren wolle«.115 Im Zusammenhang mit einer fälligen Neubesetzung der Stelle des Konsistorialpräsidenten wagte sich v. Grumbkow mit seiner Kritik am König ziemlich weit vor, wenn er äußerte, dass sich fremde Personen »wohl nicht finden [dürften], die mit einem geringen Salario sich hier ruiniren wollen, sondern es wirt nun doch S. M. müsen hierin mal thun auch [so] wie die kleine Fursten Ihre ministros bezahlen«.116
Man muss allerdings bedenken, dass sich zur damaligen Zeit – und dies weit über Preußen hinaus – das Verständnis einer leistungsbezogenen Besoldung noch nicht durchgesetzt hatte.117 So entsprach es auch gängigen Erwartungen, dass die zum Hofstaat gehörenden »Bemittelten von Adel … von dem Ihrigen fünf- oder sechsmal so viel, als sie empfangen, zusetzen« sollen.118 Die im Ganzen eher ungünstigen finanziellen Rahmenbedingungen blieben zwangsläufig nicht ohne Auswirkungen. Finanzielle Abhängigkeiten und das Trachten nach zusätzlichen Einnahmequellen mussten der Idealvorstellung eines in völliger Loyalität dem Monarchen ergebenen Amtsträgers im Wege stehen. Somit blieben auch Friedrich Wilhelm I. nicht jene ernüchternden Erfahrungen erspart, die selbst unter seinem berühmten Sohn und Nachfolger an der Tagesordnung waren.119 Unterschlagungen ließen sich einzelne Amtsträger nach wie vor zu Schulden kommen. Die überlieferten Klagen des Königs bis hin zu seinen verbalen Wutausbrüchen resultierten ja gerade aus diesen oftmals noch fragilen, unfertigen Verwaltungsstrukturen.
Zudem ist das Agieren Friedrich Wilhelms I. entgegen dem oft kolportierten Bild nicht auf das rigide Einfordern der von ihm gewünschten Amtsauffassung zu beschränken. Neben diesen allseits bekannten in drastischem Ton gehaltenen Instruktionen, Kabinettsordren und Marginalien sind Quellen überliefert, die sowohl von einer gewissen Konzilianz gegenüber seinen Amtsträgern als auch von erstaunlichem Langmut zeugen und belegen, dass sich der König durchaus nicht als so beratungsresistent erwies wie angenommen. Einige wenige Beispiele seien hierzu präsentiert: Im Kontext des 1718 eingeführten »Neuen Kammer-Reglements« wurde zwischen dem Generaldirektorium und den auf mittlerer Ebene wirkenden Amtskammern über die Visitation der Ämter verhandelt. Auch der König meldete sich zu Wort und erachtete es überraschenderweise nicht als notwendig, dass die Kammerpräsidenten die Ämter jährlich visitierten, »sondern es sey genug, wan solches, nachdem Er sich erst die Ämter recht bekandt gemacht, nur einmahl alle drey Jahr geschehe«.120 So hatte der kurmärkische Kammerpräsident v. Görne zu 18 der insgesamt 24 Punkte des neuen Amtskammerreglements von 1717 Bedenken vorgebracht. Dies wurde ihm aber keinesfalls als Insubordination oder Besserwisserei ausgelegt. Vielmehr sollte sich ein Amtsträger zu solchen Stellungnahmen »verpflichtet« fühlen, anderenfalls es »leichtsinnig gehandelt seyn würde, wenn Sie Bey solcher occasion … stillschweigen wollte[n]«.121 Auch die anderen um Statements gebetenen Amtskammerräte hielten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Der Kammerrat d’Arrest verband mit seinen Bedenken gar grundsätzliche Zweifel an einer der Absichten der Reform. Seiner Auffassung nach war das Prozedere viel zu starr und unflexibel gehalten. Nun sei es »aber nicht möglich, die administration der Wirthschafft an gewiße Regeln und gesetze zu binden, angesehen selbe von Jahr zu Jahr nach derselben frucht- oder unfruchtbarkeit geändert, mit verkauffung und aufschüttung des getreydes bald geeilet, bald wieder aufgehalten und solcher gestalt einigen Nutzen gesuchet werden muß«. Sein Kollege folgte ihm in dieser Argumentation und gab zu bedenken, dass »bey der LandtWirtschafft undt HaußHaltung man sich nicht an eine algemeine Instruction binden könne; sondern es muß ein guther undt getreuer Haußwirth sich nach Zeit, gewitter gelegenheit, Vorkommende Unglücks fälle undt andere Urstöße richten«.122
Die vom König zu Beginn der 1720er Jahre initiierte und vorangetriebene Reform der Spitzenbehörde des Gesamtstaates wurde ebenfalls nicht widerspruchslos hingenommen. Vielmehr stieß die von ihm mit so viel persönlichem Engagement verfolgte Verwaltungsreform, die zur Zusammenlegung der Kommissariatsbehörden mit der Kammerverwaltung führte, auf zahlreiche Bedenken der Amtsträgerschaft in den Provinzen. Angesichts der Vorbehalte gegenüber der Anweisung an die Regierung der Provinz (Ost-)Preußen vom 28. Januar 1723, die die Aufsicht über die Städtesachen der neu gebildeten Kriegs- und Domänenkammer übertrug, sah sich der König am 3. März 1723 zu einem erneuten Schreiben an die preußischen Regierungsbeamten veranlasst. Darin betonte er sich fast schon entschuldigend, dass »diese Verfassung … nicht aus Mißtrauen gegen euch wie ihr vermeinet gemacht worden sei, sondern weil in allen Unsern Landen und Provinzien alle Magistrate und Rathäusliche Sachen unter die Auffsicht der p. Kammern« gesetzt seien.123 Auch die Räte der neu gebildeten Pommerschen Kriegs- und Domänenkammer verwahrten sich in dem Schreiben, das dem König über die Einrichtung des neuen Kollegiums berichtete, gegen den Vorwurf, »als ob sie (die beiden Collegien) ihre Pflicht bisher nicht genügend gethan hätten«, und wurden nachfolgend beschwichtigt.124
Langmut bei der Umsetzung von Instruktionen und Verordnungen und die immer wieder in Verwaltungsstuben zu beobachtende Praxis des »Aussitzens« blieben auch im Preußen der 1720er und 1730er Jahre an der Tagesordnung. So zeigte sich der König im August 1735 sehr ungehalten über die nachlässige Durchführung einer vor anderthalb Jahren erlassenen Verordnung zur Wiederherstellung der in Unordnung geratenen Registratur in der Kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer und forderte einen Bericht, »warumb seit 19 Monathen und vielfältig befohlener maßen die Protocolla derer bey Ihrem Collegio vorgetragenen sachen nicht übergeben« worden seien.125 Als Gründe für diese Verzögerungen wurden fehlende Unterlagen und Personalprobleme genannt. Der Kammerpräsident von der Osten dämpfte in seinem Schreiben an den König die Aussicht auf eine rasche Abstellung der Mängel und gab zu bedenken, »daß wann die Secretarii, welche in Domainen-, Forst-, Zoll-, und Justitz-Sachen expediren nach der bisherigen Verfassung mit der ihnen auf gelegten Arbeith forttfahren und dabey nichts verabsäumen sollen, sie woll die Protokolla von denen expedirten Sachen schwehrlich prompt verfertigen und übergeben können«.126
Recht selbstbewusst trat der Präsident der Mindischen Kriegs- und Domänenkammer und spätere Minister im Generaldirektorium, Friedrich Wilhelm von Borcke, gegenüber der ihm vorgesetzten Behörde auf. Er hatte sich im Oktober 1736 kritisch gegen die in seinen Augen zu rigide praktizierte Arbeit der Kommissionen gegenüber den Domänenpächtern gewandt und zu bedenken gegeben, »daß, wann mit denen Beamten also wie bisher geschehen noch ferner umgegangen werden wird, ich in alle Wege befahre, daß die Generalpacht mit der Zeit übern Haufen gehen, die Unterthanen irre gemachet, dem Kammer-Collegio seine Autorität genommen und alles in die äußerste Confusion gerissen werde«. In der folgenden Zeit lieferten sich v. Borcke und das Generaldirektorium einen verbalen Schlagabtausch, in dem Letzteres auf der Kommissionsarbeit bestand, »deren Nothwendigkeit und Nutzen gezeiget« worden sei, während der Kammerpräsident auf seiner Meinung beharrte, dass Kommissionen »nur große und schwere Kosten« verursachten, während man »von gutem Erfolge« nur wenig höre.127
In diesen Verhaltensweisen scheinen offenbar recht weitreichende Spielräume der Amtsträger auf den verschiedenen Verwaltungsebenen durch. Und tatsächlich wäre eine Vorstellung verfehlt, die in dem Agieren der Behörden während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. nur ein hohes Maß an Hierarchisierung und Bürokratisierung im Sinne des von oben nach unten weitgehend ohne Reibungsverluste durchgedrückten herrschaftlichen Willens erblicken würde. Widerspruch gegenüber königlichen Entscheidungen wurde durchaus gewagt, sogar in dem hochsensiblen Bereich der Personalpolitik des Königs. Als dieser zum Beispiel zu Beginn des Jahres 1738 befohlen hatte, die in seinen Augen ungeeigneten Steuerräte Lütckens und Wittich von der Kurmark nach Pommern zu versetzen, sah sich das Generaldirektorium veranlasst, darauf hinzuweisen, »wie nach des Chef-Präsident von Osten Bericht der Wittich einer der besten Kurmärkischen Steuerräthe sei und hier nicht gar wohl zu missen stehe«.128 Die beachtliche Eigenständigkeit, die Behördenmitarbeiter an den Tag legten, spiegelte sich auch in internen Auseinandersetzungen wider, so dass sich die Minister im Generaldirektorium oder die Präsidenten der Kriegs- und Domänenkammern veranlasst sahen, »den König um Unterstützung zu bitten gegen Räte, die in ihren Augen pflichtvergessen waren, unbotmäßig oder ihnen gegenüber eine feindselige Haltung an den Tag legten«.129 So herrsche etwa in der Litauischen Kammer »keine Subordination«, ließ sich Minister Friedrich von Görne 1727 resignativ vernehmen.130 Auch die dem König bekannt gewordenen und schon an anderer Stelle angesprochenen Verhältnisse in der Hinterpommerschen Kriegs- und Domänenkammer deuteten offensichtlich auf eine fehlende Autorität des dortigen Präsidenten hin. Hier sah sich deshalb Friedrich Wilhelm I. am 1. Juni 1728 zum Einschreiten veranlasst und wies das Generaldirektorium an, auf Abstellung der beanstandeten Missstände zu drängen.131 Somit bestätigt die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. eine übergreifende Beobachtung für die Verwaltungspraxis im Ancien Régime, wonach die »Verwaltungsreformen des ›absolutistischen‹ Staates in der Regel eng mit einem Amtsträger, der die Angelegenheiten federführend betrieb, verbunden« waren.132
Die Amtsträger waren eben, so lässt sich aus diesen, durchaus noch zu vermehrenden Exempeln resümieren, keine willenlosen Befehlsvollstrecker, die ständig in Angst vor dem nächsten königlichen Zornesausbruch oder der Androhung seiner Ungnade lebten. Zwar sei in den letzten Regierungsjahren des Königs bei der jüngeren Generation der Amtsträgerschaft der Widerspruchsgeist zurückgegangen. So äußerte sich der kursächsische Gesandte am Berliner Hof, Graf v. Manteuffel, recht despektierlich über die Personen, die sich vom König alles bieten ließen, »ohne daß sie böse werden«. In dem Zusammenhang gab er eine angeblich von Friedrich Wilhelm I. getane Äußerung wieder: »die müssen ohne Räsonniren alles thun, was ich haben will.«133 Überbewertet sollten solche Einschätzungen indes nicht werden, vor allem wenn man auf die weiteren Entwicklungen in der preußischen Amtsträgerschaft schaut. Jene bekannte Äußerung eines hellsichtigen Zeitgenossen aus der spätfriderizianischen Zeit ließe sich durchaus, obschon vielleicht nicht repräsentativ, auf die Amtsträgerschaft Friedrich Wilhelms I. übertragen: »In der Tat, die Minister sind nicht bloß expedierende Sekretäre des Königs …; sie sind bei weitem mehr – und dies unbeschadet der unbezweifelten Selbstherrschaft Friedrichs.«134 Die mit »Männerstolz vor Königsthron« umschriebene Haltung begegnet uns auch bei Friedrich Wilhelm I. immer wieder einmal. So schrieb der König sichtlich konsterniert am 13. Juli 1719 an Fürst Leopold, dass die zwei subalternen Amtsträger »Lehmann [und] Bube mir in die augen gesaget, sie wehren mir feindt«. Sie hatten sich darüber beschwert, dass der Monarch »alle beste dinster [Dienste – F.G.] soldahten gehbe und ich keine gelerte estimirte«.135
Friedrich Wilhelm I. räumte zudem auch von seiner Seite den Amtsträgern einen gewissen Spielraum ein, wenn sie die gewünschten Effekte in ihrem Verantwortungsbereich garantierten. So bot der König dem von ihm offensichtlich geschätzten ehemaligen Gramzower Amtmann Bartholdi 1731 an, eine Amtspacht in Preußen zu übernehmen, jener Provinz, an deren Förderung Friedrich Wilhelm bekanntlich viel lag. Bartholdi zeigte sich daran nicht interessiert, bekundete aber seine Bereitschaft, in diese Provinz zu reisen, wenn »ihm die Ämter-Commissarien-Bedienung in der Uckermarck, so jetzt vacant, conferiert werden« würde. Der König ging auf den Vorschlag ein, beförderte Bartholdi zum Kommissionsrat und schickte ihn nach Preußen, damit »er das land daselbst kennen lernet, und wenn er ja nicht selbst zur Pachtung zu bewegen, daß er ander gute Pächter aus der Uckermarck, und wo er sonst bekannt ist, nach Preußen verschaffet«.136 Ebenso standen dem Bild des polternden und seine Amtsträger mit derben Kraftausdrücken beleidigenden Monarchen Äußerungen gegenüber, in denen er nicht mit Anerkennung sparte. Seinen Etatminister v. Borcke ließ er im Oktober 1731 wissen, dass er »gern ersehe«, wie er »die Renteien in Richtig und Ordnung zu setzen beschäftiget« sei.137