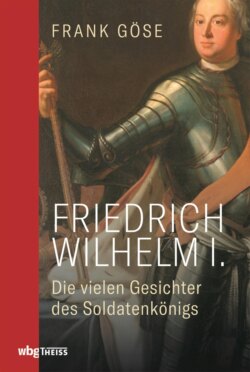Читать книгу Friedrich Wilhelm I. - Frank Göse - Страница 32
Die Wahrnehmung des Königs durch die Untertanen
ОглавлениеDoch soll hier vornehmlich keine institutionelle Verwaltungsgeschichte betrieben werden, zumal gewiss kein Mangel an solchen Darstellungen besteht. Hingegen wurde die Frage, wie das Verwaltungshandeln bei den Adressaten wahrgenommen wurde, allenfalls beiläufig gestellt. Lange Zeit obwaltete eine sehr zurückhaltende Position, die das »Volk« in Stadt und Land in einer eher passiven, wenn nicht gar lethargischen Rolle sehen wollte. Im zeitgenössischen Verständnis der aristokratischen und bürgerlichen Oberschichten galt diese Mehrheit der Bevölkerung schlichtweg als »Pöbel«, den »die mangelnde Vernunft, die zu große Neigung zum affektbestimmten Handeln und die leichte Verführbarkeit durch den äußeren Schein« als anthropologische Grundkonstanten auszeichneten.187 Erst recht erfolgten solche Zuschreibungen für jene einen großen Teil des preußischen Staatsterritoriums umfassenden Gebiete, die dem Typus der »ostelbischen Gutsherrschaft« zugeordnet worden sind. Hier schien jene »Untertanen«-Mentalität in besonderer Weise entwickelt und jegliches Potential zu politischer Partizipation und Widerständigkeit verkümmert. Dies korrespondierte im Übrigen mit einer äußerst gering eingeschätzten Alphabetisierung als einer wichtigen Voraussetzung eigenständiger geistiger Reflexion: »Das Gedruckte, diese Realität aus zweiter Hand, ist dem Landmann völlig fremd«, lautet ein solches pointiertes Urteil.188 Solcherlei Zuschreibungen sind durch die sozial- und mentalitätsgeschichtlich arbeitende Forschung der letzten Jahrzehnte zumindest teilweise revidiert worden. Vornehmlich mikrohistorisch angelegte Studien konnten widerlegen, dass es in den ostelbischen Landschaften der preußischen Monarchie angeblich keine »Tradition von Aufmüpfigkeit und Protest« gegeben habe und »die Bauern relativ früh entmündigt« worden seien.189 Vielmehr waren die Verhältnisse eben nicht nur durch einen scharf polarisierenden Gegensatz zwischen einem scheinbar omnipotent waltenden Gutsherrn und den ihrem Schicksal lethargisch ergebenen bäuerlichen Hintersassen geprägt, denen zudem für die Vertretung ihrer Interessen eine erstaunlich lebendige Dorfgemeinde zur Verfügung stand.190 Die Funktion als Patrimonialgerichtsherr band zum Beispiel die Gutsherren auch in die allenthalben zu beobachtenden Verrechtlichungstendenzen der frühneuzeitlichen Jahrhunderte ein, führte also zu Lernprozessen auf beiden Seiten. Denn die Gerichtsbefugnis schloss die »Gerichtspflicht« mit ein, und diese wurde von den Untertanen »wenn nötig sehr massiv abverlangt«.191
Die Gesetzessammlungen künden in überaus großer Zahl vom Reglementierungs- und Ordnungswillen der Landesherrschaft. Wir haben es hier aber beileibe nicht mit einer neuen Qualität administrativer Handlungen zu tun. Es setzte sich vielmehr eine Entwicklung fort, die schon seit Langem zu beobachten gewesen war, zugegebenermaßen nach 1713 in Preußen eine neue Intensität erreichte. Ein Blick etwa in die für die Kur- und Neumark Brandenburg angelegte Gesetzessammlung offenbart die stete Vermehrung der erlassenen Mandate, Verordnungen und Edikte.192 In der Geschichtswissenschaft wurde für diesen sich im Verlauf der Frühen Neuzeit verdichtenden Prozess schon vor über einem halben Jahrhundert der Begriff der »Sozialdisziplinierung« eingeführt – ein Terminus, der in der Forschung nicht ganz unwidersprochen geblieben ist, gleichwohl aber die entscheidenden Intentionen dieser Bemühungen zu umschreiben vermag.193 Die Kritik hat sich vor allem darauf gerichtet, dass die zweifellos zu beobachtende Zunahme der administrativen Wirksamkeit nicht automatisch eine Zunahme der Sozialdisziplinierung implizieren könne. Landesherrliche Ordnungen hatten mitunter »nicht mehr zu bieten als allgemeine Appelle, die Arbeitenden mögen doch ›fleißig sein, fleißig helfen, fleißig Acht haben‹ usw.«194
Zwar können entsprechende Effekte im Sinne der unterstellten Normenimplementation kaum in Abrede gestellt werden, jedoch – und darauf deuten auch etliche Belege aus der preußischen Verwaltungspraxis während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. hin – war der Umgang der mit den normativen Vorgaben beglückten Adressaten mit selbigen »häufiger durch Mißachtung, Aushandlung, Instrumentalisierung, Variierung und ähnliche Handlungen geprägt«, so dass eine »umfassende Verhaltensbeeinflussung der Gesellschaft durch obrigkeitliche politische Programme« kaum nachgewiesen werden kann.195 Denn der aus vielen empirischen Studien gewonnene Befund spricht dafür, dass es auch der brandenburgisch-preußischen Landesherrschaft nicht gelang, »die Flut der ›Widersetzlichkeiten‹, wie es in der Quellensprache heißt, nachhaltig einzudämmen«.196 Den Untertanen bot sich ein breites Spektrum an widerständigem Verhalten, das von der gezielten Unterleistung bei Frondiensten über das Aussitzen und »Sich-dumm-Stellen« bis hin zu offenem Ungehorsam in Gestalt von Verbalinjurien oder offenem Gewaltexzess reichte.197
Der König wusste um diese in seinen Augen kritikwürdigen Verhältnisse dank des vergleichsweise effizient funktionierenden Berichtswesens, zwar nicht im Detail, aber durchaus in den Grundzügen. Auch dass die wiederholte Publizierung der Edikte und Verordnungen nicht den gewünschten Effekt erzielte, dürfte ihm bewusst gewesen sein. So lassen sich die wiederholten Missbilligungen an die Adresse einiger Prediger erklären, dass sie »nicht genugsamen Fleiß und Mühe anwenden, um ihren Zuhörern und Eingepfarreten die Liebe, Treue und Gehorsam, so sie Uns als ihrem Könige und höchsten souverainen Landesherrn zu erweisen und zu leisten verbunden sind, gehörig einzuschärfen«. Schließlich könne ohne solche Voraussetzungen »kein Staat bestehen«.198 Dringender Handlungsbedarf schien auf dem »platten lande« gegeben zu sein, weshalb Friedrich Wilhelm I. von seinem Minister v. Printzen forderte, darauf ein verstärktes Augenmerk zu legen. Seine Bedenken waren nicht unbegründet, denn schon vier Wochen später sah er sich zu einem weiteren geharnischten Erlass veranlasst, in dem er den zuständigen Amtsträgern vorhielt, dass »diese offenbare und höchst strafwürdige Vilipendirung Unserer emanirenden Befehle Uns nicht anders als zu äußerstem Mißvergnügen gereichen könne«. Ferner wolle er wissen, »woher es rühre, daß mehr angezogene Unsere Verordnung so spät und in einigen Ämtern noch gar nicht insinuiret« und die Pfarrer der Verordnung »nicht auf die vorgeschriebene Weise, sondern mit Nonchalance oder gar nicht« nachleben würden.199 Neben der uns nun schon mehrfach begegneten fehlenden Durchsetzung von landesherrlichen Gesetzen zeigt dieser Vorgang zugleich die Bedeutung, die den institutionellen und informellen Formen zukam, um überhaupt einen Zugang zu den Untertanen in Stadt und Land zu erhalten. Selbstverständlich wird man hier keine »modernen« Herrschaftsinstrumente zur Manipulierung anzunehmen haben, und erst recht erscheint es völlig abwegig, einen »absoluten« Herrscher des Spätbarocks mit diktatorischen Systemen des 20. Jahrhunderts gleichsetzen zu wollen.200 Dennoch erwiesen sich auch für die Herrschaftspraxis des 18. Jahrhunderts Vorkehrungen als hilfreich, die eine gewisse innere Stabilität garantierten. Angesichts des angesprochenen Konfliktpotentials in der altständischen Gesellschaft mögen Zweifel gegenüber der Ansicht eines zeitgenössischen Historiographen aufkommen, ob die vergleichsweise geringe personelle Ausstattung der Wache im und um das Potsdamer Schloss mit der festen Überzeugung des Königs erklärt werden könne, dass er sich »auf den Schutz derer Götter, wie auch auf die Treue des Volcks und derer Soldaten verlassen« könne.201 Gerade mit Blick auf die zuletzt genannte Gruppe war Misstrauen angeraten, und der König fühlte sich aufgrund unliebsamer Begebenheiten hierin bestätigt. So hatte ihn der katholische Pater Bruns des Öfteren vor Verschwörungen der in Potsdam garnisonierenden Soldaten gewarnt, die mit Anschlägen auf sein Leben hätten verbunden sein können.202 Die Gefahr war durchaus real, abgesehen von den aus besonderen und nicht zu verallgemeinernden Konstellationen in der Potsdamer Garnison erwachsenden Unwägbarkeiten.
Das erwähnte Konfliktpotential schloss jenen unangesessenen Bevölkerungsteil der altpreußischen Gesellschaft ein, der sich im Gegensatz zu den in gewohnten Herrschaftsverhältnissen eingebundenen städtischen und dörflichen Lebenswelten in noch geringerem Maße reglementieren, ja noch nicht einmal erfassen ließ. Darüber können auch nicht die vielen Edikte, Verordnungen und die als Reaktion auf viele Einzelfälle erlassenen Kabinettsordren hinwegtäuschen. Mitunter scheint Friedrich Wilhelm I. dies selbst gespürt zu haben. Als Mitte der 1720er Jahre vermehrt mit »Visitationen« gegen das sogenannte »liederliche Gesinde« vorgegangen wurde, wie man die damals zahllos die Lande durchstreifenden Bettler, »Zigeuner«203 oder – etwas euphemistischer – als »fahrendes Volk« titulierten Menschengruppen bezeichnete, gab sich der König nicht allzu optimistisch, dass ein nachhaltiger Effekt erzielt werden könne. Der Fürst von Anhalt-Dessau sollte 1727 mit der Leitung des Unternehmens betraut werden und zeigte sich zuversichtlich, möglichst viele dieser Leute aufzugreifen. Doch Friedrich Wilhelm äußerte sich gegenüber dem Fürsten in einer Marginalie resignativ: »Was wirdt das helfen, Sie werden doch wieder losgelassen.«204 Dabei stand die Landesherrschaft hier durchaus unter einem gewissen Erwartungsdruck seitens eines Teils der Bevölkerung, weil die Sicherheit mit den Landstreichern weiteren Schaden nehme und »das platte Land durch die vielen Feuers-Brünste dort herum in solche Furcht gesetzet worden, daß Niemand auf seinem Bette mehr ruhig schlafen« könne.205 Dass das Ausmaß sozialer Bedürftigkeit den Grad der Kriminalität beeinflusste und damit deviantes Verhalten erklären kann, war zwar in dieser Zeit durchaus bekannt, hatte sich aber noch bei Weitem nicht in der administrativen Praxis niedergeschlagen. Zudem stieß die aus heutiger Perspektive befremdlich anmutende und von geringer Barmherzigkeit kündende Vorgehensweise gegen diese »Outlaws« zumeist auf große Akzeptanz der Stadt- und Dorfgemeinden.206 Die in den Diskurs um die Gestaltung der Daseinsfürsorge und der »guten Policey« eingebetteten Fragen tangierten indirekt auch die Entscheidungen des Königs, worauf im folgenden Kapitel eingegangen wird, das sich der Wirtschafts- und Finanzpolitik zuwendet. Hier gilt es zunächst festzuhalten, dass ihm die Probleme, über die er durch die Gravamina, Bittschriften und Berichte sowie aus unmittelbarem Erleben während seiner Reisen informiert wurde, sehr wohl vertraut waren.
Bei der nach wie vor noch stark durch personale Beziehungen charakterisierten Herrschaftspraxis, in der in der Regel der Schultheiß, der Amtmann oder der Rittergutsbesitzer den unmittelbaren Bezugspunkt bildete, stellt sich freilich auch die Frage, wie »präsent« der König überhaupt bei seinen Untertanen war. Bei einem Monarchen wie Friedrich Wilhelm I., der sich bei etlichen politischen Materien so unmittelbar in die Regierung einzubringen schien, ist die Annahme nicht ganz abwegig, dass sich in den ländlichen und städtischen Gesellschaften ein bestimmtes Bild vom König etabliert hatte. Beispielsweise gab der kaiserliche Gesandte v. Schönborn-Buchheim im Mai 1713 ein Gespräch mit einem Schuster wieder, der ihm von Begegnungen mit dem König berichtet hatte, dem er Schuhe anfertigte. Schönborn fragte verwundert, ob der König in Häuser von Handwerkern ginge. »Ja, sein Herr wäre ganz eigen in seinen Sachen und thäte dinge, so man von anderen Potentaten … nicht hören würde«, antwortete ihm darauf der Schuster.207 Erinnert sei in diesem Zusammenhang noch einmal an die bereits erwähnte Praxis des Supplizierens, die ja auch eine gewisse Erwartungshaltung der Untertanen an den Monarchen widerspiegelte.208
Trotz solcher Beobachtungen wird Friedrich Wilhelm I. wohl nur in eingeschränktem Sinne als »König zum Anfassen«, als »volksnaher Monarch«209 angesehen werden können, jedenfalls nicht in einem eher populär verstandenen Sinne – vor allem, wenn man seine gewiss überzeichneten Zornesausbrüche bedenkt, die ihn insbesondere bei der Begegnung mit Bürgern seiner Residenzstädte ereilten.210 Dennoch legte der König auf solche unmittelbare Nähe zu seinen Untertanen Wert, für die in gewisser Hinsicht auch sein Agieren im Tabakskollegium sprach, wo er in ungezwungener Atmosphäre sich mit Militärs und Gelehrten, gelegentlich selbst mit Händlern und Handwerkern unterhielt.211 Schließlich galten ein gewisses Maß an »Erreichbarkeit« und »Zugänglichkeit« als Herrschertugenden.212 Mit diesem Verständnis korrespondierten – aus umgekehrter Perspektive – freilich solche Formen von Verehrung, die auch für andere Monarchien bekannt sind. So rief der in Preußisch Holland, einem Dorf in Ostpreußen, wohnende Brettschneider Valentin Koscowsky in Erinnerung, dass seine Gemahlin während der 1714 erfolgten Reise des Königs durch diese Provinz »die allerhöchste Gnade genossen [habe], mit E.K.M. in Preuß. Holland im Fahren nach dem AmbtsSchlosse einige worte in tieffster Demuth zu sprechen. Und da dieselbe eben grob schwanger gewesen«, habe der Monarch ihr angeboten – im Falle, ein Sohn geboren werde – ihn als Taufzeugen »zu erbitten«. Dieser Fall sei nun eingetreten, so dass er für seinen Sohn, der den Namen »Friedrich« tragen solle, um die Gevatterschaft des Königs bitte.213 Solche »Nähe« zwischen einem Fürsten und seinen Untertanen stellt gewiss keine Besonderheit des Herrschaftsstils Friedrich Wilhelms I. dar. Der preußische König war mit seiner ostentativ zur Schau gestellten Ablehnung üblicher barocker Inszenierungsformen insofern kein Sonderfall, als die Fürsten auch an anderen Höfen nicht »den ganzen Tag im vollen Ornat herumliefen, huldvoll winkten und die Höflinge mit Reverenzen beschäftigt waren«.214 Selbstverständlich war eine solche Praxis indes auch nicht. Als Gegenbeispiel ließe sich etwa der englische König Georg II. anführen, der im Verlauf seiner Regierungszeit bei seinen britischen Untertanen immer unpopulärer wurde, was nicht nur an seiner deutschen Herkunft lag, sondern daran, dass er eben sein Land nicht bereiste und »als unnahbar« galt.215
Als ein symbolträchtig aufgeladenes Terrain, auf dem Herrscher und Untertanen einander gegenübertraten und massenkompatible Herrschaftstechniken sich in besonderer Weise beobachten lassen, darf die Huldigung im Rahmen eines Herrscherwechsels angesehen werden. Bei der Gelegenheit vergewisserten sich »Herrscher und Beherrschte gemeinsam der rechtlich-politischen Grundlagen« und bezeugten durch den gemeinsamen Vollzug bestimmter Zeremonien »die Legitimität des jeweiligen Herrschaftsverhältnisses«.216 In der Tat hat man solchen Huldigungen aus zeitgenössischer Sicht neben ihrer Funktion für das landesherrlich-ständische Verhältnis, worauf in unseren Betrachtungen zur Ständepolitik des Königs noch näher eingegangen wird, eine gewisse didaktisch-erzieherische Funktion auf den »gemeinen Mann« attestieren wollen. Es war ja gerade die Zeichenhaftigkeit dieser zeremoniellen Handlungen, die es dem »Pöbel« erleichterte, überhaupt eine Vorstellung von der »Majestät« des Herrschers zu erhalten, oder wie es der zur damaligen Zeit an der Universität Halle lehrende Christian Wolff auf den Punkt brachte: »Der gemeine Mann, welcher bloß an den Sinnen hanget, und die Vernunfft wenig gebrauchen kan, vermag auch nicht zubegreiffen, was die Majestät des Königes ist: aber durch die Dinge, so in die Augen fallen und seine übrige Sinnen rühren, bekommet er einen obzwar undeutlichen, doch klaren Begriff von seiner Majestät, oder Macht und Gewalt.« Daraus leite sich im Übrigen trotz der aufkommenden zeitgenössischen Kritik die Einsicht ab, »daß eine ansehnliche Hoff-Staat und die Hoff-Ceremonien nichts überflüßiges sind«.217 Über diese Formen des Sinnempfindens lasse sich die mangelnde Einsichtsfähigkeit des Volkes kompensieren. Gerade die Huldigungsfeiern belegen, dass der zweite preußische König die Formen der Herrschaftsrepräsentation trotz seines ansonsten eher distanzierten Verhältnisses gegenüber dem Zeremoniell anzuwenden wusste. Der Faktor »Öffentlichkeit« wurde dabei durchaus einkalkuliert, wie zum Beispiel die Anwesenheit einer »großen Volksmenge« anlässlich seines Besuches in Halle am 12. April 1713 belegt.218 Und die in der nach dem Stockholmer Frieden an Preußen gelangten Stadt Stettin im August 1721 zelebrierte Huldigungszeremonie verband Friedrich Wilhelm I. mit einer aktiven Teilnahme am Vogelschießen der Schützenkompagnie der Kaufleute, einem Gottesdienst und einer Musterung.219 Huldigungseid und -gebet deuten sinnfällig die dahinter stehende Motivation der Einbindung der Stettiner Bevölkerung in den neuen Herrschaftsverband an: An erster und zentraler Stelle wird die »Gottesfurcht« betont, denn »Glückseligkeit und Sicherheit des Staates ruhet darauff«. Daraus wurde in traditioneller Weise die Verehrung des Herrschers abgeleitet, denn »Könige sind Gottes Statthalter«. Diesem Einschwören auf zentrale Komponenten des Herrschaftsverständnisses vor einer großen und damit repräsentativen Volksmenge kam insofern auch eine wichtige Bedeutung zu, als damit Gehorsam gegenüber der weltlichen Herrschaft – »Fluche dem Könige nicht in deinem Hertzen!« – gleichermaßen als Gottesgebot bewusst gemacht wurde.220 Diese ideelle Überhöhung kompensierte in gewisser Beziehung die verglichen mit heutigen Maßstäben geringe institutionelle und personelle Ausstattung des vormodernen Staates. Denn angesichts des hohen Maßes an »Widersetzlichkeit« in allen Teilen der Gesellschaft wurden geeignete Formen und Praktiken benötigt, um gewappnet zu sein.
Den Vorstellungen Friedrich Wilhelms I. wird ein von dem wirkmächtigen zeitgenössischen Zeremonielltheoretiker Johann Christian Lünig formulierter Gedanke besonders nahegekommen sein: Demnach dürfe die Herrschaft kein Bild der Konfusion bieten. »Der Pöbel richtet sich ohne dem mehr nach den Exempeln, als den Gesetzen seiner Regenten, wo er nun in der lebens-Art derselben eine nützliche Ordnung findet, da gewehnet er sich dieselbe auch an, und befördert dadurch seinen und des ganzen Landes Wohlstand.« Das Motiv der Vorbildhaftigkeit des irdischen Wandelns eines Herrschers mag wohl den preußischen König in seinen Lebensmaximen in starkem Maße beeinflusst haben. Genügend negative Beispiele standen ihm ja sowohl aus der Historie als auch unter zeitgenössischen Standeskollegen vor Augen. Denn der »HERR« sei »ein Gott der Ordnung«, also »müsse derjenige Regent, so an seiner eigenen Person keine Ordnung spühren liesse, keine wahre Copie des so ordentlichen Originals seyn«.221 Dieser Anspruch bezog sich nicht nur auf solche Facetten wie etwa den Verzicht auf sexuelle Libertinage, sondern selbst auf die Gestaltung eines geregelten und auf eine große Arbeitsamkeit hindeutenden Tagesablaufes. So pflegte der König um 12 Uhr sein Mittagsmahl einzunehmen. Jene Zeit sei, so wusste ein Biograph zu berichten, »auch beinahe in allen Privathäusern … zum allgemeinen Gesetze geworden«.222
Doch obgleich das Hofleben in der preußischen Residenz bei Weitem nicht jene Vorbehalte hervorrief, die die gerade im ausgehenden 17. und frühen 18. Jahrhundert zunehmende publizistische Hofkritik artikulierte, verbat sich Friedrich Wilhelm I. Reflexionen über seinen Hof und seine Familie – hier war er wieder durchaus ein Kind seiner Zeit. Denn solche Materien bildeten sensible Bereiche der »Arcana Imperii«, über die ein Unberufener und zudem von ihm nicht autorisierter Schreiber nicht zu berichten hatte – und geschehe es auch in einer noch so wohlmeinenden Diktion. Rein oberflächlich betrachtet müsste die vornehmlich von bürgerlichen Kreisen ausgehende Hofkritik dem Lebensstil des Königs entgegengekommen sein, begünstigte sie doch »den Aufstieg eines neuen Verhaltensideals, der Aufrichtigkeit«, gewissermaßen als Antipoden zum »Zwang zur Verstellung«.223 Dem war aber mitnichten so. Vielmehr teilte der preußische König die bekannten Vorbehalte gegen eine Verbreitung von Informationen über die in seinen Augen nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Dinge. So reagierte Friedrich Wilhelm im Dezember 1735 sehr missfällig auf das gerade erschienene »Potsdamsche Mercurium«, weil darin »von Potsdam und denen dortigen Sachen Erzehlungen und Vorstellungen gemachet« worden seien. Der König befahl den zuständigen Amtsträgern, dass künftig »nicht das geringste von dero Königl. Hofe, und was davon abhänget, oder von Potsdam, dem Königl. Lande und dessen Verfassungen anzuführen«. Wohl aber bleibe es dem Verfasser unbenommen, und dies ging über die bisher geübte Praxis etwas hinaus, »mit auswärtigen Höffen und unanstößigen Zeitungen und allem, was sonst curieux ist, sich zu amüsieren«.224
In gewisser Weise sensibilisiert war Friedrich Wilhelm I. in dieser Frage, weil wenige Wochen zuvor die von David Fassmann verfasste Lebensbeschreibung225 über ihn publiziert worden und sogleich auf großes Interesse gestoßen war, so dass der Band »gleich so starck in Leipzig weggegangen«.226 Für die große Verbreitung des Buches spräche im Übrigen die Tatsache, dass bestimmte Passagen wörtlich von den damaligen Zeitschriften übernommen wurden, so etwa für die Ausgabe des »Mercure historique« des Jahres 1740, aber auch für eine Reihe von Lebensbeschreibungen, die nach dem Tode Friedrich Wilhelms I. erschienen.227 Wenn man jedoch diese Abhandlung nach irgendwelchen kompromittierenden Passagen durchmustert, dürfte man kaum fündig werden – ganz im Gegensatz etwa zu der von Fassmann kurz zuvor im Jahre 1734 veröffentlichten und sofort auf den Index geratenen Lebensbeschreibung Augusts des Starken. Das Motiv für die Echauffiertheit des Königs lag nicht so sehr im Inhalt des Textes begründet als vielmehr in der Person seines Autors, denn Fassmann war, wie wir im vorhergehenden Kapitel gesehen haben, beileibe kein Unbekannter innerhalb der Hofgesellschaft. Folgt man seinen eigenen Bekundungen, so verfügte er über gelegentliche Kontakte zu Angehörigen der preußischen Hofgesellschaft228 und gehörte zuweilen zu den Besuchern des Tabakskollegiums, wo er auf Kosten des unglücklichen Gundling seine Scherze trieb. Damit besaß er Kenntnisse über den Inhalt der in dieser illustren Runde geführten Gespräche mit teilweise intimen Details.
Die Arbeit an der »Lebensbeschreibung« Friedrich Wilhelms I. hatte Fassmann noch während seiner Berliner Zeit begonnen, und man merkt der Diktion des Buches kaum den inneren Zwiespalt an zwischen persönlichem Opportunismus und dem Trachten nach schriftstellerischer Unabhängigkeit, die selbst mit Kritik nicht spart. Vielmehr handelt es sich um eine Darstellung, die »von Anerkennung und Ehrerbietung überfließt«.229 In späteren Schriften hat er sich deshalb immer wieder selbstkritisch zu seiner früheren Rolle geäußert. Er hätte sein Glück »gar leichtlich bei Hofe vollkommen … machen können, daferne er eines niederträchtigen Geistes und interessierten Gemütes gewesen wäre. Allein er hat lieber den Privatstand wieder erwählet.«230
Zwar konnte Fassmann bald in Bayreuth ausfindig gemacht werden, jedoch rieten die Minister Thulemeier, Borcke und Podewils dem König, dass er »auf dieses nichtswürdige Subjectum zu wenig reflexion machen [solle], um ihn dero Ressentiment empfinden zu lassen«.231 Friedrich Wilhelm I. folgte dieser Argumentation und verzichtete auf eine Konfiskation des Buches und die Verhaftung Fassmanns.