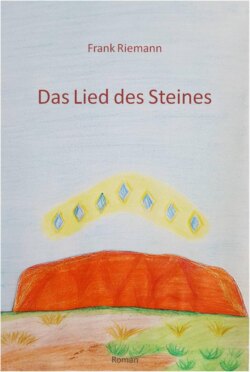Читать книгу Das Lied des Steines - Frank Riemann - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wollongong / Neusüdwales, Montag 26. April, 13:00 Uhr
ОглавлениеHenry O`Mailey saß noch immer so an seinem Schreibtisch, wie er zuvor an ihm zusammengesunken war. Niemand kümmerte sich um ihn und Keinen interessierte, was mit ihm los war. Der gedrungene Mann, der immer so aussah, als hätte er die vergangene Nacht durchgemacht, hatte keine Freunde im Revier. Man wollte so wenig wie möglich mit ihm zu tun haben und so ließ man ihn schlafen.
Aber Henry hatte nicht geschlafen. Die gesamte Zeit hindurch, über eine Stunde lang, hatte er so dagelegen und hatte nachgedacht. Zuerst hatte er sich ungefähr einhundert Mal gefragt, warum immer ich? Dann dachte er eine Weile an gar nichts und er wäre tatsächlich beinahe eingeschlafen, so süß zog die Dunkelheit an ihm. Doch plötzlich fiel die komplette Last seiner trüben Situation auf ihn hernieder und er war wieder hellwach, ohne sich jedoch zu regen.
Dann begann er zu grübeln. »Hier mag mich Keiner. Es gibt Niemanden, der mich achtet oder mir helfen würde. Die warten doch nur darauf, dass ich erneut versage. Dann gäbe es wieder ein großes Trara. Mittlerweile wird ja noch nicht einmal mehr hinter der Hand getuschelt, sondern ganz offen mit dem Finger auf mich gezeigt, wie auf einen räudigen Straßenköter. Dann der Fall. Wie soll ich denn so etwas anpacken? Wie soll ich den denn aufklären? Das ist der absolute Überhammer. So ein Gemetzel. Das Schlimmste, das ich je bearbeitet habe, war die versuchte Vergewaltigung, bei der die Frau den Angreifer auch noch mit einem Hundeabwehrspray in die Flucht geschlagen hatte. Das hier, das packe ich nie. Dem Captain traue ich mich erst gar nicht unter die Augen. Wer weiß, was der sich schon wieder ausdenkt, um mich zu drangsalieren. Vielleicht wäre eine Versetzung nicht verkehrt. Ich könnte in einem neuen, unbelasteten Umfeld, ohne Vorurteile mir gegenüber, von vorne anfangen und versuchen, mir wenigstens im Beruf einen Platz zu suchen, an dem ich zurecht komme und an dem das Leben zumindest halbwegs erträglich wäre. An mein Privatleben wage ich erst gar nicht zu denken. Denn meint man, man kommt nach Hause und einen erwartet eine liebende Frau, öffnet mir mein Hausdrache die Tür. Wenn sie wenigstens mal zur Tür käme, wenn ich heimkehre, aber selbst das ist ja schon zu viel verlangt. Sie tut so gut wie nichts im Haus, und so sieht es bei uns auch aus. Soll ich etwa noch putzen, wenn ich nach Hause komme, oder einkaufen? Unsere beiden Kinder, Paul und Maureen, sind vor einigen Monaten ausgezogen, und sie waren froh, dass sie weg waren; wer weiß, wofür es gut ist? Juliette macht sich auch nicht mehr zurecht. Sie läuft den ganzen Tag im Bademantel durchs Haus, wenn sie sich mal von der Couch erhebt. Und wozu auch? Immer wenn ich sie motivieren will, sich mal aufzuraffen und sie ausführen will, und wenn es nur auf einen Drink in Joey`s Bar ist, keift sie mich an. Die Beine hat sie auch schon lange nicht mehr breit gemacht, aber ist vielleicht auch besser so. Sie war mal so schön, ich hatte sie gar nicht verdient. Jetzt wirft sie mir nur noch vor, ich hätte mein Leben weggeworfen und ihres gleich mit.«
Ein klatschendes Geräusch riss O`Mailey aus seinen Gedanken und er blickte auf. Wilson Maddicks, der Kollege, den er gebeten hatte, die Schriftzeichen zu überprüfen, hatte ihm eine kleine Mappe vor seinem Kopf auf den Tisch geknallt.
»Was soll das, Maddicks? Was ist das?«
»Das fragst du mich? Du wolltest doch, dass ich dir etwas über dein Gekritzel besorge. Also, pass auf: Hier in Australien bin ich überhaupt nicht fündig geworden. Aber jetzt kommt`s. Einem Professor Sniegorsky, Sniewolsky, oder so ähnlich, von der Universität in Acton in Canberra, hat das zu denken gegeben und er erinnerte sich eines Freundes an der Notre Dame University in Indiana in den USA, eines gewissen Prof. Grossman. Dem wiederum kam das irgendwie bekannt vor.«
»Ja, und?«, sah O`Mailey einen Silberstreif am finsteren Horizont. »Was hat er herausgefunden?«
»Nicht so hastig. Er forschte seine Computerdateien durch und ging ins Internet, und fand gar nichts.«
»Na toll.« Der Inspector war enttäuscht. »Also doch wieder das Selbe. Eine Sackgasse und ich stehe mit leeren Händen da.«
»Langsam, langsam«, entgegnete Maddicks. »Dass der gute Mann nichts gefunden hat, obwohl er meinte, Ähnliches schon einmal irgendwo gesehen zu haben, ließ ihm keine Ruhe. Er kletterte auf seinen Dachboden, was er lobenswerterweise sofort tat, denn in Indiana ist es Sonntagabend, und stöberte in einer großen Kiste nach seinen handschriftlichen Aufzeichnungen aus seiner eigenen Studienzeit. Das hat er mir übrigens Alles selbst erzählt. Seine Telefonnummer findest du auch in der Mappe. Sie enthält das, was er gefunden und uns rübergefaxt hat. Ich muss dir ehrlich sagen, die Geschichte fand ich nicht uninteressant. Trotzdem bleibe ich dabei, das war das letzte Mal. Du bist mir etwas schuldig und in Zukunft machst du deine Sachen alleine, damit das klar ist.«
»Ja, schon gut, ich hab`s kapiert. Und Maddicks...«, er rief den Kollegen, der sich zum Gehen gewandt hatte, zurück. Dieser drehte sich widerwillig um. »...Danke.«
»Alles klar. Merk dir nur, dass es das letzte Mal war, dass ich dir einen Gefallen getan habe.«
Er ging und Henry sah ihm nach. »Warum behandeln mich alle wie den letzten Dreck?« Er spielte mit der Mappe in seinen Händen. »Bin ich wirklich so ein Loser? Und wann hatte das angefangen, oder war es schon immer so gewesen und ich habe es früher nie bemerkt. Aber vielleicht halte ich gerade jetzt die Lösung zu einem Geheimnis in meinen Händen, Alles wird gut und ich habe eine strahlende Zukunft vor mir.« Aber so richtig mochte der Inspector nicht daran glauben. »Meine Zukunft ist erst dann strahlend«, dachte er, »wenn ich mit einem Brennstab aus Uran oder Plutonium in der Tasche rumlaufe.«
Henry öffnete die Mappe und entnahm ihr ein einziges Blatt Papier. Oben links war mit einer Büroklammer seine eigene Zeichnung befestigt und oben rechts ein Zettel mit einer ganz ähnlichen Skizze. Die Gemeinsamkeiten waren nicht zu übersehen. Trotzdem waren sie nicht identisch. O`Mailey nahm sie vorsichtig ab und legte sie nebeneinander vor sich auf den Tisch.
Auf dem Blatt stand: »Leider konnte ich Ihre Zeichnung nicht hundertprozentig identifizieren, geographisch oder ethnisch zuordnen oder gar übersetzen, aber ich bin auf etwas gestoßen, dass Ihnen vielleicht weiterhelfen wird. Ich habe Ihnen eine Schriftprobe beigelegt, die mir während meiner Studienzeit in die Finger gefallen war. Sie werden die Ähnlichkeit erkennen. Auch habe ich keine Erinnerung oder Notiz mehr, woher ich sie habe, aus welchem Buch oder von welchem Dozenten. Aber einige Anmerkungen habe ich mir dennoch gemacht. Die von mir beigelegten Schriftzeichen ordnet man einem kleinen Eingeborenenstamm zu, den Wodongo-Ashanti, die allerdings mittlerweile ausgestorben sein dürften, da selbst im vorigen Jahrhundert die Zahl ihrer Mitglieder gering war. Sie lebten an einem winzigen Zufluss des Flusses `Weißer Volta` in der Nähe des heutigen Tamale in Ghana/Westafrika. Man vermutet, und ich sage das mit Absicht, weil es nie gelungen ist, diese Schrift vollends zu übersetzen, also man vermutet, dass es sich hierbei um Verse, Lieder, Gedichte und Sagen handelt, die die Stammesgeschichte und -tradition beinhalten und von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Das ist insofern bemerkenswert, weil diese Naturvölker dies sonst nur auf dem mündlichen Wege taten. Der exakte Wortlaut muss also von außerordentlicher Bedeutung gewesen sein und man legte großen Wert darauf, dass dieser nicht im Geringsten verfälscht wurde. Schriftzeichen, die unseren hier ebenfalls ähnlich sind, fand man bei einem Stamm, der in der Nähe von Coari lebte, im tiefsten Amazonasdschungel.
Sie sehen also, es bleibt mysteriös. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr sagen kann. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wenn diese Geschichte eine Pointe hat, bin ich überaus begierig, sie zu erfahren. Freundlichst, Prof. Isaac Grossman.«
O`Mailey dachte, er hätte etwas übersehen und las das Schreiben noch einmal. War er denn wirklich nicht in der Lage, zu erkennen, was er dort in Händen hielt, oder waren das unwichtige Erkenntnisse, die ihn genauso wenig weiterbrachten, wie seine anderen Ermittlungen auch? Wie dem auch war. Den Text las er wohl, nur half es ihm nicht. Seine Euphorie, die zu wachsen begonnen hatte, wie eine Blume, die den tauenden Schnee durchbrach, verkümmerte und er war abermals in einem Labyrinth aus Fragen gefangen und sah keinen rettenden Ausweg. Es taten sich sogar neue Wände vor ihm auf. Wie sollte ein afrikanischer Eingeborener von einem Stamm, den es wahrscheinlich gar nicht mehr gab, nach Australien kommen; das wäre doch bekannt geworden. Und warum sollte er hier eine ganze Familie auslöschen und auch noch seine blöde Stammesgeschichte an die Wand schreiben? O`Mailey nahm erneut seine Denkerstellung ein und fragte sich abermals ungefähr einhundert Mal, warum immer ich?
Seine Gedanken schweiften mal hierhin, mal dorthin. Seine Welt drehte sich immer schneller in seinem Kopf.
Ob durch die Vorstellung, wie sich ein afrikanischer Ureinwohner in einer fremden Welt zurechtfinden musste, die er nicht verstand, oder durch den Wunsch etwas zu leisten, damit er von seinen Kollegen als einer der ihren akzeptiert wurde, wusste er nicht zu sagen, aber plötzlich standen Henry wieder Ereignisse aus seinen Kindertagen vor Augen. Das war nun schon das zweite Mal an diesem Tag. Davor hatte er schon viele Jahre nicht mehr an diese Zeit gedacht, waren die Erlebnisse von damals auch gar nicht als Fluchtpunkt aus seiner trüben Realität geeignet. Dennoch sah er nun einige Geschehnisse so klar vor sich, als würde er sich einen Film anschauen.
Dummkopf war gerade dabei die Treppe zu wischen, die vom Eingangsbereich nach oben zu den Zimmern der Damen führte. Seine Knie und sein Rücken taten ihm weh und die Haut an seinen Fingern begann schon zu schrumpeln. Das Holz war alt und der Lappen auch, sodass er immer wieder mit einzelnen Fäden an hervorstehenden Spänen hängenblieb, was den Lumpen noch mehr zerfaserte. Von unten trat seine Mutter an ihn heran und stieß ihn mit ihrem Fuß am Bein. »Na los, Dummkopf, mach Platz und lass uns vorbei!«
Er kroch zur Seite und krümmte sich zusammen, weil er nicht wieder geschlagen werden wollte. Aufreizend langsam stolzierte seine Mutter nach oben, einen Mann an der Hand, den er hier schon einmal gesehen hatte.
»Ja Dummkopf, mach Platz!«, äffte dieser seine Mutter nach und beide lachten, bis eine Tür hinter ihnen zufiel.
Immer wenn er seine Mutter fragte, was sie denn dort drinnen mit den Männern mache, bekam er eine Ohrfeige. Deshalb hatte er nach einiger Zeit gelernt, nicht mehr zu fragen, und sie sagte: »Ich sorge dafür, dass du nicht verhungerst, du Dummkopf.«
Aber wie sollte das funktionieren? Die Herren in ihren steifen Anzügen, die zu Besuch kamen, hatten keine Säcke voller Kartoffeln dabei, keine Körbe voll mit Äpfeln oder Taschen voller Brot. Und das musste man ja schließlich irgendwie bezahlen. Gaben diese Männer seiner Mutter etwa Geld? Aber wofür?
Wieder einmal schlich er vor die Tür zum Zimmer seiner Mutter und legte das Ohr an das Holz. Von drinnen vernahm er Stimmen, wie bei den vergangenen Gelegenheiten auch, konnte aber nicht verstehen, was gesagt wurde. Er schaute sich ängstlich um, dass ihn auch niemand erwischte, was unweigerlich eine gehörige Tracht Prügel nach sich gezogen hätte und drückte sich noch enger an das Türblatt. Dummkopf hörte etwas quietschen und ein regelmäßiges heftiges Stöhnen, wie von einem Verletzten, der große Schmerzen haben musste. Einmal hatte er es gewagt an einer Tür einer der anderen Frauen zu horchen und hatte Ähnliches wahrgenommen. Kamen die Männer nach einer Weile heraus, wirkten sie erleichtert und lächelten, wie von einer großen Last befreit. Waren seine Mutter und die Anderen vielleicht so etwas wie Ärzte? Erlösten sie ihre Besucher von Kummer und Pein durch Techniken, die dem Doktor am Ende der Straße unbekannt waren? Denn, wenn sie solche Schmerzen hatten, warum gingen diese Männer dann nicht zu ihm?
»Dummkopf!«, brüllte jemand von unten, und er erkannte die Stimme sofort, verhieß sie doch zumeist nichts Gutes. Die Treppe! Er hatte zu lange gelauscht. Er sollte sich sofort nach Beendigung seiner Arbeit wieder bei Karl melden. So war die Zeit verstrichen, ohne dass er die Treppe fertig gewischt hatte.
»Dummkopf! Wo steckst du, du Nichtsnutz?« Karl war der einzige Mann, der hier im Haus lebte. Als Dummkopf seine Mutter einmal fragte, ob er sein Vater wäre, antwortete sie, das wisse sie nicht. Er solle sich einfach merken, dass sein Vater fortgegangen sei. Trotzdem unternahm sie Nichts, wenn er ihn schlug. Ja, sie lachte sogar noch dabei und sagte, das hätte er aber auch verdient. Hatte er das wirklich? War vielleicht wirklich alles seine eigene Schuld?
»Wo versteckt sich der Bengel? Dummkopf!«, schrie Karl wieder.
Der Gesuchte schreckte von der Tür zurück und hastete zur Treppe. Er sprang die Stufen hinunter und wollte seine Arbeit wieder aufnehmen. Vielleicht würde es ihm diesmal gelingen, Karls Annahmen Lügen zu strafen, und er würde einsehen, dass er zu Unrecht nach ihm rief.
Er wollte sich auf den Lappen stürzen, auf die Knie gehen, um mit kräftigen Putzbewegungen zu beginnen, als er bei einer Drehung den Wascheimer mit dem Bein umstieß, genau in dem Moment, als Karl um das untere Ende der Treppe bog.
»Antworte gefälligst, wenn ich dich rufe, blöder Kerl. Was ist das hier? Aua, verdammte Scheiße!«
Der Eimer war die Treppe heruntergepoltert und ihm vor das Knie gesprungen und sein Inhalt ergoss sich wie ein Wasserfall über Stufen und seine Hosen und Schuhe.
»Verfluchte Schweinerei! Sieh dir an, was du getan hast. Nichts kannst du richtig machen.« Er stapfte durch die Pfütze zu ihm herauf und holte mit der Hand weit aus, um ihn zu schlagen, aber Dummkopf rollte sich zusammen, und so trat Karl nach ihm.
Durch den Lärm angelockt standen oben an der Treppe einige der Damen, sowie seine Mutter mit ihrem Besucher, und alle lachten.
»Seht Euch den Trottel an. Der ist aber auch blöd.«
»Ich dachte immer, der wäre zu doof, um einen Eimer Wasser umzukippen.«
Weitere Beleidigungen gingen im Gelächter unter, welches in Henrys Ohren mit seinem eigenen Geschrei verschmolz.
Zurück in der Gegenwart dachte der Inspector an seine Kollegen, seinen Vorgesetzten, seinen Fall, seine Frau und an sein ganzes Leben und fragte sich zum wiederholten Male: »Warum immer ich?«
Henry raffte die Unterlagen zusammen, fand die Telefonnummer des Professors aus Indiana auf der Rückseite seiner Zeichnung, schloss die Mappe und legte sie in die oberste Schublade ganz nach oben. Vielleicht würde er sich später noch mit Amerika verbinden lassen. Wer hätte jemals gedacht, dass er einmal wegen eines Falles einen Spezialisten aus den Staaten konsultieren würde.
»O`Mailey! Sofort in mein Büro!«, brüllte eine Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Der Inspector erhob sich schwerfällig mit einem Seufzen und machte sich auf den Weg zu seinem Superintendent, Edward McGuiggan.
Henry schloss die Tür und wandte sich seinem Vorgesetzten zu, der, wie eine Spinne im Netz, hinter seinem Schreibtisch saß und ihn über dicke Brillenränder ansah, als wäre er eine fette schmackhafte Fliege. »Setzen Sie sich, Henry.« Seine Stimme, zuvor noch donnernd und befehlend, war jetzt vollkommen ruhig. Das, und der Umstand, dass er ihn mit seinem Vornamen ansprach, ließ ihn vermuten, dass es ein ernstes Gespräch werden würde. »Wie geht es Ihnen, Henry? Ist alles in Ordnung? Ich mache mir Sorgen um Sie.«
Der Inspector runzelte die Brauen. Er hatte einen ganz anderen Beginn erwartet. Dies hier war ihm unheimlich. »Ist schon OK. Na ja, ich meine, es ist soweit alles in Ordnung«, log er.
»Was macht Ihr Fall? Wie weit sind Sie?«
»Hören Sie Superintendent«, Henry hob zur Abwehr seine Hände, »ich weiß, was Sie sagen wollen, aber ich arbeite erst seit ein paar Stunden an dieser Sache und Sie wissen, das ist nicht unbedingt die Art Fall, mit denen ich mich normalerweise beschäftige.«
McGuiggan nickte stumm und legte den Kopf auf die Hände, die Ellenbogen auf den Tisch gestützt. Einen Augenblick lang schwiegen beide und der Superintendent musterte seinen Inspector. Dann räusperte er sich und sprach in ruhigem Ton weiter: »Ich sage Ihnen was, Henry. Ich werde Ihnen meine Lage, unsere Lage, erklären. Der Staatsanwalt möchte Jemanden haben, den er vor Gericht stellen kann.« Er begann einzeln seine Finger zu heben, um die Anzahl seiner Argumente zu verdeutlichen und fuhr fort. »Der Bürgermeister möchte das auch. Die Wahlen sind zwar erst im nächsten Jahr, aber bei seinem angeschlagenen Ruf käme ihm ein Erfolg gerade Recht, um den Bürgern zu zeigen, dass seine Stadtverwaltung, zu der die Polizei auch gehört, gut arbeitet. Die Presse hat von unserem Großaufgebot heute morgen am Tatort Wind bekommen, und fängt an, Fragen zu stellen. Ich möchte nicht, dass die sich eine Horrorstory aus den Fingern saugen und Alles noch schlimmer machen, als es ohnehin bereits ist. Und außerdem habe ich wieder Sodbrennen.« Er hob die andere Hand. »Bernstein und Green arbeiten an dem Raubüberfall. Beechman und Sallis arbeiten an dem Grayson-Mord. Wyngarde und Flumm suchen diesen vermissten Erben. Wie heißt er noch? Billings. Maddicks ermittelt gegen den Kerl, der die Prostituierten absticht und Barton und Jones sind raus. Der eine ist noch krank und der andere hat Urlaub. Zur Zeit kommt Alles ein bisschen Dicke, Henry. Sie wissen doch, wie es läuft. Der nächste Fall, der nächste freie Mann. Sie sagen, der Fall wäre ungewöhnlich für Sie. Das mag stimmen. Aber Sie brauchen keinen Überraschungszeugen aus dem Hut zu ziehen, nicht den Hauptverdächtigen in einem Wahnsinns-Show-Down zu erledigen oder mit einem kniffligen Trick zu überführen. Das sind Fernsehmärchen. Unsere Arbeit besteht darin, Fragen zu stellen, Fakten zu sammeln, das Unmögliche auszuschließen und auf die offensichtliche Lösung zu kommen. Leisten Sie gute Arbeit, Henry. Oder wollen Sie, dass ich Sie von diesem Fall abziehe? Das könnte ich tun. Es wäre zwar nicht so einfach, wie Sie vielleicht denken, aber es wäre machbar. Sie müssten sich dann in den Raubüberfall oder die Prostituiertenmorde einarbeiten und die Kollegen in Ihren Fall. Das ist immer problematisch, aber möglich. Wollen Sie das?«
O`Mailey wollte schon reflexartig verärgert `Nein` antworten, stockte aber und überlegte es sich noch einmal. Natürlich, dieser Fall war der absolute Hammer. Warum nicht? Er gab die Sache ab, und hatte ein Problem weniger. Das wäre das Einfachste. Wenn sich erst die Presse auf die Angelegenheit stürzte, bekäme er noch mehr Druck. Allerdings sind die anderen Fälle auch nicht viel harmloser. Verdeckt gegen einen Irren zu ermitteln, der irgendwelche Schlampen aufschlitzte, oder einem verzogenen Alleinerben hinterherzulaufen war bestimmt auch nicht witziger. Außerdem, wenn er jetzt kniff, war das vielleicht seine letzte Gelegenheit, überhaupt etwas auf die Beine zu stellen. Dann wäre Alles vorbei. Oder wäre genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um seine Versetzung zu bitten? Wäre das nicht, wie eine Flucht? Würde das auf dem neuen Revier die Runde machen, wäre das Problem das Selbe. Aber vielleicht sollte er nicht daran denken, was der einfachste Weg wäre, sondern, welcher der Richtige wäre. So sehr ihm diese ganze Scheiße gegen den Strich ging, im Moment war es seine Scheiße.
»Henry, wollen Sie das?«, wiederholte der Superintendent ungeduldig seine Frage.
Und mit kräftiger Stimme und einer Entschlossenheit, die ihm selbst fremd war, erwiderte er: »Nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass Sie mich abziehen. Ich gebe zu, das ist das Schlimmste, das ich je erlebt habe, aber ich werde mich in den Fall hineinknien.«
»Gut. Ich sage Ihnen etwas. Tragen Sie so viele Fakten zusammen wie möglich. Jeder noch so kleine Hinweis kann wichtig sein. Befragen Sie jeden Zeugen, der Ihnen in den Sinn kommt. Sprechen Sie mit einem unserer Psychologen über ein mögliches Täterprofil. Den anderen Leuten hier werde ich ein bisschen Feuer machen, und wenn einer mit seinem Fall fertig ist, wird er Sie sofort unterstützen. Wie hört sich das an?«
O`Mailey spürte zwar immer noch die große Last dieser Aufgabe auf seinen Schultern, wie Atlas, der einst die ganze Welt getragen hatte, aber er war zufrieden. Zufrieden, weil sein Vorgesetzter ihn nicht niedergemacht hatte, sondern, weil er ihm zu vertrauen schien. Weil er ihn in Ruhe arbeiten ließ und ihm Hilfe zugesagt hatte. Er hatte trotz der Schwere der Aufgabe nichts Unmögliches von ihm verlangt. Der Inspector war zufrieden, weil das vielleicht der erste Schritt aus seinem Schlamassel heraus war. Der Schleier über seinen grauen Augen lichtete sich etwas. Erleichtert erhob er sich »Danke, Edward«, und verließ das Büro.
Sein Vorgesetzter hechtete zur Tür und brüllte ihm hinterher: »Superintendent McGuiggan!«