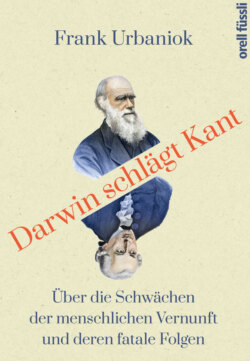Читать книгу Darwin schlägt Kant - Frank Urbaniok - Страница 26
2.12Generalisierung: Der unterschätzte Denkfehler
ОглавлениеÄhnlich wie Kahneman gelingt es Taleb, uns auf oft witzige und manchmal provokante Weise vielfältige Verzerrungen unserer Wahrnehmung und unseres Denkens vor Augen zu führen. Er ist selbst aber auch ein gutes Beispiel für ein anderes Phänomen, das bei den Verzerrungstendenzen unseres Denkens bislang kaum berücksichtigt wurde. Es handelt sich um die Tendenz zur Generalisierung und Verabsolutierung von Prinzipien (Ordnungen, Regeln, Theorien, Erklärungen u. a.), die wir entdeckt zu haben glauben. Das Phänomen der Generalisierung ist die dritte Stufe im später noch vorgestellten RSG-Modell (Registrieren, Subjektivieren, Generalisieren; vgl. Kap. 5). Aufgrund der vielfältigen kausalen Erklärungen und stimmigen Geschichten, die wir haltlos in bestimmte Ereignisse hineinprojizieren, hegt Taleb ein tiefes Misstrauen gegenüber allen kausalen Annahmen und plausibel wirkenden Erklärungen. Damit überspannt er seinen Ansatz. Der hat zwar in vielen Bereichen seine Berechtigung, wird aber dann zum Problem, wenn er zu stark ausgeweitet und generalisiert wird. So übersieht oder diskreditiert Taleb Kausalitäten auch dort, wo sie ihre Berechtigung haben. Hierzu lassen sich in seinem Buch zahlreiche Beispiele finden. Eines davon betrifft die Ausrottung von Tier-, Pflanzen- und früheren Menschenarten. Taleb verweist auf den Umstand, dass fast alle Arten, die je auf unserem Planeten gelebt haben, irgendwann auch wieder ausgestorben sind. Das ist vielen Menschen nicht bewusst, weil es sich auch bei diesen vielen Arten um stumme Zeugen handelt. Wir übersehen, dass die in der Gegenwart anzutreffende Artenvielfalt nur einen kleinen Bruchteil all jener Arten ausmacht, die im Lauf der Erdgeschichte ausgestorben sind. Das Überleben einer Art ist also fast immer eine höchst temporäre Angelegenheit und das Aussterben der absolute Normalfall. So weit, so gut. Taleb sagt dazu:
»Nahezu 99,5 Prozent der Arten, die die Erde irgendwann einmal bevölkerten, sind heute ausgestorben – eine Zahl, die die Forscher im Laufe der Jahre immer weiter erhöht haben. Das Leben ist viel zerbrechlicher, als wir gedacht haben. Das heißt aber nicht, dass wir uns wegen des Aussterbeprozesses, der um uns herum abläuft, schuldig fühlen müssten. Und auch nicht, dass wir etwas unternehmen sollten, um ihn aufzuhalten. Die Arten sind schon gekommen und wieder verschwunden, bevor wir angefangen haben, die Umwelt zu verschmutzen. Es besteht keine Notwendigkeit, uns für jede bedrohte Art moralisch verantwortlich zu fühlen.« [5, S. 141]
Dieser Einschätzung liegt ein Denkfehler zugrunde. Taleb begeht ihn, weil er durch die Generalisierung seiner Entdeckung der stummen Zeugen und der entsprechenden Skepsis gegenüber Kausalität eine zutreffende Kausalität völlig übersieht. Deswegen ist seine Beurteilung, dass wir uns wegen des Aussterbens vieler Arten nicht zu große Sorgen machen sollten, schlicht falsch. Denn bei dieser Frage ist der entscheidende Punkt in der Tat die Kausalität, also die Frage, wer für das Aussterben einer Art verantwortlich ist. Das allgemeine, abstrakte Argument vom Aussterben der meisten Arten kann nur auf diejenigen relativierend zutreffen, für die der Mensch nicht verantwortlich ist. Die abstrakte und von uns häufig unterschätzte Dimension des Aussterbens relativiert aber selbstverständlich in keiner Weise die Verantwortung, die wir für die von uns verursachte Ausrottung der Arten tragen.
Man kann das durch zwei kleine Beispiele verdeutlichen. Nehmen wir an, wir verweisen darauf, dass das menschliche Leben – zumindest bislang – immer begrenzt ist und alle Menschen irgendwann sterben. Analog zur Argumentation von Taleb könnte man nun sagen, dass es unter diesem Aspekt völlig übertrieben sei, sich wegen der Ermordung einzelner Menschen Sorgen zu machen. Irgendwann müsse doch sowieso jeder Mensch sterben. Einen Mörder speziell zu bestrafen und überhaupt so ein Riesentheater um einen einzelnen Todesfall zu machen, sei vor diesem Hintergrund völlig unangemessen. Auch können die nationalsozialistischen Verbrechen bei der Ermordung jüdischer Menschen in keiner Weise dadurch relativiert werden, dass in der Menschheitsgeschichte unendlich viel mehr Menschen an schrecklichen Krankheiten verstorben sind.
Es gibt zwar gute Gründe, vielen Kausalitäten, Erklärungen und scheinbar stimmigen Geschichten zu misstrauen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch viele sinnvolle Kausalitäten, fundierte stimmige Geschichten und tragfähige Erklärungen gibt. So ist die Kausalität bei der Beurteilung der Vernichtung von Tier- und Pflanzenarten ein zentraler Punkt. Denn ob diese Tier- und Pflanzenarten durch den Einschlag eines Meteoriten oder durch menschliches Handeln zu Tode kommen, macht im Hinblick auf Schuld und Verantwortung einen entscheidenden Unterschied. Das, was der Mensch verursacht, liegt in seinem konkreten Verantwortungsbereich. Dieser Verantwortung hat er sich zu stellen und ihr gerecht zu werden – abseits abstrakter theoretischer Überlegungen.
Das Gleiche gilt übrigens auch für den Klimawandel. Denn bei diesem Thema argumentieren populistische Kritiker genauso, wie Taleb es tut. Weil es in der Erdgeschichte schon immer gewaltige Schwankungen des Klimas gegeben habe, sei das Geschrei um den Klimawandel ebenso verfehlt wie das Ergreifen bestimmter Maßnahmen. Das Beispiel zeigt uns aber zweierlei. Die Tendenz zur Generalisierung und Verabsolutierung ist ein bislang wenig beachteter Verzerrungsmechanismus unseres Denkens. Zu Unrecht. Denn er kann zu absurden Beurteilungen und Handlungen führen. Das Beispiel gibt uns auch einen ersten Hinweis darauf, dass auch der naturwissenschaftliche Ansatz keineswegs dagegen gefeit ist, den allgemeinen menschlichen Verzerrungsmechanismen und Beurteilungsfehlern zu unterliegen. Dessen sind sich viele Vertreter des empirischen naturwissenschaftlichen Ansatzes nicht bewusst. Beide Themen werden uns noch an verschiedenen Stellen dieses Buches wiederbegegnen.