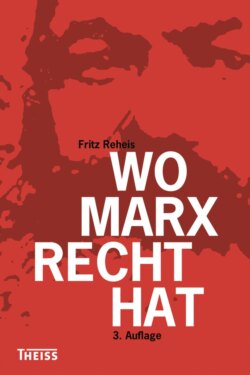Читать книгу Wo Marx Recht hat - Fritz Reheis - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Grundwiderspruch
ОглавлениеMarx ist davon überzeugt, dass dieses System der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen nicht auf Dauer bestehen kann, und zwar nicht einfach, weil es als ungerecht empfunden würde, sondern weil es an einem inneren Grundwiderspruch leidet, der diesem System mit der Zeit immer mehr von innen heraus die Grundlage entzieht: Es ist der Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und dem privaten Charakter der Aneignung der Produkte – einschließlich des Kommandos über die Produktion und die Verwendung des Mehrwerts. Dieser Grundwiderspruch ist in mehrfacher Hinsicht erfahrbar.
Erstens zeigt sich der Grundwiderspruch als Widerspruch zwischen Gebrauchswert |41|und Wert. Besonders deutlich wird dieser Widerspruch, wenn Gebrauchswerte vernichtet werden, um Werte zu retten, wie dies bei der Produktion auf Verschleiß der Fall ist – oder bei Abwrackprämien. Etwas Ähnliches ist der Fall, wenn ein zunehmender Teil des Sozialprodukts für die Vorsorge gegen oder die Reparatur von systembedingten Schäden statt für die Verbesserung der Lebensqualität verwendet wird.
Zweitens zeigt sich der Grundwiderspruch als Gegensatz zwischen der Ausdehnung der Produktion und der Begrenztheit des Konsums: Einerseits werden durch das Interesse der Kapitaleigentümer am Mehrwert und ihre Konkurrenz um möglichst große Marktanteile immer mehr Produkte hergestellt, andererseits ist durch das Bestreben der Kapitaleigentümer, die Arbeitskosten möglichst niedrig zu halten, die Kaufkraft der Lohnabhängigen stets zu knapp für den Absatz des gesamten produzierten Warenberges. Genau dadurch nämlich, dass jeder Unternehmer – individuell vernünftig – die Produktion ausdehnt und Kosten einspart, verschärft er – gesellschaftlich unvernünftig – die Situation für alle anderen. Deshalb kann diese Seite des Widerspruchs auch als Widerspruch zwischen individueller und kollektiver Vernunft bezeichnet werden. Er mündet zwangsläufig immer wieder in wirtschaftliche Krisen (vgl. Kapitel 6).
Je mehr sich schließlich der Grundwiderspruch im Laufe der Entwicklung des Kapitalismus verschärft, desto offensichtlicher wird die dritte Erscheinungsform des Grundwiderspruchs: der Widerspruch zwischen dem Verhältnis der Arbeit zur Natur und dem zur Gesellschaft. Einerseits werden die Kräfte, mit denen der Mensch die Natur bearbeitet, also Werkzeuge, Technologien etc., immer weiter entwickelt, andererseits bremsen die sozialen Verhältnisse, unter denen gearbeitet wird, diesen Fortschritt immer stärker. Dieser Widerspruch drängt nach Marx zu seiner revolutionären Überwindung (vgl. Kapitel 7).
Wichtig ist, dass diese drei Erscheinungsformen des Grundwiderspruchs Konsequenzen der spezifischen Form der Arbeitsteilung im Kapitalismus sind. Die vergesellschaftete Arbeit, welche die einzelnen Waren mit ihren Gebrauchswerteigenschaften herstellt, wird – außer in der innerbetrieblichen Organisation – nicht gesellschaftlich organisiert, sondern privat verausgabt. Der gesellschaftliche Zusammenhang der Einzelarbeiten wird nicht von vornherein geplant, sondern stellt sich erst im Nachhinein hinter dem Rücken der Menschen her – oder auch nicht. Theoretisch könnte der Grundwiderspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung nun von beiden Seiten der Arbeit her aufgelöst werden: durch eine Privatisierung der Produktion oder eine Vergesellschaftung der Aneignung. Die erste Möglichkeit scheidet für Marx allerdings aus, da sie mit einer Rückführung von Arbeitsteilung und Technisierung einhergehen müsste. Historischen Fortschritt konnte sich |42|Marx, wie wohl die meisten seiner Zeitgenossen, nur als fortschreitende Befreiung des Menschen von überflüssigen Zwängen vorstellen, und dies erfordert eben immer auch eine fortgesetzte Steigerung der Produktivität der Arbeit. Für Marx kam nur die zweite Möglichkeit in Frage: dass auch die Aneignung der Produkte – einschließlich der Verfügung über die Produktionsmittel, des Kommandos über die Produktion, also der Gestaltung des Arbeitsprozesses und der Verwendung des Mehrwerts und damit der Zukunft von Arbeit und Konsum – in die Hand der Gesellschaft gelegt werden müsse.