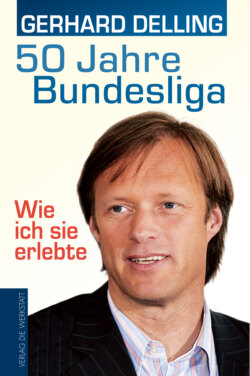Читать книгу 50 Jahre Bundesliga – Wie ich sie erlebte - Gerhard Delling - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление02
Für drei Mark auf den Stehplatz
Der erste Spieltag der Premierensaison
Juni 1963 – der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, ist zu Gast in der Bundesrepublik und hält seine berühmte Rede in Westberlin, die in dem noch berühmteren Satz gipfelt: »Ich bin ein Berliner!« Ein bedeutendes Ereignis für die ganze Republik und vor allem für die Berliner, die abgeschnitten durch die Zonengrenze und die Mauer dauerhaft auf Unterstützung – vor allem auch moralischer Natur – angewiesen waren. Auch deshalb waren überragende 300.000 Menschen zum Ort des Geschehens gekommen, um dem US-Präsidenten zuzuhören.
Und ungefähr genauso viele Zuschauer pilgerten rund zwei Monate später zum Auftakt der Fußball-Bundesliga in die acht Stadien. Noch war Konrad Adenauer Kanzler der Bundesrepublik – er sollte im Oktober des Jahres Platz machen für Ludwig Erhard. Erhard galt bekanntlich als Vater des deutschen Wirtschaftswunders. Aber selbst der große Visionär hätte sicherlich nicht daran geglaubt, welch wichtiger Wirtschaftsfaktor die Fußball-Bundesliga in Deutschland einmal darstellen würde.
Alles begann am Samstag, dem 24. August 1963. Ein strahlend schöner Tag! Auch bei uns im hohen Norden schien die Sonne. Also ging es frühmorgens raus auf die Straße zum Kicken. Wobei es uns auch nicht gestört hätte, wenn es aus Kübeln geschüttet hätte. Wir haben jeden Tag auf der Straße gespielt, bei Wind und Wetter. Alle Kinder, die so gerade laufen konnten, waren dabei, Jungs wie Mädchen. Davon, dass an diesem Samstagnachmittag der Anpfiff zur Bundesliga erfolgen sollte, hatte ich, damals viereinhalb Jahre alt, zwar schon mal etwas gehört, aber welche Bedeutung dieser Tag für Fußball-Deutschland haben sollte, das war in meiner kleinen Erlebniswelt noch nicht angekommen.
Grafikprogramme gab’s noch nicht: Diese zusammengeklebte Karte präsentierten die Zeitungen ihren Lesern als Übersicht zu den Spielstätten der ersten Bundesligasaison.
Es gab Anfang der sechziger Jahre gerade einmal acht Millionen Fernseher in Deutschland. Wir gehörten zu den Glücklichen, die bald ein TVGerät zu Hause hatten. Bei wichtigen Fernsehereignissen wurde es voll bei uns, denn dann kamen die Nachbarn zu Besuch, die noch keinen Fernseher in der Wohnstube stehen hatten. So wie vier Jahre später, als nach dem Tod Konrad Adenauers die Trauerfeier live im Fernsehen übertragen wurde.
Am Tag des Bundesliga-Starts mussten wir zur Sportschau-Zeit am frühen Abend keine zusätzlichen Stühle aufstellen, denn die Spiele wurden schlichtweg nicht übertragen. Das ging schon allein deshalb nicht, weil die Partien in der ersten Bundesliga-Saison um 17:00 Uhr begannen und die Sportschau um 17:45 Uhr auf Sendung ging. Erst am Sonntag gab es in der ARD ein paar bewegte Bilder zu sehen, allerdings ohne Kommentar und ohne Ton. Ernst Huberty hat einmal eingestanden: »Auf die Bundesliga waren wir nicht vorbereitet.« Erst ab 1965 wurden auch in der Sportschau am Samstag zumindest drei Spiele gezeigt.
Am späten Abend des ersten Bundesliga-Spieltags, als ich schon längst im Bett lag, haben wir dann doch noch Fernsehbesuch bekommen. Denn im Aktuellen Sportstudio im ZDF, das pünktlich mit dem Beginn der Bundesliga auf Sendung gegangen war, konnte man Spielberichte vom ersten Spieltag verfolgen.
Auf der Suche nach dem ersten Tor
Borussia Dortmund, damals auch die »Kohlenpott-Brasilianer« genannt, war als amtierender Deutscher Meister in die Saison gestartet. Ehre, wem Ehre gebührt: Der BVB schoss auch in der Partie bei Werder Bremen das erste Tor der Bundesliga-Geschichte. Die Gelehrten streiten sich noch immer um den exakten Zeitpunkt. Manche sagen, es sei bereits nach ungefähr einer halben Minute gefallen, andere sprechen von ca. 50 Sekunden.
Friedhelm, genannt »Timo«, Konietzka hieß der Schütze. Es soll ein schönes Tor gewesen sein. Das sagen jedenfalls die, die dabei waren im Bremer Weserstadion. Es gibt nämlich keine Filmaufnahmen von diesem historischen Treffer. Die einzige Kamera, die im Einsatz war, war noch nicht fertig aufgebaut. Es gibt noch nicht einmal ein Foto von dem Tor. Denn weil Dortmund arg ersatzgeschwächt in die Partie gegangen war, erwarteten die Fotografen eher einen Treffer von Werder und hatten sich fast alle hinter dem Gehäuse von BVB-Keeper Hans Tilkowski postiert. Es gibt lediglich Bilder von der Entstehung des geschichtsträchtigen Treffers – und vom Jubel der Dortmunder Spieler, als der Ball schon im Netz zappelte.
Man muss sich das mal vorstellen. Heute ist jeder x-beliebige Treffer mehrfach in Zeitlupe zu sehen, und die Fotografen schicken Dutzende von Bildern sofort von ihrem Standort aus in die Redaktionen. Auf YouTube kann man sich im Internet Tausende von herrlichen Toren anschauen, aber ausgerechnet diesen Treffer nicht.
Der Moment nach dem ersten Tor in der Geschichte der Bundesliga: Die Dortmunder Lothar Emmerich (vorne) und Timo Konietzka jubeln, die Werder-Spieler liegen geschlagen am Boden. Ein Foto von diesem historischen Treffer selbst konnte trotz intensiver Recherchen nicht gefunden werden.
Für mich ist das bis heute ein echtes Ärgernis. Ich habe ein großes Faible für historische Aufnahmen, und wir hätten natürlich schon des Öfteren nur zu gern in der Sportschau das erste Tor der Bundesliga-Geschichte gezeigt. Wir haben wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um an bewegte Bilder oder wenigstens an ein Foto von Konietzkas Treffer zu kommen. Keine Chance.
Der Torschütze selbst hat sogar eine Prämie ausgesetzt für denjenigen, der ihm ein Foto davon liefert. Auch das war vergebens. Die Recken von damals haben das Tor Jahre später noch einmal nachgestellt. Da waren es aber alles schon Herren über 60. Und es dauerte ziemlich lange, bis das legendäre erste Bundesligator – im doppelten Wortsinn – im Kasten war.
So bleibt all denjenigen, die nicht dabei waren, nur die Beschreibung des Ruhrpott-Kickers Konietzka selbst vom ersten Tor der Bundesliga-Geschichte: »Wir spielten mit die Borussia in Bremen. Anstoß wir. Franz Brungs spielt auffe linke Seite Charly Schütz an. Der weiter auf Emmerich. ›Emma‹ kloppt dat Leder Vollspann inne Mitte. Mit die rechte Hufe hau ich dat Ding rein – 1:0.«
Die Fans strömen in die Stadien
Zum Spiel in Bremen, das Werder letztendlich noch mit 3:2 gewonnen hat, waren 32.000 Zuschauer gekommen. Im Schnitt besuchten 37.500 Fans die acht Spiele am ersten Spieltag. Schon das war gleich ein Riesenerfolg und hatte natürlich damit zu tun, dass die Fußballanhänger neugierig waren auf dieses neue Qualitätsgebilde Bundesliga. Endlich konnte man auch im Norden die Stars aus dem Süden sehen. Und umgekehrt freuten sich die Anhänger in München und Nürnberg auf Uwe Seeler & Co. aus Hamburg, Bremen oder Braunschweig.
Aber es hatte vielleicht auch damit zu tun, dass damals fast alle Stadien mitten in der Stadt und nicht auf der grünen Wiese an der Stadtgrenze lagen. Die Fans kamen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn. Es gab überwiegend Stehplätze, und die Eintrittspreise lagen damals zumeist unter drei Mark. Das kommt einem unglaublich wenig vor. Aber ein Arbeiter verdiente in den frühen sechziger Jahren auch gerade einmal um die 600 Mark brutto. Und in den wenigsten Familien verdienten die Frauen etwas dazu. Dass die Frauen mit ins Stadion gingen, war übrigens auch eher eine Seltenheit. Fußball war bei der Gründung der Bundesliga eine ziemliche Männerdomäne.
Das Catering steckte noch in den Kinderschuhen. Man ging ins Stadion, um Fußball zu schauen. Wenn die Schlangen an den Toiletten nicht allzu lang waren, dann blieb in der Halbzeitpause gerade noch Zeit, um sich eine Bratwurst zu holen. Denn von der zweiten Halbzeit wollte man natürlich keine Sekunde verpassen. Und die VIP-Logen waren – zum Glück – auch noch längst nicht erfunden worden.
Knapp 20 Jahre später war ich einmal beim englischen FA-Cup-Final im Londoner Wembley-Stadion. Da saßen die Honoratioren in einem Glaskasten beim Dinner zusammen, mit bester Sicht auf das Spielfeld. Aber die meisten interessierten sich offensichtlich mehr für die Speisenfolge als für das unglaublich spannende Match zwischen den Queens Park Rangers und Tottenham Hotspur. Mein Chef Armin Hauffe sagte damals: »Wenn das bei uns auch so kommt, dann hat der Sport verloren.« Ich konnte überhaupt nicht fassen, was ich dort sah. Und es ist heute für mich noch so, dass ich in der Halbzeit zwar gern einen kleinen Verpflegungsstop einlegen mag, wo es möglich ist, aber alles daran setze, auch ja keine Sekunde des Spiels zu verpassen.
»Ausländer« aus Buxtehude
Übrigens bekam man damals fast ausschließlich gute deutsche Fußball-Hausmannskost geboten. Während heute im Kader eines Bundesligisten zumeist ein Dutzend ausländischer Profis stehen, waren es vor 50 Jahren gerade einmal drei Fußball-Gastarbeiter, die am ersten Spieltag in der neuen Bundesliga aufliefen: Der Österreicher Wilhelm Huberts schnürte die Fußballstiefel für Eintracht Frankfurt, der Niederländer Jakobus Prins stand beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag und der geniale Jugoslawe Petar »Radi« Radenkovic bei 1860 München im Tor. Gert »Charly« Dörfel, legendärer Linksaußen und Stimmungskanone beim Hamburger SV, zählte allerdings noch einen dazu: »Wir waren zehn Hamburger in der Mannschaft und ein Ausländer – das war Jürgen Kurbjuhn aus Buxtehude.« (Das ist eine Kleinstadt direkt vor den Toren Hamburgs!)
Die meisten der insgesamt etwa 300.000 Zuschauer am ersten Bundesliga-Spieltag sahen übrigens die Partie von Hertha BSC im Berliner Olympiastadion. 60.000 Fans waren Zeuge des 1:1-Unentschiedens der Hertha, bei der ein gewisser Otto Rehhagel als beinharter Verteidiger spielte, gegen den damaligen Rekordmeister 1. FC Nürnberg. Selbst zu Preußen Münsters 1:1 gegen den haushohen Favoriten Hamburger SV waren 30.000 Zuschauer gekommen. Als »harte Nuss« bezeichnete Uwe Seeler den Traditionsklub aus Westfalen. »Uns Uwe«, Deutschlands mit Abstand bester Stürmer, wurde zumeist von mindestens zwei Preußen-Verteidigern eskortiert und konnte sich deshalb völlig überraschend an diesem ersten Spieltag nicht so richtig in Szene setzen.
Der höchste Sieg gelang dem Meidericher SV, wie der MSV Duisburg damals noch hieß. Die Mannschaft von Trainerlegende Rudi Gutendorf gewann mit 4:1 auswärts beim Karlsruher SC. Helmut Rahn, Schütze des Siegtors beim WM-Finale 1954, hatte zum zwischenzeitlichen 3:0 getroffen. Der »Boss« war nach einem dreijährigen Engagement in den Niederlanden beim Sportclub Enschede extra zum Start der Bundesliga nach Deutschland zurückgekehrt.
Der erster Doppeltorschütze der Bundesliga hieß übrigens Werner Krämer und spielte für den MSV. Er traf nach einer knappen halben Stunde zum 1:0 gegen den Karlsruher SC und erzielte seinen zweiten Treffer zum 4:1-Endstand in der 88. Minute. Zwei Minuten vor Timo Konietzka, der in Bremen nach seinem legendären ersten Bundesligatreffer in der Schlussminute zum zweiten Mal traf. Insgesamt fielen bei der Premiere der Bundesliga 22 Treffer. Tabellenführer war aber trotz des 4:1-Siegs nicht der MSV Duisburg, sondern der 1. FC Köln! Dabei hatte der FC gegen Saarbrücken nur mit 2:0 gewonnen. Genauso wie der FC Schalke 04, der mit dem gleichen Ergebnis den VfB Stuttgart bezwang.
Damals gingen die Uhren noch anders, bzw. es wurde anders gerechnet. Hochoffiziell festgehalten in Paragraf 27 a des DFB. Danach war nicht die Tordifferenz ausschlaggebend, sondern der Torquotient. Dabei wurden die erzielten Treffer durch die Gegentore geteilt, und je weniger dabei herauskam, desto besser platziert war die Mannschaft. Geändert wurde diese Regel in Deutschland erst zur Saison 1969/70. Seitdem ist auch in der Bundesliga die Tordifferenz bei Punktgleichheit entscheidend.
Den FC Bayern München konnte man übrigens lange suchen in der Tabelle des ersten Bundesliga-Spieltags. Der Rekordmeister war nämlich tatsächlich bei der Premiere nicht dabei. Die Bayern hatten die Saison 1962/63 in der Oberliga Süd als Dritter beendet, hinter dem Stadtrivalen 1860 München, aber noch vor den Gründungsmitgliedern der Bundesliga aus Karlsruhe, Stuttgart und Frankfurt. Da die »Löwen« somit qualifiziert waren, sprach sich der DFB dagegen aus, die Bayern zur Bundesliga zuzulassen. »Das Gremium war der Auffassung, dass es nicht ratsam erscheint, zwei Vereinen am gleichen Ort eine Lizenz für die Bundesliga zu erteilen«, hieß es in der offiziellen Begründung.