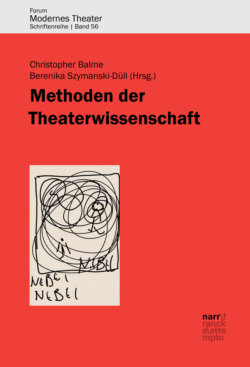Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 30
2) Aushandlung zwischen Eigenem und Fremdem
ОглавлениеDennoch erschließen sich die Bedingungen und Produktionsmittel historischer Praxis nicht unmittelbar. Im praktischen Experimentieren, in Workshops, Proben, Theateraufführungen, wird man beständig gezwungen, das ‚Eigene‘ und das ‚Fremde‘ gegeneinander/miteinander auszuhandeln und auch die Differenzerfahrung auszuhalten. Wenn man sich mit philosophischen und ästhetischen Konzepten, die im Kunstdiskurs und in der Kunstpraxis des 18. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt haben, befasst, dann fällt es im Denken erst einmal nicht schwer, die abstrakten Begriffe an eigenen Theoriekonzepten, am gängigen Diskurs der eigenen Zeit abzugleichen. Unsere akademische Ausbildung hat den Kritikmuskel trainiert und ausgedehnt, so dass wir uns leicht tun mit einer differenzierten Argumentation. Schwieriger ist es, die Aufführungserfahrung im historischen Gewand, die ‚historisierende Praxis‘, mit den inneren ästhetischen Gradmessern in Einklang zu bringen. Der ästhetische Lustgewinn stellt sich mal mehr, mal weniger ein. Auf den ersten Blick, im ersten Anhören, erschließen sich nicht alle Momente, alle Ebenen der Aufführung sofort. Manches erscheint sehr befremdend, hölzern, unpassend, eben unzugänglich und fremd.
In der historisierenden Aufführung von Pygmalion1, die das Forschungsprojekt Performing Premodernity experimentell erarbeitet und in mehreren öffentlichen Aufführungen zur Diskussion gestellt hat, ging es darum, die Passion des Künstlers mit historischen Aufführungsmitteln auszudrücken und dabei Jean-Jacques Rousseaus kunsttheoretische Vision des Melodramas im Werk selbst und der historisierenden Praxis aufzusuchen. Für mich funktionierte das ästhetische Erleben in den Projekt-Aufführungen nur eingeschränkt. In bestimmten kurzen Momenten, wenn die historisierende Deklamation des Akteurs (des Sängers João Luís Paixão als Pygmalion) einen musikalischen Flow erreichte und fast schon in Gesang überging, gelang es, mich ästhetisch anzurühren. Wenn aber zum Beispiel in der Musik ein Klopfen zu hören war und Pygmalion gleichzeitig den Hammer nahm und im gleichen Rhythmus schlug, dann konnte ich diese inszenatorische Redundanz schwer ohne Ironie hinnehmen. Es stellte sich jedoch heraus, dass ausgerechnet diese kleine Aktion in der Original-Partitur so von Rousseau verzeichnet und auch die Musikpassage von ihm selbst komponiert ist2. Wie geht man damit um?
Abb. 3:
Pygmalion von Jean-Jacques Rousseau, 2015, Schlosstheater Český Krumlov. João Luís Paixão als Pygmalion. Foto: Performing Premodernity.
Der Vorschlag wäre, diese Herausforderung anzunehmen und zu diskutieren, ob die von mir schlecht zu akzeptierende Doppelung des Hämmerns nicht doch anders wahrgenommen werden kann. Können wir vielleicht an den Punkt kommen, zu sagen: „Aha, hier ist eine Verbindung von Musik und Geste, die eigentlich genau im Zentrum von Rousseaus Denken ist.“3 Dann würde also die historische Quellenarbeit und Kritik die unmittelbare ästhetische Erfahrung anders konditionieren, die Analyseebene immer mitreflektierend.4 Wir könnten dann annehmen, dass Rousseau diesen Moment als Signifikant oder als Indizierung dieser Brücke verwenden wollte. Die Rückbesinnung auf die praxeologische Basis hilft hier zum einen, die eigene ästhetische Wahrnehmung als solche überhaupt zu markieren, und gleichzeitig zu einer Artikulation und Reflexion der fremdartigen ästhetischen Wahrnehmung zu kommen. Das Unbehagen und die Fremdartigkeit machen dann Sinn in der Abgleichung und Verhandlung mit bereits Gewusstem und Erfahrenem.