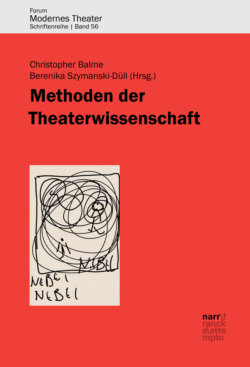Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 40
Theater und theatrale Praktiken als Forschungsobjekt
ОглавлениеGegenstände der Forschung, die sich mit Theater einschließlich Tanz, Musiktheater, Performance, Figuren-, Objekt- und Medientheater befasst, sind die szenischen Künste und Praktiken im weiteren Sinne. Damit können, eine Einteilung von Rudolf Münz aufgreifend, außer dem institutionalisierten repräsentativen ‚Kunsttheater‘ auch die komödiantischen Spieltraditionen der ‚Theaterkunst‘, sowie das im Alltag zu beobachtende ‚Lebenstheater‘ und schließlich die inszenatorischen Praktiken des ‚Nicht-Theaters‘ betrachtet werden, die ihren theatralen Charakter verbergen oder explizit leugnen, um ihre soziale, politische, religiöse, philosophische, ökonomische, juridische oder auch medizinische Wirkungsmacht nicht zu gefährden.1 Wie diese Kategorien bereits nahelegen, hat theaterwissenschaftliche Forschung mit szenischen und ostentativen, das heißt auf Beobachtung ausgerichteten Praktiken und Künsten zu tun, also mit dem mehr oder weniger expliziten Bezug auf ein Publikum, auf einen oder mehrere Zuschauer*innen. So geht es stets um Verhältnisse der Beobachtung, die eine komplexe Referentialität entfalten und selbst zum Gegenstand weiterer Beobachtung werden können. Die Fokussierung auf das Ereignis und die Situation der ‚Aufführung‘ vor Publikum ist jedoch zu erweitern um eine Perspektive, die auch die Konzeption und mögliche Vorbereitung durch Proben sowie die Gestaltung des Spielortes und der körperlichen Erscheinung der Akteure umfasst. Die dabei eingesetzten Mittel dienen insgesamt der ‚Inszenierung‘, mit der etwas auf jeweils besondere Weise zur Erscheinung gebracht wird.2
Theatrale Praktiken sind allerdings nicht auf die professionelle Ausübung einer oder mehrerer Künste beschränkt, sondern schließen immer auch alltägliche Verhaltensweisen und Kommunikationsformen mit ein, jenseits des illusionären Spiels mit literarisch festgelegten Rollen und den darauf basierenden Fiktionen. Hier ist allgemeiner von einem anthropologischen Potenzial auszugehen, von Prozessen des Spiels, der Verwandlung und Verstellung, der Nachahmung und verändernden Wiederholung menschlicher Verhaltensweisen. Diese sind keineswegs abhängig von einer perfekten und institutionalisierten Präsentation künstlerischer Formen, wie es einer auf das europäische bürgerliche Kunsttheater verengten Sichtweise noch erscheinen konnte.3 Auch der Begriff des künstlerischen Werkes ist zu relativieren zugunsten einer erweiterten Perspektive theaterwissenschaftlicher Forschung, die vielmehr auf Praktiken, Prozesse und Kontexte ausgerichtet ist. Wenn etwa der Leistung des Schauspiels, des Tanzes, der Deklamation, des Gesangs oder auch der Inszenierung insgesamt aufgrund hoher Virtuosität und Originalität eine eigene künstlerische Qualität und Werkhaftigkeit zugesprochen wird, bleibt diese dennoch an ein Wechselspiel von produktiven und rezeptiven Prozessen gebunden, die mit der traditionellen Idee eines individuellen, souverän geschaffenen Werkes nur unzulänglich zu erfassen sind.
Die unvermeidliche Einsicht, dass der Gegenstand theaterwissenschaftlicher Forschung sich auffächert in eine Vielheit komplexer Praktiken und Verhältnisse, bedarf gerade im Hinblick auf die Entwicklung und Anwendung fachspezifischer Methoden einer kritischen Reflexion.4 So bleibt auch die Übertragung von Methoden aus anderen Disziplinen auf die Erforschung von Theater problematisch, wenn sie nicht deren besondere Voraussetzungen berücksichtigt. Verfahrensweisen etwa der aus der Linguistik stammenden Semiotik oder auch philologische Methoden der quellenkritischen Interpretation von Texten, einschließlich hermeneutischer und dekonstruktiver Techniken der Analyse, mögen für die theaterwissenschaftliche Forschung weiterhin wichtige Elemente sein, reichen aber längst nicht aus zur Erfassung ihres spezifischen Gegenstands und der dafür adäquaten Methoden. Diese Einsicht hängt eng mit der Geschichte des Faches zusammen, das sich erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts allmählich von den Philologien zu emanzipieren begonnen hat.5 Nach einer in den letzten Jahrzehnten bestimmenden Phase der Anwendung von Kategorien wie Theatralität und Performativität auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und nach zahlreichen mehr oder weniger fruchtbaren Verknüpfungen mit der Methodik anderer Disziplinen stellt sich mittlerweile eher die Frage nach dem methodischen Verständnis der Theaterwissenschaft selbst und dem Wechselverhältnis zwischen der Geschichte des Faches und der Historizität der in ihm untersuchten Praktiken.6 Schon von daher ergeben sich vielfältige Bezüge der theaterwissenschaftlichen Forschung zu Archiven, die traditionell vor allem der Aufbewahrung schriftlich fixierter Informationen dienen, seit einigen Jahrzehnten aber ihrerseits einem tiefgreifenden strukturellen Wandel unterliegen.
Bei den für Theater besonders relevanten Dokumenten, also etwa den originalen Manuskripten von Spieltexten oder Inszenierungskonzepten, aber auch bei eher indirekten Quellen wie z.B. Hinweisen auf alle mit Aufführungen verbundenen organisatorischen, ökonomischen, politischen, juristischen oder auch persönlichen Aspekte bedarf es nicht nur einer quellenkritischen Lektüre und Interpretation, sondern stets auch der Rekonstruktion der jeweiligen Kontexte, um Rückschlüsse auf tatsächliche Aufführungen und die damit manifestierten theatralen Praktiken ziehen zu können. Insofern ist gerade eine Theaterwissenschaft, die von Aufführungen, Inszenierungen und konkreten szenischen Praktiken ausgeht, immer auch auf Archive verwiesen, die Indizien, Spuren und Überreste von solchen Prozessen und Ereignissen enthalten können. Entscheidende Bedeutung haben dabei die Begriffe und Kategorien, die der jeweiligen Sammlung, Ordnung und Erschließung von Dokumenten und Materialien zu Grunde liegen. Von dem besonderen Fall fachlich spezialisierter Sammlungen einmal abgesehen, sind allerdings die für Theater, Tanz, Performance etc. angesetzten Ordnungskriterien in vielen Archiven so unspezifisch, dass eigentlich relevante Informationen nicht oder nur sehr umständlich zu erhalten sind. So gibt es beispielsweise im international verbreiteten, zur Erfassung von Publikationen verwendeten Dezimal-Klassifikationssystem nach Dewey für den Bereich Theater keine mit den anderen Künsten gleichrangige Positionen, allenfalls die Möglichkeit der nachgeordneten Eingruppierung in der unspezifischen Rubrik „Sport, Spiele, Unterhaltung“.7 Auf die damit schon absehbare – mit der Ausweitung des Archivbegriffs auf Mediatheken aller Art noch extrem gesteigerte – Problematik der Zugänglichkeit von Informationen, welche gerade die für theaterwissenschaftliche Forschungsarbeit bedeutenden Dokumente und Materialien betreffen, wird noch einzugehen sein.
Vorläufig ist festzuhalten, dass Theaterwissenschaft als kritische Forschung darauf angewiesen bleibt, ihr Verhältnis nicht nur zu den benachbarten Disziplinen der Literatur- und Kunstwissenschaften sowie – im Hinblick auf die sozialen und sonstigen Kontexte von Theater – der Kultur-, Religions- und Sozialwissenschaften zu reflektieren.8 Darüber hinaus ist in methodischer Hinsicht zumal die Perspektive der Geschichte und Historizität theatraler Praktiken und aller damit verbundenen Phänomene in ihrem Verhältnis zur Analyse von Inszenierungen und Aufführungen zu berücksichtigen und immer wieder neu zu bestimmen. Damit ist zugleich der Einsatzpunkt benannt, von dem aus die Frage nach dem Archiv in seiner Bedeutung für theaterwissenschaftliche Forschung, für ihre Selbstreflexion als Wissenschaft im Hinblick auf ihre spezifischen Gegenstände, Erkenntnisweisen, Methoden und (Selbst-)Begründungen zu erläutern bleibt.