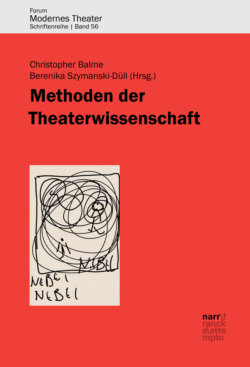Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 41
Herausforderungen des Archivs
ОглавлениеKaum eine Einrichtung des kulturellen Gedächtnisses ist von den technischen Entwicklungen der Gegenwart so stark betroffen wie das Archiv.1 Wurde darunter in früheren Epochen noch der privilegierte Sicherungsort verstanden, an dem einmalige Schrift-Dokumente zur Legitimation von Macht- und Besitzansprüchen aufbewahrt und in Streitfällen konsultiert werden konnten, unterliegt der Status von Archiven heute einer weitgehenden Technisierung.2 Die Arbeit der Erfassung, Speicherung und Zugänglichmachung von Dokumenten folgt dabei einer Logik von Sachzwängen, die sich verselbständigt haben, von außen oft kaum noch nachzuvollziehen sind. Gründe dafür liegen auch in den Paradoxien der Reproduktionstechnik, die sich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts abzuzeichnen begannen. So hat einerseits, wie von Walter Benjamin analysiert, die gesteigerte technische Reproduzierbarkeit zur Entwertung des Originals beigetragen, dessen Informationswert sich in zahllosen, immer leichter herzustellenden und weitgehend identischen Kopien abgelöst hat von der Materialität, die ein von Hand geschriebenes oder persönlich unterzeichnetes Unikat noch besaß.3 Andererseits gewinnt das historisch zertifizierte Original durch Reproduktion und Digitalisierung vielfach wieder eine Aura,4 die auf die Legitimation des Archivs als solches zurückwirkt. Zugespitzt könnte man sagen, dass Archive mit der Aura des Originals auch sich selbst erhalten, das heißt: die symbolische Ordnung der Urkunde, des Ursprünglichen und der Ableitung von Sinn und Legitimität aus der Beglaubigung eines echten Anfangs (arché), insbesondere bei Handschriften als Dokumenten einer persönlich adressierbaren Urheberschaft.
Wenn die beschleunigte Kommunikation digitaler Daten die faktisch gegebene Distanz der allermeisten Menschen zu den Dokumenten des Besitzes, des Wissens und der Macht potenziell aufzuheben vermag, so gibt es gleichwohl noch symbolische Schwellen des Zugangs, der an Privilegien wie etwa eine bestimmte Vorbildung und institutionell vermittelte Kompetenzen gebunden bleibt. Vereinfacht gesagt, ist die genaue und hochspezialisierte Kenntnis des Gesuchten die Voraussetzung dafür, überhaupt etwas finden zu können. Diese Beschränkung der Nachfrage durch erschwerte Zugänglichkeit sichert zumindest einem traditionellen Verständnis nach die Exklusivität und damit zugleich den Wert von Archiven. Mit der Schwelle der Digitalisierung von Dokumenten aller Art kommt dieses labile Gleichgewicht zwischen beschränktem Angebot und limitierter Nutzung jedoch stärker unter den Einfluss von Marktmechanismen und einer dementsprechenden Logik der Verwertung. Dies gilt besonders für Dokumente und Materialien, die bereits durch Technologien der Reproduktion entstanden sind, wie Fotos, Filme, Videos und andere audiovisuelle Medien.5 Durch deren exponentiell zunehmende Verbreitung verwandeln sich auch viele traditionelle Archive in Mediatheken, die schon zur bloßen Aufbewahrung und Erhaltung ihrer Sammlungen einen weitaus größeren Aufwand betreiben müssen als bei Dokumenten auf Papier.
Die neuen Möglichkeiten der technischen Aufzeichnung und Reproduktion auch flüchtiger Prozesse und Ereignisse fordern ihren Preis, der aber nicht einfach auf diejenigen verteilt werden kann, die sie (noch) in Anspruch nehmen, sondern die Archive strukturell gefährdet und in Abhängigkeit von Strategien der Vermarktung bringt. Die Kosten für Digitalisierung wie auch für die Erschließung und adäquate Präsentation der Digitalisate werden bislang durch öffentliche Subventionen oder Forschungsgelder allenfalls punktuell kompensiert, obwohl der Bedarf ständig steigt. Hinzu kommt vor allem im Hinblick auf audiovisuelle Dokumente eine restriktive Gesetzeslage, wonach die Digitalisierung in vielen Fällen nicht einmal zum Zweck der Erhaltung erlaubt ist.6 Andererseits müssen die Archive erst noch die zumeist aufwändige und schwierige Klärung von Urheber- und Verwertungsrechten leisten, um Fördermaßnahmen beantragen zu können, die eine öffentliche Publikation bzw. Zugänglichmachung der Digitalisate bereits voraussetzen.
Die hier skizzierten Entwicklungen tragen insgesamt dazu bei, dass der Prozess der Digitalisierung der von Archiven aufbewahrten Dokumente kaum in Gang kommt, während große im Internet präsente Konzerne wie Google oder Youtube mit ihren Suchmaschinen immer mehr Inhalte des kulturellen Gedächtnisses nur in zufälligen Ausschnitten von schlechter Qualität und ohne hinlängliche Kennzeichnung oder gar Kontextualisierung anbieten, gleichzeitig aber mit begleitender Produktwerbung und durch eine umfassende Datenspeicherung jeden einzelnen Suchvorgang bereits kommerziell verwerten. Für die weitere Entwicklung der theaterwissenschaftlichen Forschung ist dies alles von gravierender Bedeutung, insofern die Zugänglichkeit ihrer gerade im Hinblick auf Theater, Tanz und Performance immer häufiger bereits technisch erzeugten Quellen weitgehend forschungsfremden Marktmechanismen unterworfen ist. Diese anhaltende Tendenz, die von den betroffenen Akteur*innen oder Institutionen bisher in ihrer Tragweite noch kaum wahrgenommen und jedenfalls noch zu wenig adressiert wird,7 verschärft die oben schon erwähnten Probleme der Erschließung fachspezifischer Quellen und ihrer inhaltlichen Zugänglichkeit bzw. Auffindbarkeit. Umso wichtiger ist es, dass die dringend notwendigen Schritte der Erschließung von Quellen und Inhalten der Forschung auch methodisch reflektiert werden, um eine dementsprechend adäquatere Organisation entwickeln zu können. Grundlegend dafür ist die elementare Funktion des Archivs als ein sprachliches und kategoriales Ordnungssystem, die hier ebenfalls noch zu berücksichtigen ist.
In seiner Archäologie des Wissens hat Michel Foucault das Archiv nicht mehr primär als Institution und als Sicherungsort für Dokumente und Wissensspeicher interpretiert, vielmehr als „Ordnung des Diskurses“, als ein „System der Formation und Transformation von Aussagen“.8 Diese Ausweitung des Archiv-Begriffs auf eine epistemologische Ebene gewinnt nun an Bedeutung angesichts der Tatsache, dass gerade die nicht nur schriftbasierten Speichermedien einem rapiden Verfalls- bzw. Alterungsprozess ausgesetzt sind. Digitale Medieninhalte bedürfen schon heute der ständigen Umschreibung in jeweils neue digitale Codes. So bedeutet der von Aleida Assmann mehrfach beschriebene beschleunigte „Strukturwandel des kulturellen Gedächtnisses“9 vor allem dessen Transformation in rasch wechselnde, durch technische Entwicklungen (und deren Markterfolg) vorgegebene Codierungsformate, wie auch Hans Ulrich Reck konstatiert: „Digitale Archive sind nicht mehr Orte des Sammelns und Anhäufens, sondern der Rekodierung, Durchkreuzung, Streichung, des semantischen, metatheoretischen Umbaus“10.
Mit der Ablösung von einigermaßen dauerhaften Schriftbeständen durch audiovisuelle Medien und Datenströme haben Probleme der Speicherung und Pflege von Daten-Beständen eine neue Bedeutung erlangt. Neben der Suche nach tatsächlich zur Langzeitspeicherung geeigneten Medien geht es auch um die Frage nach dem Verhältnis von Archivierung und Vergessen, Aufbewahrung und Löschung. Dahinter steht eine grundsätzliche Umwertung des Archivs und seiner möglichen Funktionen, ein „metatheoretischer Umbau“, der insgesamt die Frage nach der Organisation eines kulturellen Gedächtnisses betrifft. Demnach sind es nicht mehr die einzelnen Objekte und Inhalte, die den Wert eines Archivs ausmachen, eher seine Fähigkeit zur unablässigen Selbsttransformation. Diese soll aber nicht etwa auf der Ebene neuer individueller Konzepte (‚top down‘) erfolgen, sondern in einer plural geteilten und vielfältigen Aktivität der ständigen Neuorientierung. Insofern geht auch die Frage nach Zugang (access), als zentrales Thema neuerer Archivtheorien, weit über die übliche Nutzung der Bestände, Sammlungen und Objekte von Archiven hinaus, zielt zugleich auf deren Organisationsstruktur.
Bei der schon seit längerer Zeit anhaltenden und kontrovers geführten Diskussion über die gesellschaftliche Relevanz von Archiven und Archivproblemen wird die Frage des Zugangs zur programmatischen und politischen Forderung: „This needs a new generation of access policies, tools and practices, less collection driven, but directed towards archives as social spaces and records as social entities.“11 So geht es für die Umwertung und Neuorganisation der Archive immer wieder um die Frage nach dem Zugriff, nach der „Partizipation am [Archiv] und dem Zugang zum Archiv, zu seiner Konstitution und zu seiner Interpretation.“12 Die Sammlungen selbst sind demnach weniger entscheidend als das, was aus ihnen in Prozessen der sozialen Kommunikation gemacht wird. Inklusion, Selbstermächtigung und eine Agenda der sozialen Verantwortung werden zu Faktoren eines neuen, dem Selbstverständnis der traditionellen Archive oft entgegengesetzten Programms ihrer Umstrukturierung. Auch bisher schon hängt die Bedeutung und Funktion des Archivs als einer eher repressiven oder im Gegenteil eher demokratischen Institution vor allem von seiner Bereitschaft und Fähigkeit ab, Zugänge zu schaffen.13 Dieser Aspekt verschärft sich aber auf extreme Weise im Zeitalter des Internets:
Hat das Archiv traditionell seine Daten vom unmittelbaren Zugriff räumlich eher getrennt gehalten, gibt es diese Archivsperre im Prinzip (und zumal für Hacker) online nicht mehr: Kein Abschluss, sondern ständiges Ein- und Ausgehen. So wird das techno-mediale Gedächtnis entmonumentalisiert.14
Nicht von ungefähr greift Wolfgang Ernst mit dieser Diagnose zum aktuellen Prozess der Umbrüche und strukturellen Herausforderungen der Archive zurück auf Foucaults Gebrauch der Begriffe Monument und Dokument zur Bestimmung einer notwendig methodologischen Umorientierung der Geschichtswissenschaften. Durch den Eintritt in das Zeitalter seiner „techno-medialen“ Reproduzierbarkeit ist demnach insgesamt das kulturelle Gedächtnis nicht mehr darauf ausgerichtet, Monumente der Vergangenheit zu isolieren und als zeitlose Denkmäler kultisch zu würdigen. Aber auch der Status des Dokuments hat sich im Zuge dieser Entwicklungen weitgehend verändert: Die Einzigartigkeit der intellektuellen und insbesondere künstlerischen Schöpfungen, von herkömmlichen Literatur-Archiven noch im Sinne des traditionellen Werkbegriffs als ein zentrales, sinnstiftendes Element ihrer Organisation verstanden, wird abgelöst von einer Orientierung an Prozessen. So hat bereits Foucault die „Infragestellung des Dokuments“ unter Verweis auf die traditionellen Methoden der Archäologie bestimmt: Hatte diese für lange Zeit die Aufgabe, Monumente in Dokumente zu verwandeln, das heißt, diese auf ganz bestimmte Aussagen und Bedeutungen hin interpretierbar zu machen, wäre für die Gegenwart umgekehrt eine Transformation von Dokumenten (zurück) in Monumente zu beobachten, die nun jedoch vor allem immanent zu beschreiben seien, durch die „Bestimmung von Einheiten, Mengen, Serien, Beziehungen in dem dokumentarischen Gewebe selbst“.15 In diesem Sinne wäre auch die von Ernst geforderte „Entmonumentalisierung“ des Gedächtnisses zu verstehen als eine Infragestellung des Dokuments, an dessen Stelle eine Vielzahl von Prozessen und Eigendynamiken tritt. Diese folgt bewusst keiner linearen Logik mehr, wie sie alle großen Erzählungen einer einheitlichen Geschichte noch zu konstruieren versuchten, sondern löst gerade die vermeintlich stets singulären Monumente auf in Serien, Beziehungen und Praktiken.
Das von Foucault begründete Projekt einer strukturalistischen Neubestimmung von Geschichte als primär „methodologisches Feld“16, das eher von Diskontinuitäten, Brüchen und Transformationen bestimmt ist als von homogenen Entwicklungslinien, findet mithin seine Fortsetzung in einer medientheoretischen Infragestellung des traditionellen, von Monumenten und Dokumenten noch gleichermaßen geprägten Archivbegriffs. Dem entspricht zumal die von Foucault angeregte Auffassung der Funktion von Archiven als Diskursordnungen. Auf diese Weise auch methodologisch transparent, würden sie zu Orten eines inklusiven, universal zugänglichen kulturellen Gedächtnisses, das nicht mehr aus isolierten Dokumenten einen übergreifenden Sinn von Geschichte ableitet, sondern, wie Eric Ketelaar betont hat, eine Vielheit von Geschichten zulässt, die aus tatsächlichen Erfahrungen und der Möglichkeit ihrer vielfältigen Deutung resultiert: „where people’s experiences can be transformed into meaning.“17 Die Deutungsmonopole privilegierter Interpreten wären abzulösen durch eine kreative Neugestaltung von kulturellem Wissen auf online-Plattformen, welche die Archive virtuell zugänglich machen und bewusst einer großen Zahl von Nutzern öffnen für eine flexible Kontextualisierung und unablässige Neuinterpretation von Informationen, die als creative commons verstanden werden.18
In den letzten Jahren hat sich gerade im Hinblick auf die Forderung nach einer kollektiven Aneignung von Erfahrungswissen das produktive Potenzial der Künste gezeigt. Künstlerische Praktiken der (Selbst-)Archivierung, Archivkonzeption und -nutzung haben neue Dimensionen der Auseinandersetzung mit Archiven bzw. deren Beständen eröffnet und dabei auch die gesellschaftliche Rolle des Archivs als Ort der Verhandlung von Gedächtnis und Geschichte deutlich gemacht.19 Auch im Bereich von Tanz und Performance wird an unkonventionellen Formen der Archivierung gearbeitet, die jedoch in der vor allem medientheoretisch orientierten Debatte noch zu wenig wahrgenommen werden. Wie schon eingangs bemerkt ist die in den szenischen Künsten bis heute manifestierte kulturelle und gesellschaftliche Praxis in besonderem Maße zeitlich strukturiert, an flüchtige Momente der Aufführung und der kollektiven Rezeption gebunden. Die damit verbundenen spezifischen Potenziale sind durch Techniken der Notation und auch der audiovisuellen Dokumentation nur sehr partiell zu bewahren, bedürfen zugleich der wissenschaftlichen Forschung und der ständigen künstlerischen Aktualisierung. Eine besondere Rolle spielt dabei eben die Verknüpfung und Interpretation von Erfahrungen, die an körperliche Eindrücke und Sinneswahrnehmungen gebunden sind und über die faktischen Ereignisse einer Aufführung weit hinausgehen. So finden etwa Formen der Selbstarchivierung und der Übernahme archivarischer Methoden, wie sie seit den 1960er Jahren vor allem in der Bildenden Kunst entwickelt wurden, zunehmend auch in der aktuellen Praxis der darstellenden, performativen und schauspielerischen Künste Anwendung, wie sich besonders an den mehr oder weniger detailgetreuen Re-enactments ‚einmaliger‘ Ereignisse zeigt.20
Andererseits ist immer häufiger zu beobachten, dass auch schon das Archivieren von Probenprozessen die Struktur künstlerischer Arbeit beeinflussen kann, wenn die dabei gemachten Erfahrungen reflektiert und in neue technische Konzepte überführt werden. Paradigmatisch dafür war das von dem Choreographen William Forsythe auf der Basis seiner Improvisation Technologies mitentwickelte Visualisierungsprogramm Synchronous Objects (ab 2010), das nicht zuletzt dazu diente, die Tänzer*innen stärker eigenverantwortlich in choreographische Prozesse einzubinden.21 Wenn nicht nur das individuelle (Selbst)Archivieren, sondern viel mehr noch die kollektive Nutzung und Weiterentwicklung des neu generierten Wissens zum konstitutiven Bestandteil künstlerischer Arbeit wird, stellt sich die Frage, inwieweit solche Tendenzen auf die Organisation der Archive zurückwirken. Auch von dieser Seite her können sie sich, wie Beatrice von Bismarck es mit Blick auf Archive der Bildenden Künste formuliert hat, als „Speicher des Möglichen und Zukünftigen“ erweisen.22