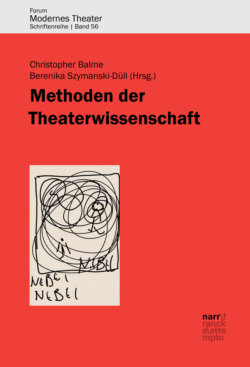Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 33
Transnationale Theatergeschichte(n): Der biographische Ansatz
ОглавлениеBerenika Szymanski-Düll
Historisch betrachtet ist die Geschichte des professionellen Theaters auch eine Geschichte der Mobilität. Bereits seit der Antike ziehen Mimen, Gaukler, Artisten und Schauspieler1 mit ihrer Kunst von Ort zu Ort. Trotz der zunehmenden Etablierung ‚stabiler‘ bzw. ‚stehender‘ Bühnen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts blieb das Theater keineswegs ‚stehen‘; ganz im Gegenteil: Die Revolution auf dem Gebiet des Transportwesens und die Industrialisierung der Verkehrsmittel ermöglichten es Theaterschaffenden, insbesondere seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ihren einschränkten Radius auszuweiten: Zogen die Wandertruppen bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch mit Eseln, Pferden und Karren mühsam von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt, so waren die Dimension als auch die Frequenz der Mobilität mit der Etablierung von Eisenbahnen und Dampfschiffen seit der zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts eine andere. Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Tommaso Salvini – um einige prominente Beispiele zu nennen – spielten nicht nur in Europa, sie bereisten auch andere Kontinente und etablierten sich so zu weltweit gefeierten Stars. Doch auch solche Schauspieler, die nicht zu Stars aufstiegen, bereisten den Globus; so z.B. Daniel Bandmann, der in An Actor’s Tour or Seventy Thousand Miles with Shakespeare seine ausgedehnten Tourneen beschreibt, die ihn u.a. nach Singapur, Shanghai, Melbourne, Calcutta und Bombay führten.2 Mobilität kennzeichnete aber auch das Leben von Theatermenschen, die nicht direkt auf der Bühne standen: Theateragenten, Impresarios, Theaterdirektoren – auch sie waren oftmals in ständiger Bewegung, um neue Stars, spannende Produktionen oder angesagte Stücke aufzuspüren. Darüber hinaus muss in Betracht gezogen werden, dass im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Migration eine bis dato ungekannte Größenordnung annahm und im Vergleich zu den vorhergehenden Jahrhunderten mehrmals um das Zehnfache gestiegen war.3 Unter den zahlreichen Auswanderern, die innerhalb Europas migrierten oder in neue und ihnen fremde Kontinente aufbrachen, befanden sich auch viele Theaterschaffende.
Auch das 20. und das 21. Jahrhundert ist durch Phänomene des Mobilen gekennzeichnet. Und während das Studium theaterhistorischer Quellen zeigt, wie vielfältig und rege die Mobilität im Verlauf der Theatergeschichte ist, wie viele kulturelle Kontakte auf diese Weise einhergingen, wie viele den nationalen Rahmen übersteigende theatrale Netzwerke geknüpft wurden und regen Austausch, multidirektionale Transfers und diverse Übersetzungen nach sich zogen, so muss festgehalten werden, dass in wissenschaftlichen Publikationen die beschriebenen Phänomene nur rudimentär und punktuell aufgegriffen werden, sich vor allem an prominenten Akteuren oder erfolgreichen Dramen und ihren Inszenierungen entlang hangeln. Dies liegt zum einen an der zentralen Rolle der ‚Nation‘ für die Geschichtsschreibung: „Seit der Spätaufklärung wurde sie [die Nation] zum wichtigsten Untersuchungsgegenstand der Historiker“, wie Kiran Klaus Patel festhält, denn „die Geschichtsschreibung hatte selbst wesentlichen Anteil an der Konstituierung und Stabilisierung der Nation als imaginierte Gemeinschaft, als Utopie und appellative Instanz, aber auch als Erfahrungsraum und Handlungsgröße.“4 So stellte in diesem Zusammenhang beispielsweise Marvin Carlson sogar noch im Jahr 2013 fest, dass wichtige Standartwerke der Theatergeschichte oft zwar den Anspruch erheben, universal zu sein, trotzdem jedoch die nationale Perspektive des jeweiligen Autors kaum überschreiten.5 In der geschichts- und sozialwissenschaftlichen Forschung hat sich hierfür der Begriff des ‚methodologischen Nationalismus‘ etabliert, der eine kritische Position einnimmt gegenüber einer auf den Nationalstaat als abgegrenzte und relativ homogene Einheit fokussierten Forschungsperspektive.6
Zum anderen liegt die geringe Beschäftigung mit Phänomenen der Mobilität und ihren Auswirkungen auf das Theater an der Fokussierung der Sesshaftigkeit und dem damit einhergehenden Problem, dass die meisten Archive nach einem nationalstaatlich oder lokalstädtisch organisierten Prinzip strukturiert sind, weswegen mobile Akteure oftmals durchs Raster fallen bzw. selten umfassend erfasst werden. So hebt beispielsweise Peter Schmitt hervor, dass es nicht so sehr am fehlenden Material liege, dass mobile Künstler so selten von der Historiographie berücksichtigt werden, sondern vielmehr am „Selbstverständnis einer Theaterhistoriographie, die im theaterhistorischen Prozeß die Seßhaftigkeit des Darstellers zur zulässigen Norm erhoben hat.“7
Hinzu kommt auch das starke Interesse der Theaterwissenschaft für die Aufführungsgeschichte bzw. Inszenierungsanalyse, in deren Kontext bestimmte Fragestellungen und Aspekte – wie vor allem solche, die außerhalb des Bühnengeschehens liegen und nach Infrastruktur oder den Auswirkungen der Mobilität fragen – oftmals unberücksichtigt bleiben oder lediglich marginal berührt werden.
Da das Interesse der Theaterwissenschaft an kulturellen Verflechtungen und transnationalen Phänomenen in den letzten Jahren zunehmend steigt,8 möchte ich in dem vorliegenden Beitrag einen möglichen methodischen Zugriff thematisieren, der es erlaubt, die Mobilität und ihre Konsequenzen innerhalb der Theatergeschichte zu untersuchen und auf diese Weise transnationale Theatergeschichte(n) aufzudecken. Hierbei werde ich mich nicht auf Inszenierungen oder Theatertexte konzentrieren, sondern auf Individuen und ihre Aktivität selbst. Der von mir gewählte Zugang ist also ein biographischer.9 Hierbei geht es mir jedoch keineswegs um eine detailreiche und faktengesättigte Rekonstruktion von (professionellen) Lebensläufen. Vielmehr sei nach dem epistemologischen Mehrwert gefragt, den biographische Zugänge für eine transnationale Theatergeschichtsschreibung eröffnen. So konstatieren auch Desley Deacon, Penny Russell und Angela Woollacott:
If history is a chronicle of individuals and their communities, transnational history is no less so. Like other approaches to the past, the study of transnational history must be solidly grounded on specific individuals, their ideas, activities and the organizations they create.10
Denn gerade das Studium der Biographien von mobilen Theaterschaffenden, die grenzüberschreitende Lebenserfahrungen und Aktivitäten freilegen, so die Ausgangsthese, bieten eine Möglichkeit, den methodologischen Nationalismus zu überwinden. Das Rückverfolgen ihrer Reise- und Migrationswege, das Aufspüren ihrer Motivationen und Entscheidungen, das Rekonstruieren ihrer Aktivitäten – so z.B. Gründung von Theaterhäusern, Übersetzungstätigkeiten oder Vermittlung von Theaterstücken – erlauben es, transnationale Geschichte(n) aufzudecken: Sie zeigen uns eine Welt von Interaktionen, Verflechtungen und Zirkulationen jenseits nationaler Grenzen, sie zeigen aber auch eine Welt zahlreicher Aushandlungsprozesse; kurz: eine Welt, die verbunden und zugleich gespalten ist. Ein biographischer Ansatz ermöglicht zudem nach Hintergründen, Erfahrungen und der Infrastruktur dieser Prozesse zu fragen.
Im Folgenden möchte ich den biographischen Ansatz anhand von vier Aspekten fokussieren, die miteinander in Verbindung stehen, sich gegenseitig bedingen, und deren Betrachtung einen methodischen Rahmen erlaubt:
1 Mobilität
2 Verknüpfung und Vernetzung
3 Individuelle Perspektive
4 Aushandlung und Produktivität
Das Aufspüren mobiler Biographien in einem transnationalen Kontext, und damit auch die Fokussierung der vier genannten Aspekte, ist in einem vielfältigen Quellenkorpus manifestiert. Denn biographische Spuren und die damit einhergehende agency mobiler Theaterakteure sind in Autobiographien, Tagebüchern, Briefen, Telegrammen ebenso wie in Passeinträgen oder Passagierlisten zu finden. Auch sind Programmzettel, Verträge und vor allem Zeitschriften- und Zeitungsartikel hilfreiche Quellen, in denen sich Informationen über Aufenthaltsorte, Gastspiele, Engagements, Aufführungen und ihre Rezeption wie auch Hintergründe eruieren lassen. Eine der größten Herausforderungen ist hierbei – gemäß der geographischen Mobilität des jeweiligen Akteurs – die sprachliche Vielfalt der Quellen sowie ihre geographische Verteilung durch die Welt und auf verschiedene Archive, die vom Forschenden selbst eine beständige Mobilität verlangen wie auch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Archivkulturen erfordern. Dank zahlreicher Digitalisierungsprojekte der letzten Jahrzehnte ist eine große Vielfalt an Dokumenten, insbesondere aus dem Bereich der Druckerzeugnisse, online zugänglich gemacht worden, so dass Datenbanken wie Readex, ANNO oder ancestry.com Recherche und Studium diverser Quellenbestände von zuhause aus erlauben und den Arbeitsprozess enorm erleichtern. Einige dieser Datenbanken sind kostenfrei bzw. über erworbene Lizenzen der Universitäten zugänglich, andere wiederum kostenpflichtig.