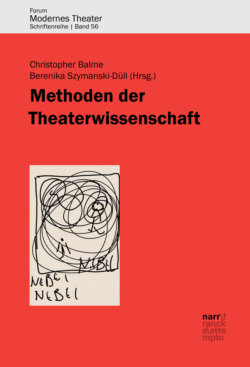Читать книгу Methoden der Theaterwissenschaft - Группа авторов - Страница 34
Mobilität
ОглавлениеBei der Beschäftigung mit mobilen Theaterschaffenden kommt man nicht umhin ihre Mobilität selbst in den Fokus zu stellen. Hierbei rücken insbesondere die Art und Weise, die Dauer als auch der geographische Aspekt ins Zentrum. Dadurch lassen sich beispielsweise beliebte und praktische Transportmittel in Erfahrung bringen: So waren seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts insbesondere Züge wichtige Beförderungsmittel, die sowohl einzelnen Theaterschaffenden die Möglichkeit boten, schnell von A nach B zu kommen, als auch ganzen Truppen. In den Erinnerungen von P. Richards, der den Barnum & Bailey Zirkus begleiten durfte, können wir nachlesen, welches Ausmaß und welche Bedeutung ein solches Transportmittel für die Infrastruktur hatte:
Um einen Begriff von den Dimensionen zu geben, die hier in Frage kommen, erwähne ich, daß der Barnum & Bailey-Zirkus, den ich von New York bis San Franzisko begleitete, nicht weniger als drei Eisenbahnzüge mit je 35 bis 40 Waggons zu seinem Transport benötigt. Der erste Train befördert die Artisten und das Bureaupersonal, der zweite die Tiere mit ihren Wärtern, der dritte die Requisiten, Kostüme, Zelte u.dgl. So geht’s von Stadt zu Stadt, so rasch, aber auch so angenehm und bequem als möglich. John Ringlings Privatwagen, der gleichzeitig als Empfangsraum für Gäste und Zeitungsleute dient, ist beispielsweise der kostbarste und geschmackvollste Luxuswaggon, der je auf Eisenbahnschienen rollte. (Anschaffungskosten: über eine Viertel Million Mark!)1
In den USA handelten beispielsweise Eisenbahngesellschaften mit Theaterkünstlern besondere Sonderraten für die Beförderung aus und Theater-Eigner, die die Wichtigkeit dieser Transportmittel erkannten, siedelten ihre Spielhäuser entlang der Eisenbahnnetze an.2 Auch Schiffe gehörten in dieser Zeit, wie zahlreiche Quellen belegen, zu einem wichtigen Beförderungsmittel. Diesen Aspekt hebt Marlis Schweitzer in ihrem Transatlantic Broadway hervor, wo sie aufzeigt, dass durch den Einsatz von Dampfschiffen für viele Theaterschaffende nicht nur weite Distanzen in kurzer Zeit bewältigbar wurden, sondern, dass diese Art zu reisen auch mit erheblichen Kosten einherging; ein Aufenthalt über dem Atlantik rechnete sich für viele erst nach Monaten.3
Ein biographischer Ansatz, der die Mobilität fokussiert, eröffnet zudem die Möglichkeit, das Mobilitätsverhalten selbst zu untersuchen. Dies möchte ich anhand einiger Beobachtungen der Mobilitätsanalyse von Migranten aus dem Theaterbereich, im Folgenden ‚Theatermigranten‘ genannt, zeigen:4 Betrachten wir die basale Bedeutung des Terminus Mobilität, so lässt sich dieser als „displacement – the act of moving between locations“ oder auch „getting from point A to point B“ mit dem Geographen Tim Cresswell auf den Punkt bringen.5 So weist im klassischen Verständnis auch jeder Akt der Migration einen Ausgangs- und einen Endpunkt auf. Everett S. Lee konstatiert: „every act of migration involves an origin, [and] a destination.“6 Unter einem Migranten wird demzufolge eine Person verstanden, die von einem Land A auswandert und in ein Land B, das Zielland, einwandert und in dieses zunächst den Lebensmittelunkt verlagert. Somit rücken bei einem biographischen Ansatz zwei wichtige Mobilitätsmomente ins Visier: die Auswanderung und die Einwanderung; Momente also, die für die Theatergeschichtsschreibung bis dato keine besondere Rolle spielten. Bei der Auswertung der Biographien von Theatermigranten konnte ich feststellen, dass innerhalb des Theaterbusiness zwischen 1850 und 1914 Theatermigranten auszumachen sind, die in dieses eindimensionale Transitschema (von Land A nach Land B bzw. vom Herkunftsland in das Aufnahmeland) der klassischen Definition eingeordnet werden können. So sind beispielsweise die Shubert Brüder Samuel, Lee und Jacob als Kinder 1882 aus Litauen in die USA eingewandert,7 wo sie als Erwachsene eines der bedeutendsten Theaterimperien ihrer Zeit aufbauten. Auch wenn die Brüder berufsbedingt stets mobil waren, um Stars, Theaterstücke oder Inszenierungen für ihre Theaterhäuser aufzuspüren, blieb ihr Lebensmittelpunkt in den USA. Beim Studium der Mobilität von Theatermigranten fällt jedoch auch auf, dass das eindimensionale Transitschema weiter ausdifferenziert werden muss: Fokussieren wir die Ausreise und die Einreise von Theatermigranten, so fällt ein weiterer Aspekt in Hinblick auf das Mobilitätsverhalten auf: nämlich, dass Theaterschaffende in vielen Fällen nicht einfach im Einreiseland blieben; das Einreiseland war also oftmals nur ein Übergangsland – je nach Engagement, politischer oder familiärer Situation. Dies veranschaulicht z. B. die Migrationsgeschichte des Dramatikers und Theaterdirektors Heinrich Börnstein, der im Verlauf seines Lebens in verschiedenen Ländern lebte. Sein ‚Von Ort-zu-Ort-Reisen‘ ist einerseits familiär bedingt: Geboren 1805 in Hamburg wanderte er im Alter von 8 Jahren mit seiner Familie nach Lemberg aus. Andererseits hat seine Migration professionelle und politische Gründe: So führte ihn sein beruflicher Weg beispielsweise nach Österreich und dort nach Wien, St. Pölten und Linz. Nach kürzeren Stationen in Kroatien, Italien und Deutschland ging er 1842 über Straßburg nach Paris, wo er als Übersetzer, Dramatiker, Theaterdirektor und Herausgeber der Zeitschrift Vorwärts. Pariser Signale aus Kunst, Wissenschaft, Theater, Musik und geselligem Leben war. Da sich das Blatt zum Sprachrohr der radikalen deutschen Oppositionsbewegung mit revolutionär-demokratischer Ausrichtung und antipreußischen Tendenzen entwickelte, musste Börnstein nach der Niederschlagung der Februar Revolution Europa verlassen. Wie viele politische Exilanten dieser Zeit emigrierte er – gemeinsam mit seiner Familie – in die USA. Mit dem Dreimaster Espindola brach er am 4. Februar 1849 von Le Havre auf und erreichte nach 62 Tagen in New Orleans amerikanischen Boden. In den USA ließ er sich zuletzt in St. Louis nieder, wo er neben journalistischen Arbeiten seine Tätigkeit am Theater fortsetze und sich auch im Bürgerkrieg engagierte. Schließlich wurde er 1862 von Lincoln als Konsul nach Bremen geschickt, wo er allerdings nur ein paar Jahre blieb. 1869 zog er weiter nach Wien, wo er wieder am Theater zu arbeiten begann.8
Heinrich Börnsteins Lebensweg veranschaulicht ein ausgeprägtes Migrationsverhalten sowie unterschiedliche Motivationen für die Ortswechsel. Keinesfalls handelt es sich um einen Sonderfall. Aufgrund einer politisch turbulenten Zeit, aber auch der Strukturen und Arbeitsbedingungen am Theater, die einen häufigen Wechsel der Engagements erforderten, wurden viele Theaterschaffende dieser Zeit zu Migranten. Am Beispiel Börnsteins wird jedoch ein weiterer Aspekt sichtbar, nämlich der der Rückkehr. Für viele Emigranten, insbesondere politische Exilanten wie auch Arbeitsmigranten, beinhaltete die Auswanderung auch eine Option zur Rückkehr.9 Die Gründe waren vielfältig, so z.B., weil sich die politische Lage in der Heimat stabilisiert hatte, sie genügend Geld verdient oder weil sich ihre Vorstellungen nicht erfüllt hatten.
Ein biographischer Ansatz, der die jeweiligen Aufenthaltsstationen berücksichtigt und untersucht, erlaubt zudem beliebte und starkfrequentierte Reise-, Handels- und Migrationsrouten zu identifizieren. So konstatieren Christopher Balme und Nic Leonhardt:
The focus on ‚routes‘ directs our attention to connections between nodal points. […] these nodal points emanated from metropolitan centres, especially those that functioned as imperial capital cities. We know from research into shipping routes, submarine telegraph trajectories, and later telephone lines, that very specific lins of communication were established and maintained primarily to service either the lines themselves or colonial towns and cities. One working hypothesis is that the theatrical trade made use of these existing routes and provided a kind of cultural superstructure to enhance living conditions in what were often entirely commercial, administrative and military centres. But it is equally important to track less obvious trajectories and routes, which probably established themselves between colonial centres, and not just between the metropolitan centre and the periphery.10
Bei einer solchen Analyse der Routen sind Verfahren und Werkzeuge aus dem Bereich der Digital Humanites äußerst hilfreich. Einerseits um die Fülle an gesammelten Daten verwalten zu können, aber auch um diese in Relation zu bringen und die Ergebnisse mittels digitaler tools zu analysieren und zu visualisieren. Erste Schritte in diese Richtung veranschaulichen Projekte wie „Digital Yddish Theatre“ von Debra Caplan und Joel Berkowitz11, „Theatrescapes“ von Nic Leonhardt12 oder „Moving Bodies, Moving Culture“ von Kate Elswit13.