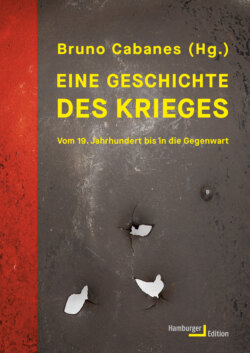Читать книгу Eine Geschichte des Krieges - Группа авторов - Страница 21
Ein Abnutzungskampf
ОглавлениеWie sind diese Schlachten zu den Kriegszielen ins Verhältnis zu setzen, und was waren ihre strategischen Funktionen? In seinen Memoiren nach dem Krieg versicherte Falkenhayn, sein Ziel sei es gewesen, der französischen Armee möglichst große Verluste zuzufügen, welches er sogar 1915 in einer »Weihnachtsdenkschrift« festgehalten habe. Doch das Original dieses Dokuments konnte nicht aufgefunden werden, obwohl sogar die Historiker des Reichsarchivs danach suchten, bevor die preußischen Militärarchive durch die alliierten Bombardements im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurden. Wenn dies seine Intention gewesen sein sollte, dann ist zumindest sonderbar, dass sich keine Spuren davon in den operativen und taktischen Plänen für den Angriff der 5. deutschen Armee oder in deren anfänglicher Umsetzung finden.
Fast dasselbe ließe sich zu Douglas Haig in Somme sagen. Auch er brachte in seiner Depesche vom 29. Dezember 1916 klar den Abnutzungskampf zur Sprache, mit dem er die deutsche Armee zu erschöpfen versucht hatte. Doch die Dokumente stützen seine Behauptung nicht: Bis einschließlich Juli 1916 hatte er den Plan, mit der Schlacht einen Durchbruch zu erreichen. Außerdem ist wie schon im deutschen Fall allein die Tatsache, dass über Haigs Absichten so viel diskutiert werden konnte, ein Indikator für Unklarheiten in der Schlachtplanung. Rawlinson, der Haig unterstellt war, wollte eine Schlacht mit begrenzten Zielen führen. Daraus resultierte eine Art Kompromiss, ein ständiges Zaudern zwischen Durchbruch und Abnutzungsschlacht, das sich über die ganze zweite Jahreshälfte 1916 hinzog.
Am Ende der Schlacht um Verdun und der Schlacht an der Somme war mangels anderer Ziele tatsächlich die Erschöpfung des Gegners zum Ziel geworden. Die Heerführer und mit ihnen die offiziellen Historiker des Krieges versuchten, die Verluste in beiden Lagern zu evaluieren, um zu einer Einschätzung zu kommen, wer gewonnen und wer verloren hatte, und zwar gerade weil es ihnen nicht gelang, das Ergebnis der Auseinandersetzungen in Form von Gebietsgewinnen oder politischen Vorteilen auszudrücken. Von Abnutzungsschlacht zu sprechen war in diesem Sinne eine Form, die Niederlage zu rationalisieren. Dass über den Umfang der Verluste an Menschenleben sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen bis heute Unklarheit besteht, unterstreicht auch noch einen anderen Sachverhalt: 1916 gelang es weder der Offensive noch der Defensive, die Oberhand zu gewinnen. Man dachte, dass die beträchtliche Zunahme der Feuerkraft der Verteidigung einen substanziellen Vorteil verschaffen würde, weil der Angreifer viel schwerwiegendere Verluste würde hinnehmen müssen. Doch das war nicht der Fall. Die Verteidiger mussten ihre Stellungen unter fürchterlichem Artilleriebeschuss halten. Die deutschen Truppen verloren mehr Soldaten in Somme, wo sie sich in Verteidigungsstellung befanden, als bei Verdun, wo sie – zumindest für die erste Hälfte der Schlacht – im Angriff waren.
Der Angreifer hätte die Initiative nutzen und seine Kräfte auf einen entscheidenden Punkt des Schlachtfeldes konzentrieren können sollen. In Wirklichkeit war ihm dies nur selten möglich, weil die Armeeführung, die Kontrolle über die Operationen, die Kommunikation und die Ausbildung nicht den Problemen gewachsen waren, die durch Massenheere aufgeworfen werden. Die Abnutzungsschlacht gehörte vielleicht nicht zum anfänglichen Plan, doch indem Falkenhayn und Haig sie zur Rationalisierung ihrer Handlungen anführten, verschärften sie nur die Kritik derer, die in ihnen Mörder statt Heerführer sahen. Diese Kontroversen vernachlässigen allerdings einen wichtigen Punkt: Die Abnutzungsschlacht verursachte beträchtlich geringere Verluste als der Bewegungskrieg 1914. Und relativ zum Umfang und zur Dauer der Kämpfe waren die Verluste bei Verdun und in Somme geringer als bei Waterloo. Das Bitterste ist jedoch, dass bei Verdun und in Somme beide Lager fast gleich viele Soldaten verloren. Die ganze Idee eines Abnutzungskrieges hatte auf taktischer und operativer Ebene überhaupt keinen Sinn.
1923 veröffentlichte ein britischer Offizier namens Frederick Ernest Whitton The Decisive Battles of Modern Times, bei dem schon im Titel das Werk Edward Creasys anklingt, auf dessen prägenden Einfluss dann auch im Vorwort verwiesen wird. Whitton untersucht darin Vicksburg, Königgrätz, Mars-la-Tour, Tsushima und die Schlacht an der Marne, der er 1917 schon einen langen Text gewidmet hatte. Andere Schlachten des Ersten Weltkrieges ließ er in seinem Werk jedoch außen vor, weil er überzeugt war, dass der Wendepunkt des Krieges bereits nach wenigen Wochen erreicht war. Er war übrigens nicht der Einzige, der sich unschlüssig zeigte, wie man an die Schlacht um Verdun und die Schlacht an der Somme, aber auch an die anderen Schlachten des Ersten Weltkrieges herangehen sollte. Drei Jahre später erschien British Battles of Destiny von Boyd Cable, der an ein ziviles Publikum gerichtete Texte über das Leben an der Front im Ersten Weltkrieg und dann in den 1920er Jahren Filmskripte verfasst hatte, deren Handlung während des Krieges spielte. Wie Creasy sechzig Jahre zuvor ließ er sein Werk mit Waterloo enden: In seinen Augen war es noch zu früh, um die Folgen des Krieges von 1914–1918 zu beurteilen.
Whitton und Cable waren keine Autoren von großem Format, doch aus ihren Büchern wird etwas Grundlegendes ersichtlich. Die aus dem 19. Jahrhundert überkommene Definition der Schlacht hatte ihre Geltung verloren. Auch Hervé Drévillon beendete sein Buch Batailles von 2007 mit der Schlacht an der Marne. Nach 1914, erklärte er, war die Idee einer direkten und entscheidenden Konfrontation an einem klar umschriebenen Ort und in einer begrenzten Zeit obsolet geworden. Douglas Haig, der 1916 statt von Schlacht von Feldzug sprach und damit zu denen gehörte, die mit einer Änderung der Definition den Anfang machten, argumentierte in seiner letzten Depesche von 1919, als er sein Kommando über die British Expeditionary Force abgab, ähnlich. Er beschrieb darin die Kämpfe, die zwischen der Schlacht an der Somme im Juli 1916 und der Schlacht an der Somme im November 1918 stattfanden, als »eine einzige große Schlacht«13. Um die Schlacht mit ihrem Resultat in Verbindung zu bringen, musste Haig sie räumlich und zeitlich (mehr als zwei Jahre) ausdehnen. Doch mit seinem Bemühen, innerhalb der Grenzen des vertrauten Vokabulars Rechenschaft über die großen Veränderungen zu geben, die sich an der Natur des Krieges vollzogen hatten, schuf er Verwirrung. Damit war er nicht alleine: Auf diese Weise überzeugte sich die deutsche Armee davon, 1918 nicht auf dem Schlachtfeld besiegt worden zu sein, da es an der Westfront zu keiner letzten und entscheidenden Schlacht gekommen war.