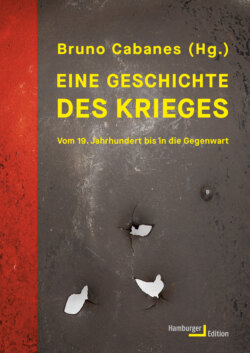Читать книгу Eine Geschichte des Krieges - Группа авторов - Страница 23
Vermeidung der nuklearen Schlacht
ОглавлениеNach 1945 machte die Logik der nuklearen Abschreckung deutlich, dass die Epoche der Entscheidungsschlachten lange vergangen war: Ziel der Strategie war von nun an, Schlachten zu vermeiden, und nicht, sie zu suchen. Dennoch inspirierten sie weiterhin die Öffentlichkeit ebenso wie die Historiker, was zum Beispiel das 1953–1955 veröffentlichte dreibändige Werk von Fuller zeigt. 2001 hauchte Victor Davis Hanson, ein Althistoriker und Spezialist für den Hoplitenkrieg, mit seinem ambitionierten, aber überbewerteten Buch Carnage and Culture. Landmark Battles in the Rise of Westen Power dem Begriff der Schlacht neues Leben ein. Er betont eine Kontinuität von der griechischen Antike, dem whig-Geschichtsbild nach die Wiege der westlichen Welt, bis zu den Vereinigten Staaten. Aus seiner Sicht haben diese beiden Mächte Siege davongetragen, weil sie sich auf vergleichbare Weise kulturell von ihrer Umwelt unterschieden. Beide, demokratisch verfasst und diszipliniert, brillierten dabei, »ihre Zivilisation einzusetzen, um andere zu töten«.17 Hanson kam außerdem zu dem Urteil, dass der Infanteriekrieg von Natur aus demokratisch sei, weil freie Menschen besser kämpfen als Berufssoldat*innen, und dass zahlenmäßig unterlegene, aber nach diesen Prinzipien ausgebildete Truppen zahlenmäßig stärkere Kräfte besiegen können.
Das Buch erschien gerade zu einem Zeitpunkt, als die Vereinigten Staaten die internationale Bühne zu dominieren schienen. Es nährte eine bestimmte triumphalistische Erzählung, die sich von der Vergangenheit bis in die Zukunft erstreckte. Doch in den militärischen Interventionen, die auf die Anschläge des 11. September 2001 folgten, schienen die Vereinigten Staaten, obwohl sie die Schlachten klar gewannen, die Kriege zu verlieren. Der Schwachpunkt in Hansons Argumentation rührt von seiner Neigung her, alle anderen Formen des Krieges, die er als kulturell inkompatibel mit der Demokratie beurteilt, zu verwerfen. Nur ergibt die frontale Auseinandersetzung, der sich die Hopliten stellten, weniger Sinn als der Hinterhalt und der Überraschungsangriff. Warum sich der Gefahr aussetzen, wenn man sie meiden und trotzdem seine Ziele erreichen kann? In den Kriegen der Antike kam es vor, dass die Griechen die Schlacht vermieden, und dasselbe gilt für bestimmte Episoden des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges.
Tatsächlich ist der Guerillakrieg seit 1945 zur vorherrschenden Kampfform geworden. In seinen theoretischen Schriften über den Revolutionskrieg nahm Mao Zedong an, dass die Methoden des irregulären Kampfes zu einer letzten Etappe führen, in der die Revolutionsarmee über ihre Gegner obsiegt. 1954 schien ihm Vô Nguyên Giáp recht zu geben, als er mit der Schlacht von Diên Biên Phu die französische Herrschaft in Indochina beendete. Doch sein Erfolg ist eine Ausnahme: Seit 1945 ist so gut wie kein irregulärer Krieg auf dem Schlachtfeld entschieden worden. In Vietnam und in Afghanistan gelang es den überlegenen konventionellen Streitkräften, die für die Schlacht ausgebildet waren, nie, sich an den irregulären Guerillakrieg anzupassen, sodass die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion am Ende ihre Niederlage eingestehen mussten.
Die Idee der Entscheidungsschlacht erreichte ihren Höhepunkt in einer Epoche, in der die Staaten autokratisch regiert wurden und die Armeen von vorindustriellen Gesellschaften organisiert und ausgerüstet wurden. Demokratisierung und Industrialisierung haben beide die Bedeutung der Schlachten im Krieg erschüttert. Dennoch ist der Niedergang der Schlacht nie in aller Klarheit anerkannt worden – und das aus drei Gründen. Der erste hängt damit zusammen, dass das Gefecht den Kern der Schlacht ausmacht und auch für die anderen Formen der Kriegführung zentral ist, und dies bildet das zusammenschließende und übergreifende Element, das für die Idee, die wir uns vom Krieg machen, nötig ist. Der zweite Grund ist, dass die Berufsarmeen die Idee der Schlacht als höchste Prüfung ihres Könnens kultiviert haben – als das, was Strategie mit Taktik verbindet und der Idee einer Kriegskunst Konsistenz gibt. Drittens und allgemeiner bleiben Schlacht und Schlachterfahrung etwas ihrer Natur nach Rätselhaftes. Die Kombattant*innen haben nicht die Zeit, zu schreiben oder nachzudenken, wenn sie sich in die Schlacht geworfen finden, und was sie im Nachhinein rekonstruieren, bleibt partiell und selektiv. Diejenigen, die nie an einer Schlacht teilgenommen haben, bleiben in diesen Erzählungen gefangen, und sie sind sich bewusst, dass es ihnen niemals gelingt, ihre ganze Bedeutung zu durchdringen.
Sir Hew Strachan ist Professor für Internationale Beziehungen an der St. Andrews University. Er ist einer der wichtigsten Forscher über die Militärgeschichte des Ersten Weltkrieges und Verfasser insbesondere eines Klassikers: The First World War, Bd. 1: To Arms (Oxford 2001).